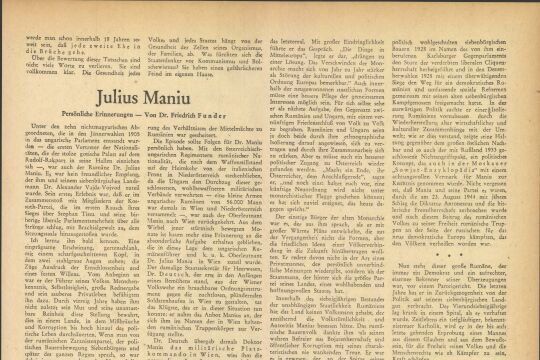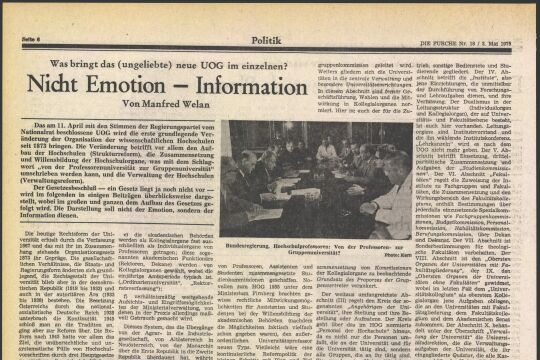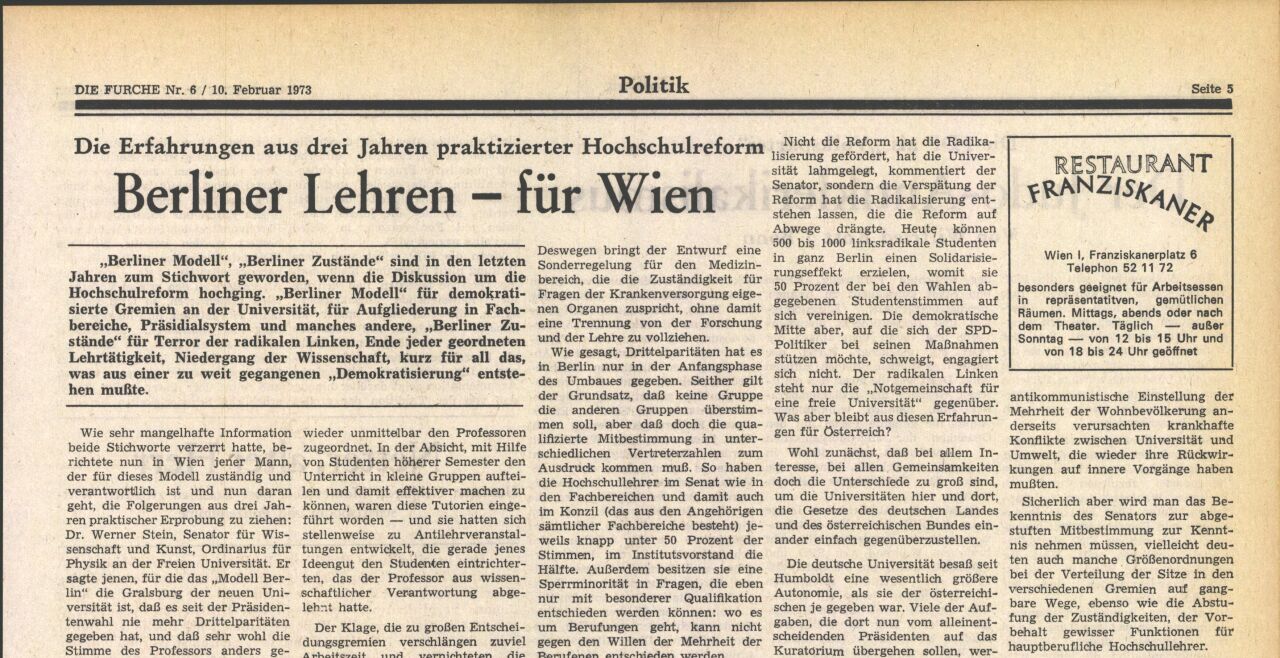
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Berliner Lehren - für Wien
„Berliner Modell", „Berliner Zustände" sind in den letzten Jahren zum Stichwort geworden, wenn die Diskussion um die Hochschulreform hochging. „Berliner Modell" für demokratisierte Gremien an der Universität, für Aufgliederung in Fachbereiche, Präsidialsystem und manches andere, „Berliner Zustände" für Terror der radikalen Linken, Ende jeder geordneten Lehrtätigkeit, Niedergang der Wissenschaft, kurz für all das, was aus einer zu weit gegangenen „Demokratisierung" entstehen mußte.
„Berliner Modell", „Berliner Zustände" sind in den letzten Jahren zum Stichwort geworden, wenn die Diskussion um die Hochschulreform hochging. „Berliner Modell" für demokratisierte Gremien an der Universität, für Aufgliederung in Fachbereiche, Präsidialsystem und manches andere, „Berliner Zustände" für Terror der radikalen Linken, Ende jeder geordneten Lehrtätigkeit, Niedergang der Wissenschaft, kurz für all das, was aus einer zu weit gegangenen „Demokratisierung" entstehen mußte.
Wie sehr mangelhafte Information beide Stichworte verzerrt hatte, berichtete nun in Wien jener Mann, der für dieses Modell zuständig und verantwortlich ist und nun daran geht, die Folgerungen aus drei Jahren praktischer Erprobung zu ziehen: Dr. Werner Stein, Senator für Wissenschaft und Kunst, Ordinarius für Physik an der Freien Universität. Er sagte jenen, für die das „Modell Berlin" die Gralsburg der neuen Universität ist, daß es seit der Präsidentenwahl nie mehr Drittelparitäten gegeben hat, und daß sehr wohl die Stimme des Professors anders gewertet werden müsse, als jene des Studenten; und jenen, für die die „Berliner Zustände" gleichbedeutend mit dem Chaos stehen, daß manche Fehlentwicklungen hätten vermieden werden können, wenn jene, ohne die es auf der Universität eben nicht geht, mitgearbeitet hätten, statt die Initiative den Radikalen zu überlassen.
Denn daß es seit der Erlassung des Berliner Uriiversitätsgesetzes von 1969 zu manchen Entwicklungen gekommen war, die man nicht erwartet und schon gar nicht gewünscht hatte, berichtete Stein sehr offen. Deswegen müsse jetzt eine „Runde der Korrekturen'" eingeschaltet werden, um diese Fehlentwicklungen zurechtzurücken. Stein verwahrte sich gegen den Vorwurf der Linken, die Reform zurücknehmen zu wollen. Der Senat stehe zu den Grundsätzen der Reform und wolle gerade ihnen zu ihrem Recht verhelfen. Aber es gehe nicht an, an die Stelle der alten „Ordinarien-Universität" nun eine „Antiprofessoren-Universität" setzen zu wollen.
Deswegen legte Stein im Oktober 1972 dem Stadtparlament einen Referentenentwurf vor, der alle jene Paragraphen abändert, die zu diesen Fehlentwicklungen geführt haben. Da werden zunächst die Tutoren wieder unmittelbar den Professoren zugeordnet. In der Absicht, mit Hilfe von Studenten höherer Semester den Unterricht in kleine Gruppen aufteilen und damit effektiver machen zu können, waren diese Tutorien eingeführt worden — und sie hatten sich stellenweise zu Antilehrveranstal-tungen entwickelt, die gerade jenes Ideengut den Studenten eintrichterten, das der Professor aus wissenschaftlicher Verantwortung abgelehnt hatte.
Der Klage, die zu großen Entscheidungsgremien verschlängen zuviel Arbeitszeit und vernichteten die Effizienz der Hochschule, wird durch den Vorschlag einer Verkleinerung der Gremien entsprochen: Etwa der Fachbereichsrat (anstelle der alten Fakultät) bestand bisher aus 15 Mitgliedern. Er soll nun nur noch neun umfassen. Bisher saßen darin sieben Hochschullehrer (Professoren und Privatdozenten), vier Vertreter des „Mittelbaus", drei Studenten und ein Vertreter der „sonstigen" (nichtwissenschaftlichen) Mitarbeiter. Nun soll das Verhältnis auf vier Hochschullehrer, einen Assistenzprofessor, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, zwei Studenten und einen nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter vermindert werden. Der Vorsitzende des Fachbereichsrates wird nun mehr als bisher in eigener Entscheidung erledigen können.
Ein Punkt, der in der österreichischen Hochschulgesetzgebung keine Entsprechung besitzt: Bisher war der Präsident — der an die Stelle des Rektors getreten ist — der Dienstherr, der für die Anstellung aller Universitätsangehörigen zuständig war. Nun soll diese Funktion auf das Kuratorium übergehen, das sich je zur Hälfte aus Universitätsangehörigen und Vertretern des Staates (Senatoren und Abgeordneten) zusammensetzt.
Wo es um die Gesundheit geht, werden eigene Kriterien notwendig.Deswegen bringt der Entwurf eine Sonderregelung für den Medizinbereich, die die Zuständigkeit für Fragen der Krankenversorgung eigenen Organen zuspricht, ohne damit eine Trennung von der Forschung und der Lehre zu vollziehen.
Wie gesagt, Drittelparitäten hat es in Berlin nur in der Anfangsphase des Umbaues gegeben. Seither gilt der Grundsatz, daß keine Gruppe die anderen Gruppen überstimmen soll, aber daß doch die qualifizierte Mitbestimmung in unterschiedlichen Vertreterzahlen zum Ausdruck kommen muß. So haben die Hochschullehrer im Senat wie in den Fachbereichen und damit auch im Konzil (das aus den Angehörigen sämtlicher Fachbereiche besteht) jeweils knapp unter 50 Prozent der Stimmen, im Institutsvorstand die Hälfte. Außerdem besitzen sie eine Sperrminorität in Fragen, die eben nur mit besonderer Qualifikation entschieden werden können: wo es um Berufungen geht, kann nicht gegen den Willen der Mehrheit der Berufenen entschieden werden.
Aber wer ist heute „die Universität", die sich brüskiert fühlt, wenn man versucht, Fehlentwicklungen zurechtzurücken? Stein ließ durchblicken: Fachbereichsräte, Senate, Präsidenten, Studentenvertretungen, in denen die radikale Linke dominiert. Dort wehrte man sich auch dagegen, daß der Senat sich vom Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Prof. Luest, Namen namhafter Männer aus der BRD für eine Expertenkommission nennen ließ, die die Vorschläge für die Verbesserungen ausarbeiten sollte.
Ein Verhältnis gewisser Spannung zwischen Universität und Staat ist sicher normal und dient dazu, den Motor der gegenseitigen Beziehungen in Gang zu halten. In Berlin hat wohl die Inselneurose eines Vierteljahrhunderts der Einschließung auch dieses Verhältnis- neurotisiert. 1948 schien die Freie Universität das Modell einer gesellschaftsbezogenen modernen Universität zu sein, wo Universitätsangehörige und Staatsvertreter gemeinsam die Geschicke im Kuratorium bestimmten. 20 Jahre später mußten erst Studentenunruhen Öffentlichkeit und Politik daran erinnern, daß auch hier Reformen nötig wären — als sie dann wirklich einsetzten, waren sie auch schon verpolitisiert.
Nicht die Reform hat die Radikalisierung gefördert, hat die Universität lahmgelegt, kommentiert der Senator, sondern die Verspätung der Reform hat die Radikalisierung entstehen lassen, die die Reform auf Abwege drängte. Heute, können 500 bis 1000 linksradikale Studenten in ganz Berlin einen Solidarisie-rungseffekt erzielen, womit sie 50 Prozent der bei den Wahlen abgegebenen Studentenstimmen auf sich vereinigen. Die demokratische Mitte aber, auf die sich der SPD-Politiker bei seinen Maßnahmen stützen möchte, schweigt, engagiert sich nicht. Der radikalen Linken steht nur die „Notgemeinschaft für eine freie Universität" gegenüber. Was aber bleibt aus diesen Erfahrungen für Österreich?
Wohl zunächst, daß bei allem Interesse, bei allen Gemeinsamkeiten doch die Unterschiede zu groß sind, um die Universitäten hier und dort, die Gesetze des deutschen Landes und des österreichischen Bundes einander einfach gegenüberzustellen.
Die deutsche Universität besaß seit Humboldt eine wesentlich größere Autonomie, als sie der österreichischen je gegeben war. Viele der Aufgaben, die dort nun vom alleinentscheidenden Präsidenten auf das Kuratorium übergehen sollen, werden in Österreich seit je im Ministerium entschieden.
Dann wird man bei der Analyse des Berliner Geschehens abzuziehen haben, was auf das Konto der Kollektivneurose der geteilten Hauptstadt zu setzen ist und was Berlin auch innerhalb der deutschen Hochschullandschaft einen eigenen Rang verleiht. Das Sammelbecken von Wehrdienstverweigerern und Ostflüchtlingen, die Unterwanderung aus dem Osten einerseits, die scharf antikommunistische Einstellung der Mehrheit der Wohnbevölkerung anderseits verursachten krankhafte Konflikte zwischen Universität und Umwelt, die wieder ihre Rückwirkungen auf innere Vorgänge haben mußten.
Sicherlich aber wird man das Bekenntnis des Senators zur abgestuften Mitbestimmung zur Kenntnis nehmen müssen, vielleicht deuten auch manche Größenordnungen bei der Verteilung der Sitze in den verschiedenen Gremien auf gangbare Wege, ebenso wie die Abstufung der Zuständigkeiten, der Vorbehalt gewisser Funktionen für hauptberufliche Hochschullehrer.
Vor allem aber dürfte das Berliner Geschehen jenen Überlegungen Auftrieb geben, die dafür eintreten, gewisse Formen zunächst probeweise einzuführen, um zu sehen, was daraus entsteht. Dann muß man aber auch bereit sein, es später auch ohne Prestigerücksichten einzugestehen, wenn sich die eigenen Erwartungen nicht erfüllt haben, und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Wie es in Berlin der Fall ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!