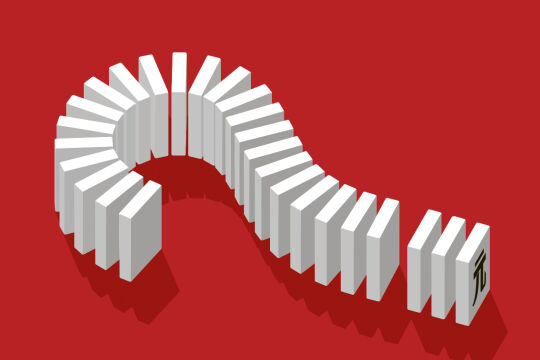„Das chinesische Volk läuft nicht Gefahr, zu einer Konsumgesellschaft zu werden.”
Derek Bryan, britischer Botschaftssekretär
Die breite Pekinger „Avenue des Langen Friedens” quillt von Radfahrern! über. Zehn, zwölf Chinesen pe- dalen nebeneinander, in beiden Richtungen, und die wenigen Autos, welche die mittleren Fahrbahnen befahren, haben Mühe, sich durchzuringen. Ihr penetrantes Hupen scheint nur wenig Eindruck zu machen. Wenn das radelnde Gedränge zu beängstigend und die automobi- listischen Warnsignale allzu unüberhörbar werden, drehen die am meisten gefährdeten Radfahrer brüsk die Lenkstange nach rechts, was zu einer Kettenreaktion im betreffenden Abschnitt der dahinrollenden Fahrradschlange führt.
Für einen Europäer, der sich durch Straßenmarkierungen und Stoppsignale, Verbote und Gebote lenken und einengen läßt, bleibt der Pekinger Straßenverkehr rätselhaft. Kaum ein Radfahrer dreht seinen Kopf um, bevor er nach rechts oder nach links abbiegen will, kaum ein Automobilist scheint sich um die anderen Straßenbenützer zu kümmern, und selbst die Verkehrspolizisten verfügen offenbar nicht über einen Strafmandatsblock. Jedenfalls zücken sie ihn wegen Überfahrens der Sicherheitslinie, wegen Rechtsüberholens oder anderer derartiger Kleinigkeiten nicht.
Und trotzdem: Unfälle gibt es kaum, nicht einmal harmlose Stürze der unzähligen Radfahrer. Die Chinesen, so scheint es jedenfalls, orientieren sich weniger mit den Augen als vielmehr mit den Ohren und dem Gefühl.
Dies wird auch deutlich auf dem riesigen Tian-an-men-Platz, der sich über vierzig Hektar zwischen der Pforte des Himmlischen Friedens und jener des Quan-men ausdehnt. Gruppen von Arbeitern überqueren ihn emsig in der Mittagspause, Chinesen aus der Provinz, die das monumentale Stadtzentrum kennenlemen wollen, flanieren herum, Soldaten bewundern das am 1. Mai 1958 ein- geweih’te Denkmal für die Helden des Volkes und ausländische Besucher halten mit ihren Photoapparaten die anderen Sehenswürdigkeiten dieses Platzes fest: Die rote Südmauer des alten Kaiserpalastes mit dem stolzen Bild Maos über der großen Pforte, im Westen die Halle der Volksversammlung, im Osten die Museen, im Süden flankiert von zehntausend Bäumen: Weiden,
Ahorn und Fichten.
Auch auf diesem Platz zwängen sich vereinzelt Autos durch die Menge, die sich keineswegs aus der Ruhe bringen läßt, ohne aber deshalb den Verkehr zu behindern. Dieses Nachgeben, ohne es zur Schau zu stellen, dieses Verharren ohne Bockbeinigkeit — das charakterisiert den Chinesen und hebt ihn gleichzeitig von den hektisch-überheblichen Europäern ab.
Zwei Vierecke aber sind auf diesem Platz durch Seile eingezäunt und damit gegen Auto- oder Fahrradverkehr abgeschirmt. Auf ihren Schmalseiten, die Sonne im Rücken, drängen sich die Menschen, lachen, diskutieren und warten diszipliniert. Einzeln, oder zu zweit, oder zu dritt werden sie vorgelassen. Die Wartenden rufen ihnen zu, klatschen, und dann steigt ein Photogrph auf einen Schemel und gibt seine letzten Anweisungen: „Etwas mehr rechts! Etwas mehr links! Den Kopf etwas mehr höher!” Nur eines braucht er nicht zu sagen: „Bitte recht freundlich”, denn Freundlichkeit und ein fröhliches Gesicht scheinen den Chinesen angeboren. Und nun ein leichtes Klicken, allgemeiner Jubel, und dann ist der nächste an der Reihe.
So zieht buchstäblich das Volk vor den Photographen vorbei. Eine Mutter mit ihrem Kind, das eben seinen Geburtstag feiert; ein Soldat, der in Peking auf Urlaub ist; ein Mann, der für einen Personalausweis ein Bild braucht, eine junge Frau, die ihrem
Verehrer ein Photo schenken möchte; ein Pärchen, das das gemeinsame Glück verewigen will. Photographien für ale Lebenslagen — und die purpurrote Pforte des himmlischen Friedens als Kulisse. Die vier riesigen Porträts von Marx und Engels, Lenin und Stalin, die die Ecken zur Avenue flankieren, kommen zwar nicht mehr ins Bild, mahnen aber, zusammen mit dem allgegenwärtigen Mao Tse-tung, das Volk, den abgesteckten Weg nicht zu verlassen.
Vor allem der Vorsitzende Mao ist das Leitbild, nach dem nicht nur die Gemeinschaft, sondern auch das Leben jedes einzelnen ausgerichtet sein muß. Zwar spricht man in China grundsätzlich nicht vom Einzelmenschen, sondern von den Massen — die aber letzten Endes von einzelnen geformt sind. Sein Verhältnis zu den Massen umschrieb Mao einst mit den Worten: „Wenn man sich mit den Massen verbinden will, muß man den Bedürfnissen und Wünschen der Massen entsprechend handeln… Hier gibt es zwei Prinzipien. Das eine lautet: Man muß von den realen Bedürfnissen der Massen ausgehen, nicht aber von solchen, die wir uns einibilden. Das andere besagt: Die Massen müssen es selbst wünschen, der Entschluß muß von den Massen selbst gefaßt werden, nicht aber von uns an ihrer statt.”
Welches aber sind die Wünsche der chinesischen Massen? An der Basis sind es zweifellos die gleichen Wün- che wie jene aller unverdorbenen Völker, die noch nicht verwöhnt sind: Friede, gesichertes und ausreichendes Einkommen. Beides ist in China gegeben. Es gibt keinen Krieg und keine Unruhen und man findet zwar Arme und weniger Arme, aber keine Notleidenden. Das ist für ein Volk, das noch vor Jahrzehnten bald unter einer tödlichen Trockenheit, bald unter einer alles zerstörenden Überschwemmung litt, ein ungeheurer Fortschritt. Trotzdem warnte Mao Tse-tung: „Wir müssen es der ganzen Jugend beibringen, daß unser Land gegenwärtig noch sehr arm ist und daß man diese Lage nicht in kurzer Zeit von Grund auf ändern kann.”
Was aber, wenn — wenigstens in einigen Regionen dieses Riesenreiches — die Grundbedürfnisse gedeckt sind? Werden die Ansprüche der Massen in Richtung auf eine Konsumgesellschaft gehen? Von einer solchen Tendenz ist man in China natürlich noch weit entfernt, aber man will auch auf lange Frist möglichst weit davon entfernt bleiben. Man möchte den sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt realisieren, ohne jenen Schwierigkeiten und Gefahren zu begegnen, denen sich die Konsumgesellschaft kapitalistischer Länder gegenübersieht.
Die Tendenz zur Mäßigung wird deutlich, wenn man Chinesen beim Einkauf im Warenhaus begleitet. Das dreistöckige Warenhaus hinter dem Ausländerhotel „Peking” bietet alles, was ein Chinesenherz begehrt: Bonbons und Strümpfe, Spielsachen und Büroartikel, Plastiktaschen und Glühbirnen, Werkzeug und Kleider, Gebäck und Wäsche, Schallplatten und Radioapparate, Schirme und Schuhe. Das Haus selbst ist ebenso einfach und schlicht wie die feilgebotenen Waren. Es gibt keinen Lift und keine Rolltreppe, aber alles ist außerordentlich sauber, und dauernd kämpft sich eine Chinesin mit einem breiten feuchten Besen durch die Massen durch, um den Boden rein zu halten. Leute, die Vergleichsmög- lichkeiten haben, sagen, daß ein augenfälliger Wandel zu verzeichnen sei. Noch vor zwei Jahren seien die Waren kaum ausgestellt gewesen, man habe sich also in den betreffenden Abteilungen ausdrücklich nach einem Bleistift oder einer Tasche erkundigen müssen. Auf Verlangen seien dann die begehrten Artikel vorgelegt worden, doch habe man damals noch jeden Kaufanreiz vermeiden wollen. Jetzt aber gibt es Auslagen, wenngleich weder Angebot noch Art der Schaustellung mit unseren Verhältnissen verglichen werden können. Reklameplakate, Räumungsverkäufe oder gar Schlageraktionen fehlen vollständig, was dem Raum auch schon äußerlich etwas Nüchternes und Strenges verleiht.
Nicht anders als bei uns leuchten aber Kinderaugen auf, wenn sie sich der großen Auswahl von Spielzeug gegenübersehen. Zwar sind es keine schikanös-luxuriösen wie bei uns, keine elektrischen Eisenbahnen und keine Gegensprechanlagen, sondern Windspiele und Diabolo, aber leider — wie bei uns — Gewehre und Kriegsspiel; zwar weniger raffiniert gebaut, aber mit dem gleichen negativen Effekt.
Einen eigentlichen Publikumsstau aber gibt es in jeder Ecke, in der Radioapparate feilgeboten werden. Offensichtlich geht das Interesse zumindest der männlichen Chinesen, vor allem der jüngeren, in dieser Richtung. Auch diese Geräte sind, verglichen mit den bei uns gekauften, außerordentlich einfach und schlicht, aber sie versehen ihren Dienst, und dies is’t für den chinesischen Konsumenten die Hauptsache. Stereo, ja selbst Kurzwellen gehören zu jenen Bereichen, in die man sich noch nicht vorwagt, und auch Geräte wie Kassettenrekorder und dergleichen übersteigen die Phantasie der Käufer.
Realistischer sind die Textilien und Schuhe, doch geht dort der Handel recht schnell vor sich. Das Problem ist keineswegs die Qual der Wahl, denn es gibt mehr oder weniger nur „Einheitsmodelle”, die wiederum nicht nach ästhetischen oder gar modischen, sondern ausschließlich nach praktischen Überlegungen ausgerichtet sind.
Was aber an allen Auslagen und Verkaufstischen den Ablauf des Handels hemmt, ist die Kompliziertheit des Systems, wie es in mehr oder weniger allen kommunistischen Ländern festzustellen ist. Man geht hier nicht einfach zur Verkäuferin, um einen Artikel zu wählen, einpacken zu lassen und zu bezahlen. Die Reihenfolge ist verworrener: Zuerst wählt man aus, dann muß man sich an die betreffende Kasse begeben, die nicht unbedingt in nächster Nähe ist, und erst dann geht man wieder zum Tisch zurück, wo nun endlich das betreffende Stück Stoff abgeschnitten oder der betreffende Artikel eingepackt wird. Bei allen drei Stationen — Verkaufstisch, Kasse und wieder Verkaufstisch — riskiert man aber, jeweils warten zu müssen. Chinesische Fremdenführer verwiesen übrigens mehrfach selbst auf die Kompliziertheit und führten sie als Grund dafür an, daß Ausländer eben nicht hier, sondern in den speziellen Ausländergeschäften, den sogenannten „Friendship-Läden”, ihre Einkäufe tätigen sollten. Daß diese „Friendship-Läden” um ein Mehrfaches teurer »sind als die gewöhnlichen chinesischen Warenhäuser, verschwieg des Führers Höflichkeit!
Damit ist die Frage nach den Preisen gestellt, eine Frage, die sich aufdrängt, die sich aber — selbst wenn man Zahlen nennt — mit dem besten Willen nicht korrekt beantworten läßt. Führen wir als entsprechendes und für China auch klassisches Beispiel ein Fahrrad an. Es kostet rund 150 Yuan, was in Schweizer Franken umgerechnet etwa 240 ausmacht. Daß eine solche Umrechnung falsch ist, leuchtet ein, aber selbst ein einfacher Vergleich mit dem Monatslohn eines chinesischen Arbeiters führt zu Fehlschlüssen. Im Durchschnitt verdient nämlich ein Chinese etwa 50 bis 60 Yuan im Monat, also etwa 80 bis 96 Franken, wenn er besonders hoch kommt 80 Yuan oder 128 Franken. Um bei der unteren Kategorie zu bleiben, würde man also sagen, daß ein Fahrrad in China etwa drei Monatslöhnen entspricht, wobei man doch bei uns für drei (allerdings mittlere) Monatslöhne bereits ein Kleinauto erstehen kann.
Dieses Rechenexempel ist rein mathematisch natürlich richtig, berücksichtigt aber in keiner Weise die speziell chinesischen Gegebenheiten. Erstens einmal muß berücksichtigt werden, daß in China — genau wie in allen anderen kommunistischen Ländern — der Mann nicht der einzige Verdiener der Familie ist, daß man also anstatt von 50 in Wirklichkeit von 100 Yuan ausgehen muß. Man mag einwenden, daß bei uns jene Leute, die unbedingt in kürzester Zeit einen Kleinwagen anschaffen wollen, sich ebenfalls auf das Einkommen von Mann und Frau abstützen. Auch dann stimmt der rein rechnerische Vergleich mit China nicht, denn man muß berücksichtigen, daß das Sozialster)! Chinas ganz andere Situationen schafft.
Das Haushaltsbudget eines Durchschnittschinesen sieht ungefähr so aus: Lebensunterhalt für eine vier- köpfige Familie etwa 20 Yuan, Kleider und Ausgaben für Kinder etwa 20 Yuan, Wohnungsmiete etwa 2 Yuan, total also 42 Yuan. Dabei hat der Chinese keine Steuern und keine Versicherungen zu bezahlen, öffentliche Verkehrsmittel oder Kinos kosten fast nichts und sogar für einen Sitzplatz im Staatszirkus, in der Verbotenen Stadt, der ausländischen Gästen als Spezialität gezeigt wird, hat der einfache Chinese etwa 10 bis 20 Rappen zu bezahlen.
Noch viel mehr fällt aber ins Gewicht, daß neben den eigentlichen Lebensnotwendigkeiten fast keine anderen Ansprüche zu decken sind. Abends um 9 Uhr sind sämtliche Gaststätten geschlossen, Ausflüge macht man mit dem Fahrrad und gemütliche Begegnungen spielen sich bei Tee und einfachem Gebäck im Familienkreis ab. Unter diesen Umständen fällt es einem Chinesen wesentlich leichter, bei theoretisch 50 Yuan Monatseinkommen für ein 150 Yuan kostendes Fahrrad zu sparen als einem Schweizer, der, von Sozialprestige und Reklame gedrängt, Geld für irgendeine größere Anschaffung auf die Seite legen will.
Die Frage drängt sich auf, was denn der Chinese mit dem „überschüssigen” Geld anfängt. Auch diese Frage kann nach einem kurzen Chinabesuch nicht eindeutig beantwortet werden. Auf alle Fälle muß festgehalten werden, daß vieles, was wir begehren oder gar bereits als selbstverständlich ansehen, in China überhaupt nicht in Frage kommt. Zum Beispiel ein Auto. Es gibt überhaupt keine privaten Wagen und selbst die offiziellen Stellen scheinen nicht über einen übermäßigen Wagenpark zu verfügen. Ja sogar einem in Peking akkreditierten ausländischen Journalisten ist es untersagt worden, einen Zweitwagen zu importieren. Man drängt darauf, daß auch ansässige Ausländer nicht „im Überfluß” leben.
Bleibt noch die Möglichkeit der direkten Geldanlage. Sie besteht und wird vor allem auf der Ebene der Kommune gefördert. Da eine Kommune nach unseren Begriffen einer Stadt gleichkommt — 50.000 bis 150.000 Einwohner, Landwirtschaftsfläche, Industriebetriebe und minimale eigene Verwaltung — so muß die „Kommunen-Bank” in unserem Sinne einer „Kommunal-Bank”, also einer städtischen Sparkasse gleich- gesetzt werden. Der garantierte Zins allerdings erscheint auf den ersten Blick als nicht unbedingt attraktiv: mit 3 Promille würde man bei uns kaum viele Sparer anziehen können. Bundesrat Pierre Gräber hatte jedoch auf diese Information hin unter vier Augen einen Einwand zur Hand, den es zu bedenken gilt: Wenn wir unsere Inflationsrate vom Zins abziehen, liegen wir wahrscheinlich unter den 3 Promille!” Inflation aber ist in China unbekannt.
Mit Zahlenangaben muß man allerdings vorsichtig sein. Bei Dezi- malrechnungen verschieben sich leicht die Kommastellen, und die Übersetzungen von vier Dolmetschern variierten im Zinssatz zunächst von 0,3 Promille bis zu 30 Prozent. Schließlich aber einigten sie sich auf 3 Promille.
Ob aber 3 Promille oder 3 Prozent, was tut’s? Wenn wir von diesem Gesichtspunkt aus Fortschritt und Erfolg des chinesischen Systems messen wollen, gehen wir fehl. Der Chinese ist viel mehr als der Westeuropäer dm Gemeinschaftsdenken verankert, und zwar nicht aus ideologischen Gründen, sondern seinem ganzen Volkscharakter nach. Im Interesse dieser Gemeinschaft nur 3 Promille einzustecken und auf eine größere Rentabilität zu verzichten, fällt ihm nicht schwer. In kaum ein anderen Land könnte sich eine Persönlichkeit an der Macht halten und die Bewunderung des ganzen Volkes genießen, die — wie Mao Tse-Tung — mit Parolen wie dieser Propaganda betreibt: „Damit unser Land reich und mächtig wird, sind einige Jahrzehnte harten Kampfes notwendig; zu diesem gehört, daß man beim Aufbau des Landes den Kurs ,Fleiß und Genügsamkeit” einhält, ein strenges Sparsamkeitsregime durchführt und gegen Verschwendung kämpft.”