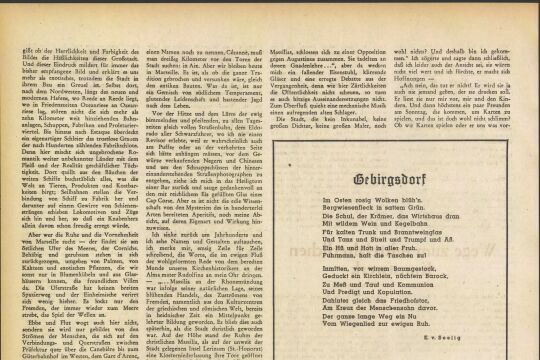Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Besuch in Muzot
Uber Rainer Maria Rilke ist in diesen fünfzig Jahren viel, vielleicht zuviel geschrieben worden. Aber auch zu seinen Lebzeiten gab es schon viele Interpretationen, und eine Biographie von Robert Faesi. Die schätzte ich wenig: ich stellte mir den Dichter anders vor!
Bei meinem Besuch brachte ich die Rede darauf; Rilke sagte, er lese schon seit vielen Jahren weder Rezensionen noch was sonst über ihn geschrieben werde. Er wolle nicht, daß etwas Fremdes zwischen ihn und seine Arbeittrete - so etwa begründete er diese Enthaltsamkeit. Aber, fuhr er lächelnd fort, er könne sich trotzdem ganz gut vorstellen, wie er in diesem Buch dargestellt sei, denn seine damals halbwüchsige Tochter habe es gelesen und ihn dann ganz betroffen gefragt: „Papa, bist du wirklich so dekadent?“
Ich lachte mit ihm; zugleich beschäftigte mich der Gedanke, ob auch ich es einmal zustande bringen würde, einfach nicht zu lesen, was man über mich schriebe...?
Ich war neunzehn Jahre alt und hatte noch nichts veröffentlicht, aber ich machte seit zehn Jahren immer wieder Gedichte und hatte auch versucht, kleine Szenen zu schreiben. Ich las sehr gerne Gedichte, und Rilkes „Stundenbuch“ und das „Buch der Bilder“, auch die „Neuen Gedichte“ und das „Requiem“ waren mir seit langem bekannt. Doch erst 1924 kaufte ich mir die „Sonette an Orpheus“, die es, ebenso wie die „Duineser Elegien“, bereits seit zwei Jahren gab. Ich war gewarnt worden: diese neuen Werke seien sehr schwer verständlich. Tatsächlich verstand ich nur Bruchstücke der „Elegien“, aber die „Sonette“ leuchteten mir sofort ein, bewegten und entzückten mich, und so schickte ich Rilke zwei Dank-Gedichte.
Wahrscheinlich hatte ich gehofft, daß er antworten würde - man schickt wohl keinen Brief ab, ohne einen Schimmer solcher Hoffnung! -, aber als dann wirklich Antwort kam, eine Antwort in Versen, zwei Gedichte, konnte ich es kaum glauben. Und dieses Staunen und Danken mußte sich wieder in Versen ausdrücken. Und wieder kamen Antwort-Verse.* Bald sprachen sie eine zögernde Einladung aus, der ich aber damals noch nicht zu folgen wagte. Vor allem hatte ich Angst, den Dichter zu enttäuschen; ich war beinahe noch ein Schulmädchen und lebte, noch behütet wie ein solches, in der Familie: ich scheute auch die Konfrontation mit den Eltern...
Einundeinhalb Jahre später entschloß ich mich, heimlich und mit ausgeborgtem Geld, zu fahren: als mir Rilke meine Ahnung bestätigt hatte, daß er krank sei.
Ich überraschte ihn in Muzot über Sierre, am 21. November 1925, am späten Nachmittag. Meine Sachen hatte ich im Hotel neben dem Bahnhof gelassen und zunächst einen ganz falschen Weg eingeschlagen, zu einem weithin sichtbaren Schloß auf einem Hügel. Aber das „Chäteau de Muzot“ war kein solches Schloß, sondern ein kleiner, sehr alter, wohnlich ausgestatteter Turm im Weingelände oberhalb des Ortes.
Rüke wirkte nicht wie ein kranker Mann; seine Bewegungen waren rasch, sein Gang leicht, er sprach lebhaft und er lachte gern. Als ich ihn schließlich fragte, sagte er, er wisse nicht, was ihm eigentlich fehle, aber alles sei mühsam geworden, alle Freude sei ihm abhanden gekommen. Als sei sein Körper „gegen ihn“, und er habe sich doch immer mit ihm in Ubereinstimmung befunden...
Kenner der ,3riefe“ werden sich über diesen Ausspruch wundern, denn die Briefe an Menschen, die ihm nahestanden, sind von Jugend an voller Klagen über körperliche Beschwerden. Er muß eben gespürt haben, daß sein Mißbefinden nun ganz anderer Art war. Tatäschlich hat ja zu jener Zeit die tödliche Krankheit, Leukämie, in ihm zu wirken begonnen. Kurz nach meinem Besuch suchte er das Sanatorium über Montreux auf.
In diesen drei Tagen hat Rilke .mir viel vorgelesen; vor allem „Die Palme“ und den „Friedhof am Meer“ aus den eben erschienenen Valery-Ubertra-gungen. Davon hatte ich noch gar nichts gewußt. Er las zuerst den französischen und dann seinen deutschen Text. Ein anderes Mal las er seine „Gedichte an die Nacht“ - und erzählte, wo sie entstanden waren. An einem Nachmittag las er mir den ganzen „Kondor“ von Stifter vor, den er vor kurzem wiederentdeckt hatte und den er besonders hebte. Von vielen Dichtern, die er kannte, erzählte er mir kleine Geschichten, von Romain Rolland, Andre Gide, der Comtesse de Noailles; ich fragte nach Selma Lagerlöf, o ja, er strahlte auf, er kannte sie, hatte sie einmal bei einem feierlichen Essen zur Nachbarin gehabt, und am „Gösta Berling“ habe er schwedisch gelernt! Er sprach vom Einfluß Jacobsens in seiner Jugend, und er nannte mir zeitgenössische Dichter, von denen er noch viel erwarte: Regina Ull-mann und Alexander Lernet-Holenia.
Aber am nachdrücklichsten wies er mich hin auf das Buch eines Autors, der leider schon gestorben sei, auf „Das Schloß“ von Franz Kafka. Ich solle es mir zu Hause gleich beschaffen, denn dies sei zweifellos eines der bedeutendsten deutschen Bücher unserer Zeit.
Er erzählte von den schlimmen Monaten in Wien zu Beginn des Krieges, von der Freundschaft mit der „wunderbaren alten Frau“, Fürstin Thum und Taxis, von Rudolf Kassner und seinem Werk. Aber vor allem hat sich mir eingeprägt, was er von der Qual seiner Kinderjahre in der Militär-Schule in St Pölten erzählte ... Immer noch erregten und bedrängten ihn diese Erlebnisse, er hoffte, sie würden doch noch einmal in einem Buch Gestalt annehmen. - Die Knaben, in ihrer Beengtheit durch äußere Zucht, seien von unbeschreiblicher Grausamkeit gegen einander gewesen. „Stell dir vor, von einem Buben behaupteten sie eines Tages, er habe ein Ohrfeigengesicht; und von da an gab ihm jeder, der gerade vorbeikam, halb im Scherz eine Ohrfeige...“ Er hatte es lächelnd erzählt, wurde jäh tiefernst: „Das ist doch entsetzlich! Der ist daran zugrunde gegangen! Und nie war man allein, nie! Drei Jahre lang! Ein paarmal war ich krank, dann kam man in ein separiertes Zimmer. Aber sie wußten, daß ich Gedichte schrieb und nahmen mir Papier und Bleistift weg...!“
Er erzählte in seinem kleinen Arbeitszimmer oder während des Nachtmahls im eleganten Speisesaal des Hotels und vor allem während langer Spaziergänge in der milden Herbstsonne, auf seinem Lieblingsweg zwischen den Weinbergen. Hier, sagte er, habe er die meisten der „Sonette an Opheus“ in sein Taschenbuch geschrieben. Ganz plötzlich, wie Nachwehen nach der großen Arbeit der „Elegien“, hätten diese Verse ihn überfallen, oft drei oder vier Sonette an einem Tag...
Er erzählte, aber er stellte auch Fragen und hörte zu; es schien ihm nichts auszumachen, daß ich fast noch ein Schulmädchen war, im Gegenteil: als er in meinem Hotelzimmer mein altes hölzernes „Federpennal“ entdeckte, das ganz zerschnitzelt und verkritzelt war, gefiel ihm das sehr.
Als ich eintraf, lag auf seinem Schreibtisch ein' Briefgedicht an mich... Mochte es durch meinen Besuch damals irgendwie überholt seines ist nicht „überholt“ durch die vielen Jahre, die seither vergangen sind. Es begann so:
,ßereites Herz: und wenn ich Dich belüde,
nicht so, mit diesem Rohstoff meiner Not;
Du weißt es selber: Unrecht hat, wer müde
zum Leben steht und müder steht zum Tod.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!