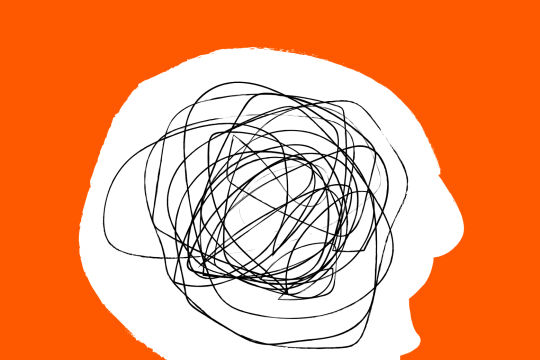Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Betreuen und nicht einfach „einsperren"
Vor fünf Monaten hat in Wien-Flo-ridsdorf die erste psychosoziale Station in der Bundeshauptstadt probeweise ihren Betrieb aufgenommen. Am 26. September wurde im niederösterreichischen Wiener Neudorf eine neue psy-cho-soziale Beratungsstelle eröffnet, die fünfte ihrer Art in Niederösterreich. Zwei weitere stehen vor der Eröffnung, eine befindet sich in Planung.
Diese Beratungs- und Betreuungstätigkeit ist mit der Widmung „gemeindenahe Psychiatrie" überschrieben. Es geht dabei um die nachgehende und nachbetreuende Behandlung der aus den psychiatrisch-neurologischen Krankenhäusern entlassenen Patienten, um deren Wiederaufnahme möglichst zu vermeiden.
Die österreichische Psychiatrie-Reform zielt insgesamt von der geschlossenen Anstalt zur gemeindenahen Psychiatrie, über die sich offizielle, halboffizielle und private Gruppen den Kopf zerbrechen: für mehr Menschlichkeit. Und daran mangelt es noch sehr.
95 Prozent der Patienten werden in Österreich zwangsweise in psychiatrische Anstalten eingeliefert. Demgegenüber sind es in Großbritannien nur zehn Prozent; dafür unterziehen sich dort 90 Prozent der Patienten freiwillig einer Behandlung.
Dazu kommt noch: In Österreich verlieren Patienten mit ihrer Einliefe-rung in eine psychiatrische Anstalt zumeist auch bald das Recht über eigenes Wollen und Dürfen - und das oft, trotz Gesundung, über Jahrzehnte hinweg.
Ein konkretes Beispiel: „Ich war 1946 als Kriegsheimkehrer in Behandlung, als ich mit dem Verlust von Familie, Haus und Beruf nicht fertigwerden konnte", schildert Heinz M. sein Schicksal.
„Dann war ich jahrelang im Ausland, habe dort den internationalen Führerschein gemacht und bin unfallfrei gefahren. Bei meiner Rückkehr nach Österreich", beschreibt er seinen Leidensweg weiter, „haben sie mir jedoch wegen der .Geisteskrankheit' 1946 den Führerschein entzogen." Er wurde ein Opfer der mit Akribie geführten polizeilichen Akten.
Zwar billigt das Datenschutzgesetz dem Staatsbürger Einsicht in die gehorteten Daten zu und ermöglicht es theoretisch auch, „unzutreffende" Eintragungen löschen zu lassen. Aber ein einmal behandelter Bürger bleibt für Akt und Amt bis zu seinem Lebensende als „Narr" abgestempelt.
Daher verlangen auch die Verfechter einer Humanisierung und einer Verbesserung der psychiatrischen Versorgung ein umfassendes Psychiatriegesetz, das den helfenden Aspekt herausstreicht, das Recht des Betroffenen auf ein menschenwürdiges Dasein inner- und außerhalb der Institutionen garantiert und die öffentliche Hand verpflichtet, für eine wirkungsvolle Betreuung zu sorgen.
Theoretisch müßte das auch eine Abkehr von den psychiatrischen Großkrankenhäusern bedeuten - in Wiens „Steinhof" gibt es noch immer rund 2400 angehaltene Patienten -, wobei dann beschleunigt ambulante Betreuungsstätten auszubauen sind: Tageskliniken etwa, Wohnheime, aber auch geschützte Werkstätten innerhalb kleiner, überschaubarer Gebiete.
In der Praxis spielt sich diese Vermenschlichung in den einzelnen Bundesländern sehr verschieden ab.
Neben den zu Beginn erwähnten Aktivitäten in Wien und Niederösterreich tut sich auch in Salzburg einiges. Universitätsprofessor Heimo Gastager von der Landesnervenklinik Salzburg hat daran (seit 18 Jahren übrigens) großen Anteil und ein klares Ziel vor Augen:
„Unser Ziel ist es, die Patienten auch in schweren Fällen nach zwei bis drei Jahren heimfähig zu machen. Dazu brauchen wir viel Zeit für den Kranken. Denn der Patient muß aus dem An-staltssyndrom heraus und mit Hilfe unserer Rehabilitationseinrichtungen seinen eigenen Sinn finden."
Gastager kennt keine „eingesperrten" Patienten, keine ehrfurchtsgebie-tenden „weißen Kittel". Er legt auch größten Wert auf einen guten Kontakt mit den Familienangehörigen des Kranken.
Denn: „Bei einer guten Information der Mitmenschen, die mit dem Kranken zusammenleben, können wir auftretenden Problemen frühzeitig begeg-nen.
Auch die Verbindung Anstalt -Heim hat sich in Salzburg bewährt: Jenen Patienten, die sich unsicher oder schlecht fühlen, steht jederzeit und unkompliziert der Weg ins Spital offen.
So unkompliziert in Salzburg vieles für die Patienten ist, so kompliziert gestaltet sich der Umgang mit offiziellen Stellen. Deshalb hatte Heimo Gastager auch Pech mit einer Tagesklinik:
„Diese Einrichtung für Patienten, die zu Hause schlafen und bei uns arbeitstherapeutisch versorgt werden, hätte sogar die Salzburger Gebietskrankenkasse bezahlt, doch wurde sie vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger zurückgepfiffen."
Aber nicht nur in diesem Bereich ist ein Umdenken notwendig. „Wir Eltern", umreißt Peter Sint, Vertreter der Angehörigenvereinigung „Hilfe für psychisch Kranke" (HPE), eines der wesentlichsten Probleme, „fühlen uns als Menschen zweiter Klasse, die nicht zur Kenntnis genommen werden."
Die Klage ist berechtigt. Kaum ein Arzt bezieht die Eltern in die Therapie ein, denn dafür zahlen die Kassen nichts. „Objekt" bleibt der Kranke, das ihn pflegende Familienmitglied zählt wenig, obwohl es oftmals die Hauptlast der Verantwortung trägt.
Allerdings: Administrativ sind all diese menschlichen Probleme nicht zu lösen. Und ohne Einbeziehung der Angehörigen kann aber eine Reform nie effektiv werden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!






























































































.jpg)