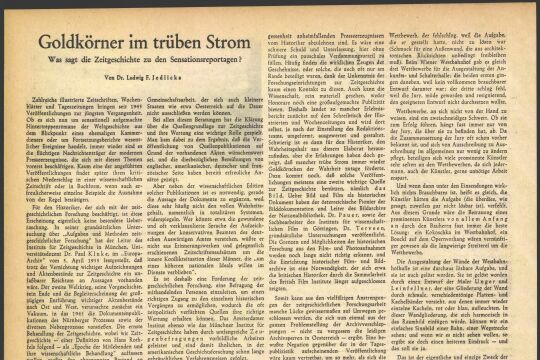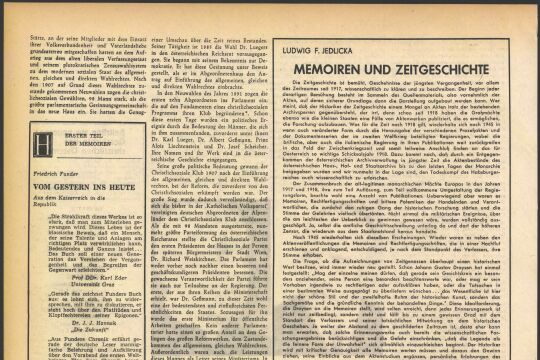Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Blockierte Forschung
Wenn sich ein Strobe Talbott („Time“) oder Christoph Bertram („Die Zeit“) hinsetzen, um über Abrüstung zu schreiben, oder wenn Andrė Fontaine („Le Monde“) ein Buch über den Kalten Krieg herausbringt, können sie sicher sein, auch aufmerksame akademische Leser zu finden. Solche Chronisten sind im wahrsten Sinne des Wortes Zeitgeschichtler, legen sie doch die ersten kohärenten Erklärungsversuche einer kürzlich abgeschlossenen oder noch abzuschließenden Epoche der unmittelbaren Vergangenheit vor.
Diese „erste Welle der Geschichtsschreibung“ ist meist für eine Generation gut. Die Ge-
Schichtswissenschaft kann die Ereignisse in der Regel erst 30 Jahre später von innen heraus eingehend beleuchten.
Warum erst 30 Jahre später?. Ganz einfach — in den meisten westlichen Demokratien werden die Akten frühestens 30 Jahre nach ihrer „Produktion“ für die Forschung zugänglich.
Im konkreten Falle führt dies dazu, daß zum Beispiel die amerikanische Geschichtswissenschaft der Öffentlichkeit bereits fundierte wissenschaftliche Werke zur Truman-Regierung (1945— 1952) vorlegen konnte. Seit zehn Jahren wird auch an einer massiven Revision des Eisenhower- Präsidentschafts-Bildes (1952 bis 1960) gearbeitet, natürlich gestützt auf die Aktenbestände.
Wie stellt sich die Situation für die Zeitgeschichtsforschung in Österreich dar? Man kann zwar in Washington, London und Paris die Akten zur österreichischen Besatzungszeit einsehen. Da in Wien die Akten aber erst nach 40 Jahren geöffnet werden, sind für den Historiker über 1947 hinaus keine Akten zugänglich.
Tatsächlich ist auch nur ein Teil der Akten des Außenministeriums bis zum Jahre 1947 schon offen, und die Protokolle des Mini sterrates der Nachkriegsepoche nur für auserlesene Forscher für die unmittelbare Nachkriegsepoche. Auch bei Nachlässen wird nicht für alle Forscher — ob jung oder alt, bekannt oder obskur — mit gleichem Maß gemessen. Manche „kommen hinein“, manche nicht (ein Schreiben von höherer Stelle erleichtert angeblich den Zugang).
Traut man von politischer Seite der österreichischen Geschichtswissenschaft nicht über den Weg? Jedenfalls sitzt man in der Alpenrepublik zehn Jahre länger auf den Akten. Hat man in der österreichischen Öffentlichkeit nicht das Recht, gleich anderen westlichen Demokratien, zu wissen „was die Regierenden treiben“ („to know what the government is up to“)? Diesen Grundsatz amerikanischer Archivpolitik vertrat vor kurzem Robert Wolfe, ein hochgestellter Archivar am Washingtoner J^ationalarchiv“, in einer Diskussion über die Archivsituation für Zeitgeschichtler in Österreich beim kürzlich in Wien veranstalteten Symposium
„Österreich 1945-1949, Die bevor- mundeteNation“.
Wolfe skizzierte in einem eindrucksvollen Referat die gewaltige Fülle von Akten, die im Lauf der amerikanischen Besatzung (1945 bis 1955) in Österreich produziert wurden und für die Forschung offen in amerikanischen Archiven liegen.
In Hunderten von Boxen können künftige Generationen von Dissertanten und Forschem amerikanische Osterreichpolitik im Detail studieren. Da die Besatzungsmächte jeden Aspekt des Lebens mitbestimmten, kann die Nachkriegsgeschichte nur mit Hilfe dieser ausländischen Archive geschrieben werden. Mit wenigen Ausnahmen wurde sie bisher beinahe ausschließlich aus diesen Beständen bearbeitet.
Will man aber zeigen, daß die Österreicher nicht immer von den Besatzern gegängelt wurden, soll Österreich nicht nür als Objekt, sondern auch als Handelnder in der internationalen Politik dieser Jahre zur Kenntnis genommen werden, dann müßte die For schung eben auch die Entscheidungsabläufe am Wiener Ballhausplatz studieren können. Sonst besteht die Gefahr, daß sich ein schiefes Bild unserer Nachkriegsgeschichte verfestigt.
Immerhin ist es der österreichischen Politik, ganz im Gegenteil zu anderen Schauplätzen des Kalten Krieges, gelungen, die Besatzungsmächte loszuwerden. Was gibt es da zu verbergen? Fürchtet man Leichen im Keller? Die bei der erwähnten Diskussion anwesenden Archivare boten verschiedene Erklärungen für die Zugangsprobleme an.
Der Generaldirektor des Staatsarchivs Kurt Peball referierte penibel genau über die gesetzlichen Richtlinien, die dem Archivar gegeben sind, um den Archivzugang zu regulieren. Es gibt da so genaue Vorschriften über die „Berechtigung zur Einsichtnahme“, daß im Endeffekt nur ausgewiesene Wissenschaftler die Aktenkartons in die Finger kriegen. Es scheint keinem Österreicher „von der Straße“ gestattet zu sein, ins Archiv zu marschieren, wie etwa dem amerikanischen Bürger, „to see what the government is up to“. Hier wird auch ein Licht aufs österreichische Demokratieverständnis geworfen!
Der Innsbrucker Historiker Klaus Eisterer kommentierte, die Forschung sei also beim Zugang auf einen „Gnadenäkt“ der Regierenden angewiesen. Er meinte, es wäre an der Zeit, sich in Österreich von dieser feudalistischen Mentalität zu trennen.
Walter Dohr von der Datenschutzabteilung im Bundeskanzleramt erklärte die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, die sich bekanntlich seit ihrem Inkrafttreten ebenfalls sehr negativ auf den Zugang zu den historischen Dokumenten auswirkten. Dohr konstatierte, der Datenschutz treffe auf tote Personen nicht zu. Wolfe und Peball meinten, solche Unterscheidungen könnten in der Praxis nicht gemacht werden.
Die Archivare Christina Thomas und Horst Brettner-Messler verwiesen auf akuten Personalmangel und Budgetknappheit, die dem Beamten im Archivalltag immense Probleme aufbürden.
So sind im Archiv der Republik nur drei Beamte für die Archivierung von 7.000 Kartons der Zeit von 1945 bis 1960 verfügbar. Natürlich müssen im Interesse staatlicher Sicherheit alle Akten vor ihrer Freigabe noch in den Ministerien gesichtet werden (so wird es auch in den anderen westlichen Archiven gehandhabt).
Diese technischen Probleme werden von den Archivbenüt- zera bestimmt zuwenig gesehen. Hier hat die Diskussion zwischen Archivaren und Forschem Brük-
ken geschlagen. Der Grazer Historiker Siegfried Beer stellte dann auch fest, nur die Zusammenarbeit und nicht das gegenseitige Mißtrauen könne eine verbesserte Situation schaffen.
Am Schluß wurde der Ruf nach einem einheitlichen Archivgesetz laut, das den Zugang ohne Ausnahmen für alle Benützer gleich regelt. Es müßten also doch die Politiker mit der Problematik befaßt werden. Die fühlen sich aber mit geschlossenen Akten am sichersten, denn da kann ihnen zu Lebzeiten niemand nachträglich auf die Finger schauen.
Der Archivzugang ist aber gerade jetzt eminent wichtig, wird doch die Zeitgeschichtsforschung öfters mangelnder Wissenschaftlichkeit angeklagt, wird ihr doch manchmal gar „denunziatori- sches Interesse“ vorgeworfen. Wie aber soll die Zeitgeschichte wissenschaftlich akzeptabel sein, wenn ihr die Akten nicht zugänglich sind?
Wenn die Öffentlichkeit von der Zeitgeschichte solide Antworten auf vielfältige Fragen der jüngeren Vergangenheit verlangt, muß der Aktenzugang so freizügig wie in den westlichen Hauptstädten geregelt werden. Anderenfalls wird man in Österreich zum Beispiel weiterhin auf aktengestützte wissenschaftliche Monographien zur Figl- und Raab-Epoche warten müssen. ,
Der Autor betrieb Archivstudien in Washington. London, Paris, Bonn und Wien für seine Harvard-Dissertation „Österreich in der internationalen Politik 1S45-1955“.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!