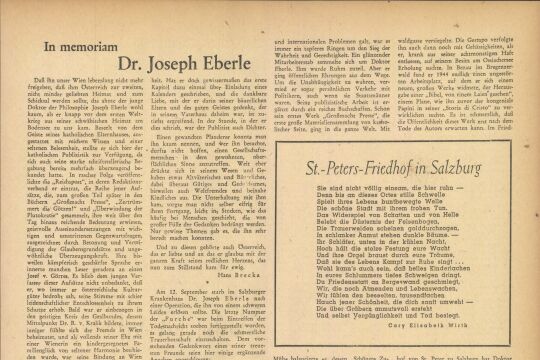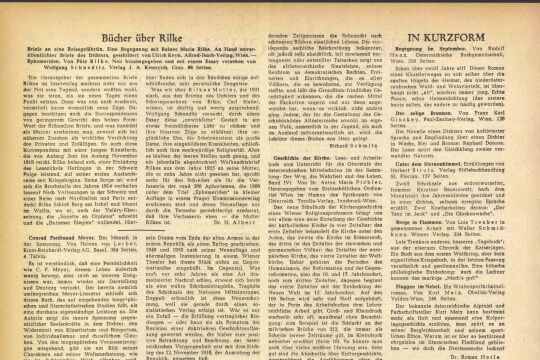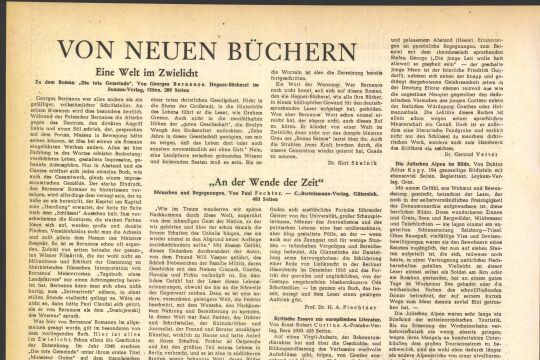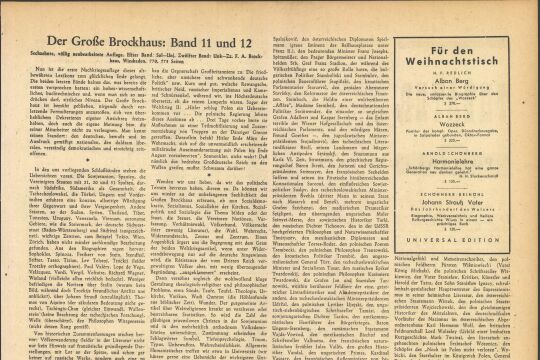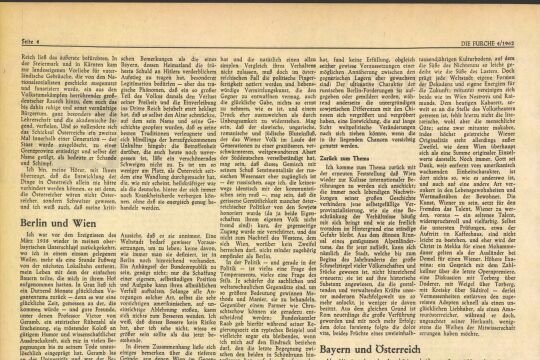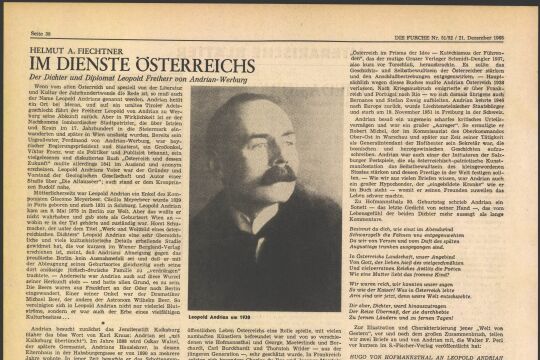Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Briefe eines unbegabten Journalisten
Traugott entdeckte nun, daß sich die relativ stärksten Persönlichkeiten auch am relativ unbefangensten äußern, während gerade jene, die sich am abhängigsten erweisen, durch ihr Verhalten zu erkennen geben, daß sie diese Zusammenhänge nach aller Möglichkeit zu verwischen trachten.
Die Umfragen in der Bundesrepu-' blik Deutschland erreichten im Jahre 1964, dem ersten Kanzlerjahr Erhards, den großen Durchbruch in das öffentliche Bewußtsein, der sich auch in der Sprungkraft zunehmender Pressezitate äußerte. Die Bundestagswahlen vom Herbst 1969, die zur Ablösung der Großen Koalition durch eine sozial-liberale Koalition führte, brachten dann den bisherigen Höhepunkt auf dem Gebiet der Umfragen. Mit dem größer werdenden politischen Gewicht der Umfragen ging in den letzten zehn Jahren auch ihre technische und wissenschaftliche Entwicklung einher.
Traugott beschäftigt sich ferner mit der Geschichte und dem Wissenschaftsgrad der Meinungsforschung, der Kommunikationswissenschaft, die eine Teildisziplin der Sozial- wissenschaft darstellt. Ohne den Wissenschaftscharakter anzuzweifeln, weist der Autor auf die vielen Fehlerquellen hin, die beispielsweise Umfragen oder Interviews innewohnen. Das Wichtigste an den Meinungsumfragen aber bleibt die Wirkung, die sie ausüben. Von den zahlreichen Beispielen, die das Buch enthält, seien einige angeführt. Im Jahre 1964 wurde nach dem Vorbild von Klassenzeugnissen die Einschätzung der deutschen Spitzenpolitiker erfragt. Die Note „sehr gut“ erhielten Erhard 36, Adenauer 35, Brandt 21, Schröder 14, Wehner 4 und Strauß dreimal. „Ungenügend“ erhielten Erhard 1, Adenauer 2, Brandt 4, Schröder 1, Wehner 3 und Strauß 25mal. Die Einschätzung von
Daß die großen Exponenten der „hohen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts“ weniger honoris als honoraris causa ein oft mauerblümchenartiges Dasein in den Gazetten so mancher Blätter führten, mag die Nachwelt von der Relativität allen Ruhmes überzeugen. Ein Stück persönliche Tragik offenbaren die jetzt von zwei tschechischen Germanisten herausgegebenen Briefe Robert Musils an den Chefredakteur der Prager Presse Ame Laurin.
Dabei hatte es Musil dem Genius des Intellektuellen Laurin, den er aus der gemeinsamen Arbeit im österreichischen Kriegspressequartier kannte, zu verdanken, daß er sich eine bittere Zeit hindurch über Wasser halten konnte. Musil war in Österreich unbekannt. Die „Neue Freie Presse“ war von zeitgenössischen Genies blockiert, der Schmock triumphierte, Musil hungerte. Ein österreichisches Schicksal. Die Szene war schon 1918 makaber genug. Als der Krieg längst zu Ende war, war auch die Auflösung eingefahrener Institutionen keine Selbstverständlichkeit. Auch für den 1917 geadelten Robert von Musil nicht. In diesem Zusammenhang berichtete Otten über Robert Musil: „Manchmal sagte Musil — es war gegen Ende des Jahres 1918 — er gehe jetzt ins Kriegsministerium. Als ich ihn fragte, was er denn da noch mache, erwiderte er gelassen zynisch „Ich löse auf“. Dieses gelassen-zynische „Ich löse auf“ wurde zur Permanenz einer Lebenssituation erhoben. Nirgendwo noch hat man mit soviel
Gelassenheit aufgelöst. Und es ist sehr die Frage, ob dieser Prozeß bereits beendet ist. Aber selbst ein kritischer Denker wie Musil war dem Zauber der -österreichischen Art, sterben zu können, verfallen. Die österreichische Kultur scheint ihr letztes „Fascinosum“ gerade in der Noblesse der Resignation zu verstrahlen. Ein sanfter kaka- nischer Himmel beginnt zu leuchten. Musil notiert im Tagebuch: „Das Leben ist da nicht so verbaut, man sieht den Himmel, und hat Raum und Zeit. Man fühlt sich tiefer in diesem Land leben als im Reich. Und der Mensch hat, selbst in Wien noch, etwas vom Stifterschen Menschen in sich und mehr vom russischen als der deutsche.“
Zunächst fühlte man sich jedoch tiefer im Reich leben, als sonst wo, und wollte dessen Wonnen auskosten. Inzwischen beschrieb Musil im Exil den Untergang einer Welt, nicht ohne die kommende begreifen zu wollen. Er begriff sie auch schon, als er noch Leiter des Kriegspressequartiers war, das zur Aufrechterhaltung patriotischer Gesinnung die literarische Intelligenz der Monarchie, unter anderen Šramek, Blei, Gütersloh, Egon Erwin Kisch, Otto Pick und Franz Werfel versammelte. Die Noblesse, die Musil dem Anarchisten Laurin gegenüber bewies, indem er ihn zu keinerlei Übereifer in Sachen Patriotismus zwang, zeigt die Überlegenheit des Menschen Musil. So konnte der Autor auf die Freundschaft und Ergebenheit des späteren Chefredakteurs der Prager Presse zählen. Keine andere Zeitung druckte Musil damals, wobei Musils Eigenschaften als Journalist sicher nicht die besten waren. Mit Recht konnte Ea von Allesch an Laurin schreiben: „Wie kamen Sie auf den Einfall, Musil als Kritiker und Polgar als Skizzenmitarbeiter zu engagieren oder umgekehrt? Zur Kritik gehört Witz als erstes und Routine als zweites und als drittes, Gewohnheit, rasch zu arbeiten. Alle drei Punkte treffen bei Polgar zusammen und fehlen bei Musil, und Musil kommt als langsamer Arbeiter für andere Sachen doch auf ein viel höheres Niveau als als Kritiker.“
Zweifellos berühren diese Punkte die Schwierigkeiten, die Musil mit der Zeitung hatte, weshalb er später auch jede Mitarbeit bei Zeitungen einstellte, um sich ganz der Arbeit an seinem Roman zu widmen. Dennoch ist es vom heutigen Standpunkt aus gesehen interessant, wie weit es möglich war, Beiträge vom Niveau Musilscher Prosa zu veröffentlichen. Denn Musil nahm seine Arbeit bei der Prager Presse, wie die Briefe an Laurin zeigen, die neben Urgenzen, überfällige Honorare betreffend, auch inhaltliche Hinweise geben, durchaus ernst. Kulturchroniken umfangreichen Ausmaßes, die philosophische und naturwissenschaftliche Standpunkte berücksichtigen, wären für heutige Zeitungen Monstren, jedes auch noch so seriöse Blatt würde sie wohlwollend an Jahrbücher weiterleiten, auf daß sie an Bibliotheksregalen der Verschimmelung entgegenreiften.
Die Prager Presse hat also lange Zeit hindurch mit ihrem Chefredakteur Arne Laurin ihre Schuldigkeit an Musil getan. Musil, der in der Literaturwissenschaft so aktuell ist wie niemals zuvor, wäre in den Briefen als Mensch zu entdecken. Ein Mensch, der, zeitgenössischen Schilderungen gemäß, kalt und distanziert gewesen sei. Das, was in diesen Briefen und zwischen deren Zeilen steht, mag dazu geeignet sein, dieses Urteil etwas zu revidieren. Denn Charme und Witz haben wohl nur dann Gewicht, wenn sie mit einer gewissen Großzügigkeit über das eigene Unglück hinweggehen können, ohne allerdings die Härten desselben nicht voll und ganz zu spüren.
BRIEFE NACH PRAG. Von Robert Musil. Herausgegeben von Barbara Köpplovä und Kurt Krolop. Verlag Rowohlt. 135 Seiten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!