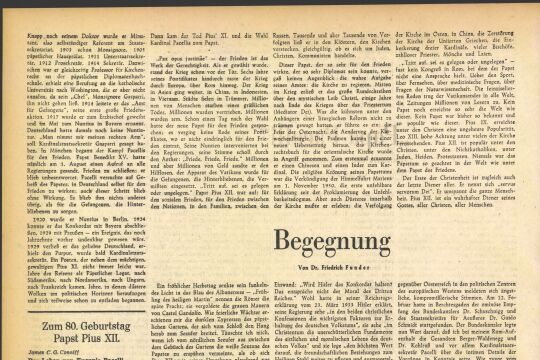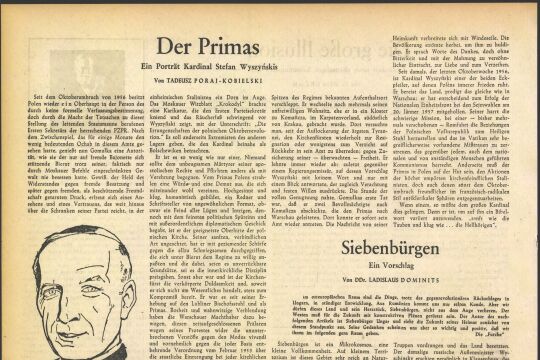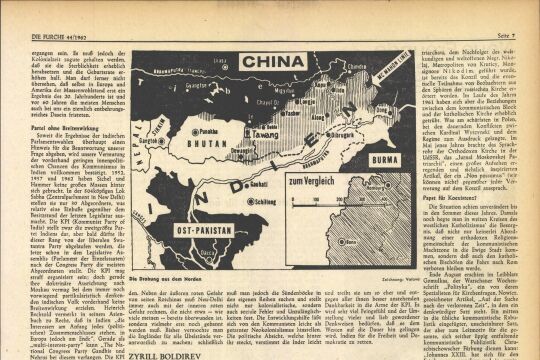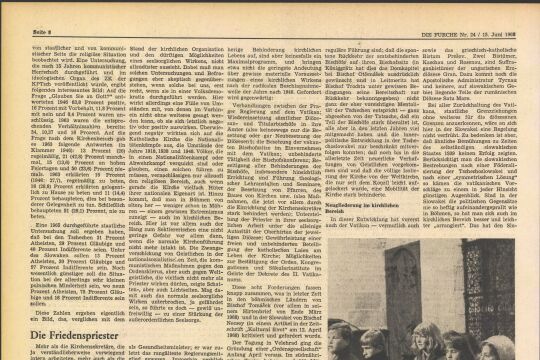Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Brücke über siebzig Jahre
Entkrampft präsentiert sich zur Zeit das Klima zwischen dem Vatikan und Moskaus roten Zaren. Die Tausendjahrfeier des orthodoxen Christentums machte es möglich. Eine Sternstunde vatikanischer Ostpolitik: Casarolis Rede im Moskauer Bolschoi-Theater.
Entkrampft präsentiert sich zur Zeit das Klima zwischen dem Vatikan und Moskaus roten Zaren. Die Tausendjahrfeier des orthodoxen Christentums machte es möglich. Eine Sternstunde vatikanischer Ostpolitik: Casarolis Rede im Moskauer Bolschoi-Theater.
Wo alte, auch sprachlose Feindseligkeit schwindet, wiegt jedes freundliche Wort. So kann jetzt der päpstliche Chefdiplomat Kardinal Agostino Casaroli das Ergebnis seiner Moskaureise vom Juni rückblickend und vorausschauend als „Brücke über siebzig Jahre Geschichte“, ja als Anlaß „großer Hoffnung“ bezeichnen.
Und dies durchaus im Sinne des polnischen Pontifex, dem noch vor zehn Jahren, kurz bevor er Papst wurde, kaum jemand zugetraut hätte, daß er sich die „vatikanische Ostpolitik“ Casarolis zueigen machen und diesen zum Staatssekretär befördern würde.
Während sich der Kardinal gleichwohl zur „behutsamen Nüchternheit älterer Leute“ bekennt, überraschte der Papst sowjetische Journalisten, die ihn am 30. Juni besuchten, sogar mit der Feststellung, daß der sowjetische Demokratisierungsprozeß „auch der katholischen Soziallehre entspricht“.
Ähnliches bekam am 12. Juli Ni-kolaj Lunkow zu hören, der als erster Sowjetbotschafter in Rom offiziell um Papstaudienz ersucht hatte. Im Auftrag Michail Gorbatschows informierte Linkow über die Moskauer Parteikonferenz, posierte mit dem lächelnden Pontifex für ein Foto und bekam eine Goldmedaille.
Jedoch in dem Punkt, der den Papst am meisten interessiert hätte, hinterließ der Botschafter nur diskrete Andeutungen: Aufmerksam und wohlwollend studiere man noch immer den Brief des Papstes, den Casaroli vier Wochen vorher, am 13. Juni, dem Parteichef im Kreml überreicht hatte.
Die Antwort wird noch auf sich warten lassen. Denn beigelegt war dem offenherzigen, menschlich entgegenkommenden Schreiben ein dreißigseitiges, im Vatikan wochenlang ausgearbeitetes Memorandum, in dem alle Probleme und Beschwerden der Katholiken in der Sowjetunion ausgebreitet werden.
Daß dieses Papier vom Kreml überhaupt zur Kenntnis genommen wird, bedeutet fast schon eine historische Wende. Seit 1927 in Berlin die letzten Geheimgespräche zwischen Stalins Botschafter Krestinski und Nuntius Pacelli (dem späteren Pius XII.) abgebrochen worden waren, hatte der Sowjetstaat dem Vatikan — als „ausländischer Macht“ — jedes
Gespräch über die Lage der sowjetischen Katholiken — als „Einmischung in innere Angelegenheiten“ — verweigert.
Dabei blieb es im Prinzip, wenn auch gemildert durch kleine Zugeständnisse, als in den sechziger Jahren wieder Kontakte entstanden, als Außenminister Andrej Gromyko fünfmal (zuletzt 1979) den Vatikan besuchte und Casaroli — unter dem Vorwand, den Atomsperrvertrag für den Vatikanstaat zu unterzeichnen — 1971 nach Moskau reiste. Erst jetzt nach 17 Jahren bot die Tausendjahrfeier des orthodoxen Christentums, im Klima der Perestrojka, eine neue Chance.
Der Papst nutzte sie, indem er Casaroli mit zehn Kardinälen aus aller Welt nach Moskau schickte — nicht nur, um die Bruderkirche des Moskauer Patriarchats zu ehren, sondern um zugleich die eigene Sache voranzubringen.
Leichte Verlegenheit war den sowjetischen Kirchenfunktionären, die Casaroli empfingen, anzumerken. Termin und Umstände seines Gesprächs mit Gorbatschow blieben tagelang im Ungewissen; daß Casaroli nicht nur als Briefträger des Papstes Höflichkeiten zu übermitteln hatte, war ihnen klar. Das letzte Eis brach aber erst die Ansprache des Kardinals beim Festakt im Bolschoi-Theater — ein von den Medien kaum beachtetes diplomatisches Meisterstück.
In die Rumpelkammer
Nicht so sehr an die orthodoxen Brüder wandte sich der Kardinalstaatssekretär (das besorgte sein holländischer Kollege Jan Willebrands vom Sekretariat für Christliche Einheit), sondern ah die atheistischen Staatsvertreter: Es sei „natürlich“, daß sie als „Phänomen“ das Christentum ganz anders beurteilen als die Gläubigen, für die eben „der Gründer des Christentums nicht nur ein gewisser Jesus ist, der starb und von dem seine Jünger behaupten, daß er noch lebt“ — so zitierte Casaroli aus der Apostelgeschichte den römischen Statthalter Festus und machte deutlich, daß das Problem nicht erst seit Marx und Lenin besteht.
Doch so wie der Historiker dem „Faktum Religion“ nicht ausweichen könne, müsse sich ihm auch der Politiker stellen: „Der Realismus des Staatsmanns erfordert es, und die Achtung vor dem Menschen gebietet es.“
Geschickt, ohne direkt davon zu sprechen, verwies Casaroli ideologische Monopolansprüche des Staates in die historische Rumpelkammer: Die moderne Welt sei abgerückt vom alten Grundsatz „Cuius regio eius religio“ (wonach der Landesfürst den Glauben seiner Untertanen zu bestimmen hatte).
Zwar „unsicher noch und skeptisch nach früheren Erfahrungen“, doch aufmerksam betrachte die Welt jetzt bei der Tausendjahrfeier in Moskau die Anerkennung der kirchlichen Rolle „in der Gesellschaft, die aus der Oktoberrevolution hervorgegangen ist“. Eben dies lasse hoffen, daß „ein neuer Atem die gesamten Beziehungen des Sowjetstaates zur Religion im allgemeinen beleben wird“, schloß Casaroli und - zitierte Gorbatschows Ankündigung, die Religionsgesetzgebung zu ändern.
Noch ist nicht viel Konkretes geschehen, auch wenn der Moskauer Kirchenminister Konstantin Chartschew drei Tage nach Casarolis Treffen mit Gorbatschow von „revolutionären Veränderungen“ der Religionspolitik sprach; zugleich beklagte er sich, daß der Vatikan die sowjetischen Grenzen im Baltikum nicht anerkenne. Gerade dort, im katholischen Litauen, wird die Wende auf die Probe gestellt werden.
Als positive Vorzeichen könnte man werten, daß der Papst schon Ende April einen 19 Jahre lang amtsbehinderten Oberhirten, Vincentas Sladkevicius, zum neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz ernennen konnte — ohne Moskau zu fragen und ohne Proteste zu ernten. Verunsicherte, Perestrojka-geschädigte Funktionäre verschluckten ihren Grimm — wohl auch Minister Chartschew, der noch vor Monaten gedroht hatte, er lasse in Litauen „keine polnischen Verhältnisse“ einreißen.
Bewegung ist sogar in der
Tschechoslowakei entstanden, wo der Blick auch in der Kirchenpolitik stets folgsam nach Osten gerichtet ist. Genau in den Tagen, in denen Casaroli in Moskau auftrat, konnte der päpstliche Sondernuntius Colasuonno nach 13 Jahren erfolgloser Verhandlungen zwei Weihbischöfe in Prag (als Stütze für den fast 90jährigen Kardinal Frantisek Tomasek) und einen im slowakischen Trna-va einsetzen; keiner von ihnen steht der vom Regime gelenkten Priesterbewegung „Pacem in ter-ris“ nahe, auf deren Kandidaten der Kirchenminister Vladimir Janku lange beharrt hatte. Seit 600.000 tschechoslowakische Katholiken mit ihrer Unterschrift den Staat aufgefordert hatten, den Druck von ihrer Kirche zu nehmen, und am Karfreitag in Preßburg die Polizei mit Knüppeln und Wasserwerfern über stumm demonstrierende Gläubige hergefallen war, trat das Regime zögernd den Rückzug an.
Ministerpräsident Lubomir Strougal gab „Fehler“ in der Kirchenpolitik zu und tadelte Ende Juni sogar die Polizei.
„Die Pertstrojka gilt auch für uns“, beteuerte der bislang so verbissene Kirchenminister Janku in München und Bonn, wohin er Anfang Juli plötzlich eine Werbereise unternahm. Erika Kadlecova, die im „Prager Frühling“ vor 20 Jahren Jankus Posten bekleidet hatte, meldete sich in Rom zu Wort: Was der katholischen Kirche in der CSSR zugefügt wurde, sei „eine Schande für den Staat und den Sozialismus“, schrieb sie in der „Unitä“, dem Organ der italienischen Kommunisten: „Heute kämpfen revolutionäre Marxisten für die Gewissensfreiheit, die Karten werden neu gemischt.“
Papst nach Budapest?
Dies eben bleibt die offene Frage selbst dort, wo — wie etwa in Ungarn — das sowjetische Modell in der Religionspolitik nur teilweise nachgeahmt wurde. „Haben Sie keine Angst vor uns!“, rief Kardinal Läszlö Paskai, der ungarische Primas, dem neuen Partei- und Regierungschef Käroly Grösz im Budapester Parlament zu.
Paskai will im Einvernehmen mit einem toleranten Regime seine Kirche aus der gesellschaftlichen Isolierung herausführen. Offen wünscht er dazu einen Besuch des Papstes; diesen einzuladen, sei Ungarn „seiner Würde schuldig“, schrieb nach der Begegnung des Papstes mit Ungarn im Burgenland das nichtkirchliche Frauenblatt „Nök lapja“.
Ob man das „Opium des Volkes“ ganz freigeben soll, bleibt jedoch unter regierenden Kommunisten noch umstritten. Sie befürworten, was Christen erhoffen: keine Entwöhnung von der Religion, sondern ihre Stärkung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!