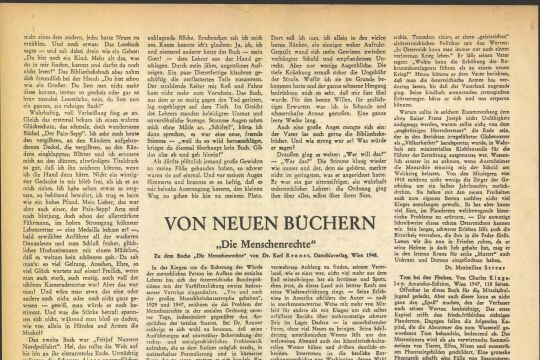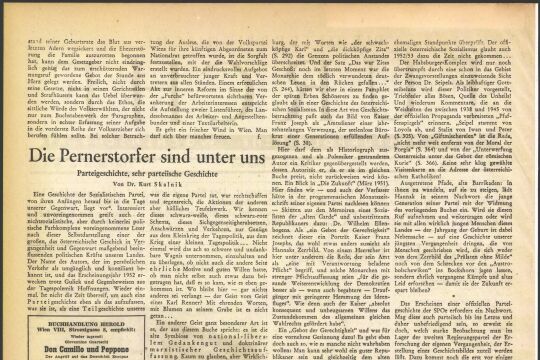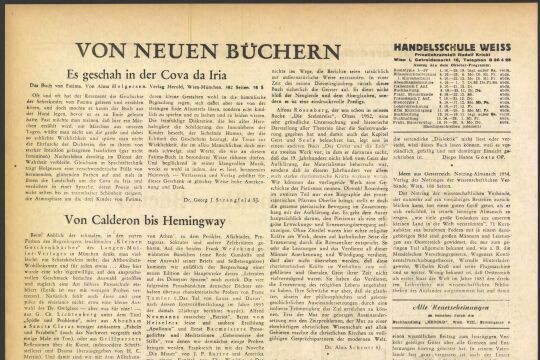Biographien sind immer ein Wagnis. Dieses wird um so größer, wenn der, von dem die Biographen berichten, noch lebt und auf seine Umwelt einwirkt, diese womöglich andauernd verändert. Doch am größten wird dieses Wagnis, wenn es sich um eine komplizierte, nuancenreiche und zudem politische Persönlichkeit handelt, von der sich der mangelnden zeitlichen Distanz wegen noch gar nicht sagen läßt, ob und wann sie ihre Möglichkeiten voll ausschöpfte oder diese überschätzte, ob der Höhepunkt ihres Wirkens schon gekommen ist, ob es mit ihr weiterhin bergauf oder nicht vielleicht schon bergab geht und ob es schließlich in rückblickender Betrachtung überhaupt ein Bergauf oder Bergab gegeben hat.
Bruno Kreisky ist so eine charakterlich und politisch reich facettierte Persönlichkeit, schwierig zu erfassen nicht nur für frühzeitige Biographen. Sein Wirken fällt zudem in eine Zeit, über welche sich ein auch nur annähernd gerechtes Urteil noch nicht fällen läßt. Ein biographisch beinahe unlösbarer Fall also.
Das mag den Autoren Karl Heinz Ritschel, Paul Lendvai und Viktor Reimann und auch deren Verlegern Zsolnay/Econ und Molden vor Augen gestanden sein. Obschon die beiden vorgelegten Kreisky-Bücher, um die sich drei Autoren und drei Verleger bemühten, ganz im Stile von Biographien, allenfalls im Stile biographischer Essays gehalten sind, gab man ihnen den vorsichtigeren Untertitel — „Porträt eines Staatsmannes“, beziehungsweise Molden sogar „Das Porträt eines Staatsmannes“. Den Wettlauf zum Büchermarkt, der durch eine schier unglaubliche Anzahl von Vorabdrucken — vor allem in der sogenannten bürgerlich-unabhängigen Presse — aufbereitet worden war, gewannen Zsolnay/Econ um Nasenlänge, der Absatz ist, wenn man auf die Fanfarenstöße der Verlagswerbung hört, reißend. Kreisky ist nicht nur ganz groß im politischen Geschäft, er eignet sich auch für Geschäfte...
Das mit dem „Porträt“ stimmt auf eine delikate Weise. Beim Lesen nehmen die drei Autoren tatsächlich oft die Rolle von Porträtisten an, denen Kreisky Modell saß. Das bringt oft über lange Strecken der Bücher nicht nur, was ja in der Natur der Sache läge, eine vollkommene Übereinstimmung von Tat-
Sachen, sondern auch eine der stilistischen Schilderungen. So, als habe Kreisky allen dreien lange Passagen zur gleichen Zeit in die Feder diktiert,
Ritschel, Lendvai und Reimann sind gleichermaßen als Journalisten tätig: Ritschel als Chefredakteur der bürgerlich-konservativen „Salzburger Nachrichten“, Lendvai als Auslandkorrespondent hochangesehener britischer und Schweizer Zeitungen, Reimann als Chefredakteur der oberösterreichischen Ausgabe der .JCronen-Zeitung“ und auch als politischer Kolumnist in deren Gesamtausgabe. Sie kommen, was man indessen nur bei Lendvai errät, aus sehr unterschiedlichen politischen Lagern. Ritschel aus dem konservativ-katholischen, Lendvai, der vor Jahren aus Ungarn emigrierte, ist das, was ich einen „freischwebenden“ Linken nennen möchte, und Reimann war einer der ersten Mitbegründer des VdU und einige Zeit dessen brillanter Abgeordneter, der sich späterhin jedoch, als aus dem VdU die FPÖ wurde, von dieser abwandte; er ist gleichermaßen Kulturpolitiker und Historiker, und gäbe es einen politisch aktiven Liberalismus in Österreich, möchte ich ihn einen Liberalen nennen.
Um so erstaunlicher, daß drei so verschieden geformte Persönlichkeiten in nahezu deckungsgleicher Weise auf die von Kreisky zweifellos ausgehende Faszination reagierten. Das mag zugleich ein symbolischer Hinweis auf Kreiskys „politische Umfeldwirkung“ sein, die weit über Sozialismus und Sozialdemokratie hinausreicht.
Wie stark diese Faszination gewesen sein imuß, wird bei Ritschel am deutlichsten. „Von Bruno Kreisky“, notiert er, „geht eine Faszination aus wie von einer attraktiven Frau; sie muß nicht schön sein, man dreht sich doch nach ihr uim“. In so schwärmerischer Betrachtung kommt immer wieder die Wortstanze „Faszination“ vor oder der Hinweis auf den „großen Zauberer“, vom „brillanten Intellekt“ ist ebenso wiederholt die Rede wie von dessen „ungeheurer Ausstrahlung“. Im Anschauen von so Erhabenem unterbleibt die „kritische Würdigung“. Die Autoren sprechen für Kreisky, Kreisky spricht für sich und am Ende ist alles gut.
Dadurch entsteht — am stärksten bei Ritschel, etwas abgeschwächt bei Reimann und noch am wenigsten bei Lendvai — im Leser der Eindruck, Kreisky sei die SPÖ, sei so etwas wie deren allen gemeinsamer „geistiger Uberbau“, der ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht dieser doch sehr differenzierten und auch innerlich diff erenten Partei.
Dieser Eindruck mag dem Porträtierten nicht immer recht sein — und in der Tat weicht er von dem, was Kreisky wirklich und vor allem ist, einigermaßen ab: Kreisky nämlich ist Sozialist, oder wenn man will, Sozialdemokrat! Das mit dem Überbau verhält sich also umgekehrt...
Das liebevoll gemalte Bild vom bürgerlichen, industriellen, liberalen Typus gibt nur die äußerliche Erscheinung wieder; vor allem dann, wenn man sich unter einem Sozialisten nur einen Ballonmützenträger vorstellen kann. Längst, so wissen wir, sind die Sozialisten „salonfähig“ geworden und mit ihnen — österreichische und im Umfeld veranstaltete Wahlen beweisen das — auch der Sozialismus.
Man würde in der Tat Kreisky Unrecht tun, wollte man ihn zu einem bloßen „Schein-“ oder „Zufalls-Sozialisten“ verfremden, ihm einen bloß „sozialisierten Humanismus“ zumuten, der einer völlig undogmatischen träumerischen Vision von sozialer Gerechtigkeit folgt. Mag sein, daß er in sehr jungen Jahren so war. Sehr bald aber — das erfährt man am besten, wenn man der Rei-mannschen Schilderung folgt — wird er zu einem in der Wolle echten Sozialdemokraten mit deutlichen revolutionären Ideen. Er würde auch heute nichts davon preisgeben, nicht einmal um eines taktischen Vorteiles willen. Und er braucht das auch gar nicht zu tun. Sein Äußeres, seine ungemein anpassungsfähige Sprechweise, sein bonhommer Lebensstil enthebt ihn der Sorge, Nichtsoziali-sten etwa als Bürgerschreck zu erscheinen. Doch besagt das nichts bezüglich der Qualität seiner Gedanken und seiner Politik; beide sind durchaus sozialistische, auf sozialdemokratische Weise.
Die Formel vom „Großen Zauberer“, die entweder in dieser direkten Form oder zart umschrieben in den drei biographischen Schriften immer wiederkehrt, ist nicht ungefährlich. Sie ruft die Assoziation hervor, Kreisky pflege einen heimlichen Verkehr mit übersinnlichen Kräften, denen er ihre besonderen Geheimnisse ablauscht oder abringt — ein übermäßig romantisches Bild. Tatsächlich handelt es sich bei ihm um einen feinen Instinkt, der ihn befähigt, wo andere noch ganz intakte Fassaden erblicken, diese bereits abfallen zu sehen — und dementsprechend reagiert er, den meisten seiner Freunde und Gegner darin um ein gutes Stück voraus. Das Bild vom „Großen Zauberer“ hingegen, das weit verbreitet ist, bewirkt eine Lähmung der politischen Gegner, er wird zum „Angstgegner“, vor dem die eigene Kunst, was immer man darunter auch verstehen mag, versagt. Wunsch und Hoffnung steigen auf, auch einmal einen solchen Zauberer zu haben („Raab konnte das auch“!) und alles wäre wieder „gut“. Solche offenbaren oder insgeheimen Vorstellungen sind dem demokratischen Widerspiel von These und Antithese höchst abträglich, indem sie nämlich dem einen einen zusätzlichen Vorteil verschaffen, setzen sie die anderen sogar in deren eigener Vorstellung unmäßig weit zurück. Ungesunde Resignation oder überkompensierte Aggression sind die zwangsläufige, aber unerwünschte Folge. So wird Opposition zur Tragödie, nicht selten zur Tragikomödie! Am besten weiß das wohl Kreisky selbst.
Ohne Zweifel gesteht man Kreisky gerne zu, was besonders Reimann und Lendvai anklingen lassen: eine liberale Bereitwilligkeit zu Gesprächen und die Bereitschaft, auch ariderer Leute Ideen gelten zu lassen. Doch was an ihm wie Anpassung anmutet ist in der Regel geschickte Taktik. Man erfährt dies, wenn man liest, daß er „politische Forderungen“ nur zu einem Minimum zum Faktum macht, dieses aber dann entweder durch nachfolgende Gesetze oder neue, ausweitende Fakten maximal ausbaut (gemäß der normativen Kraft des Faktischen). Darin ist nichts vom vielbemühten Pragmatismus, aber sehr viel von der Theorie der „Zwangsläufigkeit der Entwicklung“ und von Kreiskys von Lassalle entlehntem „Revolutionsbegriffe“, nach welchem „Umwälzungen“ auf sehr verschiedene Art und nur selten durch praktische Gewalt herbeigeführt werden können.
Natürlich benötigen solche „Spielregeln“ eines gewiegten Taktikers, doch dieser verfügt nicht nur über die notwendigen Künste und Kniffe, sondern auch über jene Langzeitstrategie, ohne welche Taktik bloß ein politisches l'art pour Part wäre. Die Fähigkeit, Gegner nicht bloß zu verwunden, sondern — theoretisch! — zu „erledigen“ wird bei Reimann anschaulich, zu dem Kreisky sagte, „mit Tigern diskutiert man nicht, man erschießt sie“. Das bezeugt Un-bedingtheit. Und wenn er fortfährt: „Nachher erfolgt die allgemeine Schaustellung der ausgestopften Tiere“, so spricht daraus nicht nur die Lust an der Persiflage, sondern auch ein sehr konsequenter Willen.
An der besonderen Beziehung von Porträtisten zum Modell mag es liegen, daß diese nichts über den „zornigen Kreisky“ berichten. Solche, die ihn in seinem Zorn erlebten, wissen davon ein Lied zu singen, wie rasch sich der „bürgerliche Bonhomme“ in sein Gegenteil verwandeln kann.
Daß man dessen, wenn überhaupt, nur selten ansichtig wird, legt Zeugnis von einer verzehrenden Selbstbeherrschung ab.
Man sagt, Kreisky sei fähig, Lob nahezu unbegrenzt zu ertragen; dennoch wird man ihn mit Schmeicheleien nicht herumkriegen. Davor bewahrt Kreisky das ihm eigene, zählebige Mißtrauen und wohl jene Portion Menschenverachtung, die jedem Politiker, der mit Selbstkritik und sensibler Intelligenz ausgestattet ist, zuwächst. Von seiner Fähigkeit, sich selbst zu persiflieren, seiner Vorliebe, Kreisky-Witze über Kreisky erzählen, vielleicht auch erfinden zu lassen, berichten die Biographen wenig. Und fast nichts, was eigentlich wunder nimmt, über seine musischen Anlagen. Gerade diese aber bewirken es, daß er die Politik auch als eine Art besonderer Kunst auffaßt, nahezu ebenbürtig den schönen Künsten.
Ritschel porträtiert Kreisky „naturalistisch“, also so, wie ihn jeder kennt und sieht. Dabei bedient er sich weiter Ausflüge ins Genealogische, bis zurück zu Wallenstein.
Lendvai schränkt seine Beschreibung sehr stark auf das Thema „Kreisky als Außenpolitiker“ ein. Das mit brillanter Feder, großer Sachkenntnis und mitunter auch recht kritisch. Sein Beitrag kommt dem politischen Essay am nächsten.
Reimann entwirft ein historisches Gemälde, zu welchem in einigen Abschnitten Kreisky nur gewissermaßen die Rahmenhandlung bietet. Daher tritt bei ihm, wenn auch unausgesprochen, ein bemerkenswerter Umstand hervor, der so oft übersehen wird, nämlich der von der „Gunst der Stunde“ — manche nen-nen's Glück. Kreisky steigt bei Reimann in dem Maße, in welchem das konservative oder liberale „Bürgertum“ politisch „fällt“. Verunsichert, wie es war und wurde, gleichgültig wovon und von wem, zunehmend glücklos im Artikulieren, beinahe unfähig, sich auf den neuen Typus des oppinion leaders einzustellen, bereitete es nicht nur die Landschaft vor, in welcher Sozialismus, Sozialdemokratie, ergo auch Kreisky Erfolg nahezu haben mußten, sondern überließ diesen das Feld auch immer öfter, ohne das auch nur zu ahnen, geschweige denn, es wissen zu wollen.
In einer solchen Umwelt mußte das Glück sich jenem Manne zuwenden, dessen Geschick für „klassische Diplomatie“ groß ist, der es also versteht, zu hören, was und wieviel es geschlagen hat. Dies und auch jene ihn umgebende Aura von Geistfreundlichkeit befähigten ihn dazu, den besten und auffälligsten Platz im „Zug der Zeit“ einzunehmen.
Ohne seine Qualitäten herabsetzen zu wollen, wird Reimann und damit auch seinen Lesern klar, daß er seine Umgebung wohl auch deshalb um so viele Köpfe überragt, weil dieser so viele Köpfe fehlen. Mit der Aura der Geistfreundlichkeit durchbrach
Kreisky das Eis, das sich um die meisten Politiker und Parteien schon lange gelegt hatte; sie hatten Geist, Intelligenz und Intellektualität allzulange bloß für ein ihr ausgeleiertes Spiel störendes Ferment der De-komposition gehalten. Nun hatten sie den Schaden!
Wir sagten schon, daß kritische Reflexionen in den vorgelegten Biographien Seltenheitswert haben. Wahrscheinlich, weil die zeitliche und räumliche Distanz dafür doch zu gering ist. Völlig fehlt der Hinweis auf die Zukunft. Zwar ist von ihr öfters mal die Rede, aber nur sehr allgemein. Die Autoren halten inne, sobald sie in die unmittelbare Gegenwart gelangt sind. So bleibt noch Raum für künftige Autorenschaft...
Zsolnay/Econ statteten ihr Buch mit zum Teil exquisiten Photos aus. Der „gag“ hingegen mit der photo-graphierten „Ähnlichkeit Kreiskys mit dem Salzburger Erzbischof Fir-mian (1678 bis 1744)“ wäre besser unterblieben, weil sich derartige Ähnlichkeiten des Erscheinungsbildes nahezu beliebig- und bei jedermann herstellen lassen. Molden schließt dem Kreisky-Buch einen Satz Ironimus-Karikaturen an, allesamt trefflich, obwohl man sich an einige noch treffendere zu erinnern glaubt. Auch eine Auswahl aus der politischen Korrespondenz findet sich im Anhang. Sehr aufschlußreich und dokumentarisch. Das Dokument der Staatspolizei über Kreisky öffnet uns die Augen, mit wie beschaffener „Sorgfalt“ hier jeder j|5ürger in Evidenz gehalten wird, $bvon er selbst freilich nichts erfährt. Da jagt es einem denn auch gelinde Schauer über den Rücken.
Zu guter Letzt: eines der beiden Bücher muß man lesen; am besten aber, man liest alle beide.
KREISKY — PORTRÄT EINES STAATSMANNES. Von Paul Lendvai, Karl Heinz Ritschel. Gemeinschaftsproduktion von Paul-Zsol-nay-Verlag, Wien-Zürich, und Econ-Verlag, Düsseldorf-Wien. 143 Seiten, Bildabschnitt.
BRUNO KREISKY — DAS PORTRÄT EINES STAATSMANNES. Von Viktor Reimann. Fritz-Molden-Verlag, Wien-München-Zürich. 352 Seiten inklusive Personenregister, Bibliographie, Briefe zum Teil in Faksimile und Ironimus-Karikaturen.