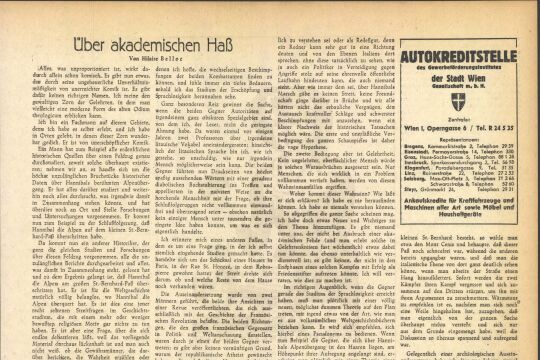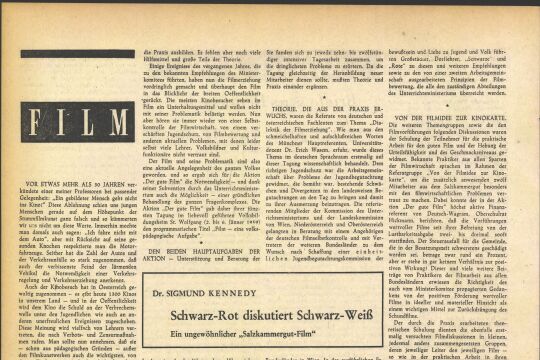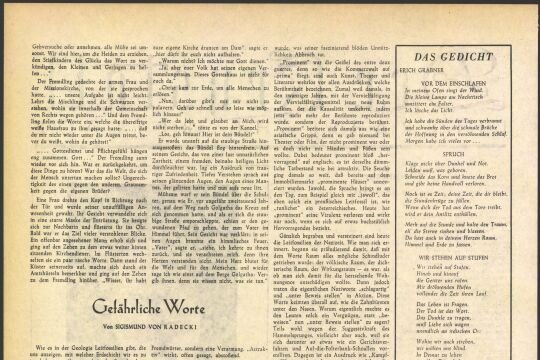Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Brutalität mit gezückter Kamera
Die Story soll ankommen. Man muß sie ins Bild bringen. Banales wird aufge-mascherlt, Nebensächliches, aber optisch Interessantes, aufgeblasen: Auch das ist TV-Alltag.
Die Story soll ankommen. Man muß sie ins Bild bringen. Banales wird aufge-mascherlt, Nebensächliches, aber optisch Interessantes, aufgeblasen: Auch das ist TV-Alltag.
Eine Fernsehdokumentation beginnt für den Redakteur mit Telefonieren. Man fragt sich durch, wer was weiß, wer in welcher Funktion ist, wer was in die Kamera sagen könnte. Ermüdend an diesen Telefonaten ist, daß man zu Beginn ein immer gleiches, möglichst unverfängliches G'satzl aufsagen muß, worum es im Beitrag gehen soll. Je mehr solcher Telefonate man führt, desto besser beherrscht man deren Einstieg, aber desto ungeduldiger wird man, wenn einen der Telefonpartner nicht gleich versteht.
Die Antelefonierten teilen sich in drei Gruppen: Betroffene, Experten, politische Funktionäre. Man beginnt mit den Betroffenen, denn mit ein paar guten Betroffenen ist die Sache fast schon geritzt.
Gut heißt: Sie müssen lebhaft und flüssig reden können (Eloquenz!) oder aber sprachlich so schwach sein, daß man sich auf ihre Kosten lustig machen kann.
Ihre Aussagen müssen in Widerspruch zu bringen sein zu denen der politischen Funktionäre, nicht immer zu denen der Experten.
Die Art der Ansprache von Betroffenen, Experten und politischen Funktionären unterscheidet sich. Bei den Betroffenen muß man listig und vorsichtig vorgehen. In den meisten Fällen sind sie schwer zu motivieren, Erlebtes preiszugeben, gar vor der Kamera.
Kommt man am Telefon nicht weiter, versucht man, einen Gesprächstermin zu vereinbaren, womöghch in der gewohnten Umgebung des Interviewkandidaten. Bei der Gelegenheit kann man gleich den Drehort besichtigen und Einstellungen überlegen.
Im persönlichen Gespräch versucht man zu erklären, daß das Interview den Sinn habe, Mißstände aufzuzeigen, daß die Erfahrungen des Interviewten sehr interessant sind für andere, daß der Beitrag insgesamt etwas bewirke. Da man von dieser These selbst nicht überzeugt ist, sind diese Gespräche unangenehm.
Hat man den Betroffenen end-bch rumgekriegt (also eine Interviewzusage), beginnt man, seine Aussagen genauer zu taxieren: das Wesentliche vom Unwesentb-chen scheiden, das Kritische vom Unkritischen, das Eindeutige vom Vieldeutigen. Sich ausmachen, was er dann wirklich sagt.
Pohtiker- und Experteninterviews sind leichter vorzubereiten. Das ist einer der Gründe für ihr Vorwiegen im Fernsehprogramm. Hier begnügt man sich meist mit nur-telefonischen Vorgesprächen. Bei Politiker-Interviews weiß man von vornherein, daß sie nicht viel bringen.
Im Sinne der Ausgewogenheit, der Chance des Films bei der Abnahme und schließhch, um möglichst umfassend zu sein, nimmt man sie in Kauf. Die Chance, Politiker aufmachen zu können, ist gering.
Als einzige Möglichkeit bleibt oft, zu zeigen, daß sie nichts zu sagen haben, das heißt, durch die Montage eine Stimmung zu erzeugen, die ihr Statement als Nonsens entlarvt. Das entspricht der Stimmung am Schneidetisch beim Besichtigen und Aussuchen des Materials: grenzenlose Langeweile bis verzweifelte Lustigkeit.
Wie sie nach der Klappe das Gesicht zurechtziehen, wie sie neurotisch aussehen (zur Cutterin: „Glaubst du, schlägt der seine Frau?“), wie sie aus den langwierigen Sätzen ihrer Kunstsprache nicht mehr herausfinden — das alles sieht man am Schneidetisch, wo man schnell oder langsam vor-und zurückfahren oder stehenbleiben kann.
Ein schwieriger Fall sind Experten (meist Soziologen). Man nimmt sie hinein, weil sie die Aussagen der Betroffenen in den Augen des „abnehmenden“ Redakteurs erst verifizieren. Auf jeden jugendlichen Hilfsarbeiter muß ein Doktor folgen, der, wenn er links ist, dasselbe sagt, nur langweiliger.
Soziologen neigen zu Endlos-Statements, an denen man am Schneidetisch würgt. Beim Ansehen des Materials entfährt einem leicht ein zorniges „Halt endlich die Gosch'n!“ Am Drehort hat man natürlich die Wichtigkeit und Prägnanz des Statements gelobt
Andere Schwierigkeiten bei den Dreharbeiten mit Betroffenen: Man taucht zu fünft (Redakteur plus Team) auf, zwängt sich in enge Gemeindewohnungen, haut mit den Scheinwerfern die Sicherungen durch. Während das Team die Geräte aufbaut, scharwenzelnde Angehörige den Herren vom Fernsehen Kaffee anbieten, versucht man ein letztes Mal, sein Opfer zu präparieren. Das ist meist schon so aufgeregt, daß ihm Konzentration schwerfällt.
Der Kameramann hält ihm den Belichtungsmesser ins Gesicht, der Tonmeister nestelt an seiner Kleidung, um das Mikrophon zu befestigen, fordert dann herrisch eine Sprechprobe. Man legt mit dem Kameramann die Einstellung fest, ist enttäuscht, weil's wieder einmal nichts hergibt.
Im Bildausschnitt sitzt ein verkrampftes Nervenbündel. Team und Drehplan drängen, wir sollen keine Uberstunden machen. Man dreht. Manchmal geht's gut, manchmal nicht.
Gestalterisch hat man einen
Horror vorm Beamtenfernsehen der redenden Köpfe. Daher sind Themen, die optisch von vornherein attraktiv sind (Pop, Modeerscheinungen, Exotisches) die gefragtesten.
Als harte Brotarbeit gelten die sogenannten Sozialthemen, oft aus dem Ausbildungsbereich. Zur Auflockerung dreht man Totale von Schulklassen und Lehrwerkstätten, Zu- und Wegfahrten auf Schilder und Gebäude, verschiedene Details wie Stundenpläne und Plakate an der Wand, glotzende Jugendliche (stumm), gestellte Handlungsabläufe wie Zeugnisverteilen oder Schraubenanziehen. Dieses Material braucht man für Montagen mit Musik oder zum Ausstopfen von Kommentaren aus dem Off.
In einer Jugendsendung nimmt man Pop-Musik als Köder für Jugendliche. Sie hebt die Spritzigkeit. Hat die Musik einen passenden Text, kann man sie als kritischen Kommentar verwenden, der härter sein kann, als man selber dürfte.
Oft passiert es, daß die Musik dem Material zu einer unverhältnismäßigen Heftigkeit verhilft. Der leise sprechende Waldviert-ler Lehrling wird dann via Musik zum „Working Class Hero“.
Kommentare versucht man, anders als übbch, möghehst sparsam einzusetzen. Meist divergieren Bildmaterial und Inhalt der Kommentare so stark, daß sich der Zuschauer nur auf das eine oder andere konzentrieren kann — oder auf beides nicht.
Hauptsache bleiben die Interviews. Die versucht man auf zufetten. Sitzt einer in einem prunkvollen Büro, wird man ihn in der Totale zeigen — ganz klein inmitten des Gerumpels. Erzählt einer eine ergreifende Geschichte, bleibt man ganz nah auf seinem Gesicht, um alle Regungen mitzukriegen.
Polizisten zum Beispiel kann man in Steckbriefmanier - Profil rechts, Profil links, frontal - aufnehmen. Man kann in den Einstellungen jedoch nicht allzu extrem werden, weil man ohne
Drehbuch arbeitet, das heißt, die genaue Reihenfolge der Einstellungen noch nicht kennt. Beim Schnitt kann sich dann herausstellen, daß zwei — an sich schöne — Einstellungen nicht aneinan-derpassen. Im Haus ist nur das Mittelmaß gewünscht, die Halbtotale = Brustbild. In einer Anweisung für Kameramänner steht, man dürfe an Politikergesichter nicht zu nah heran.
Eine durchgehende filmische Gestaltung bringt man meist nicht zusammen. Dazu sind Vor-bereitungs- und Drehzeit zu kurz. Die vier Drehtage für zwanzig Minuten hetzt man von Interview zu Interview. Am Anfang agiert man noch bemüht, bei der Abnahme stellt sich aber heraus, daß besondere gestalterische Anstrengungen gar nicht erwünscht sind.
Bei filmischen Elementen sinkt das Interesse des „abnehmenden“ Redakteurs ins Bodenlose. Er lauscht gespannt den faden Interviews, peirüich darauf achtend, daß Parität und „Ausgewogenheit“ gegeben sind. Rot-Schwarz-Rot-Schwarz. Eigentbch brauchte man sich nicht die Mühsal mit Betroffenen anzutun. Pohtiker würden genügen, man hätte weniger Schwierigkeiten:
Man fühlt sich aber nicht nur den Autoritäten und der Hierarchie verpfhchtet, manchmal auch den Sehern. Da tappt man jedoch völlig im dunkeln, welche Art der Gestaltung am besten ankommt.
Das Fernsehen insgesamt neigt zu Tempo und Flüchtigkeit: keine langen Einstellungen, keine Verschnaufpausen, möglichst viele Effekte. Bei Untersuchungen stellt sich heraus, daß die Leute bei dieser Hektik nur wenig mitkriegen. Befragt, was sie gesehen haben, wissen sie nichts.
Ein schneller Film gilt im Haus als besser als ein langsamer. Irgendwie verständlich: oft gerät epische Breite zu inhaltsleerer Langeweile. Dennoch reagieren die Leute oft am stärksten auf solche , Jangweüigen“ Filme. Sie sind bereit, viel in Kauf zu nehmen, wenn nur das Thema sie berührt.
Ein schwacher Film über ein attraktives Sujet wird begeisterte Zuseher finden. Es gibt kaum Kontakt mit dem Publikum, daher auch keine gesicherten Erfahrungen, keine Regem. Das ist aber auch wieder das Interessante an dieser Arbeit.
Auch innerhalb der Redaktion gibt's kein Feedback. Man hört keine ehrlichen Meinungen von Kollegen über sein Produkt. Die Konkurrenz um die Sendeminute vergiftet das Klima. Dennoch nimmt man alles wichtig.
Am Tag der Aufzeichnung sieht man den Film ein letztes Mab Die Sendung schaut man sich gar nicht mehr an. Die Sache ist abgelaufen, auf Nimmerwiedersehen. Am nächsten Tag sitzt man wieder am Telefon.
Der Beitrag entstammt auszugsweise dem Buch MEDIENFORSCHUNG, Band I. Hrsg. von Dieter Prokop. Fischer-Verlag, Frankfurt/Main, 1985.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!