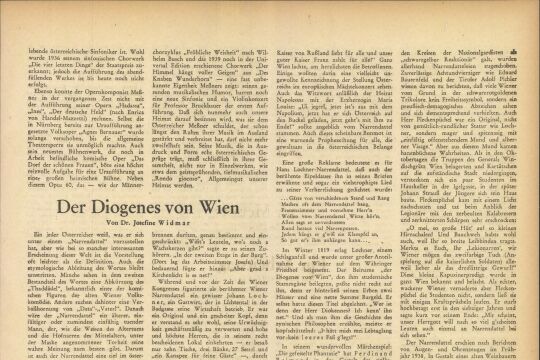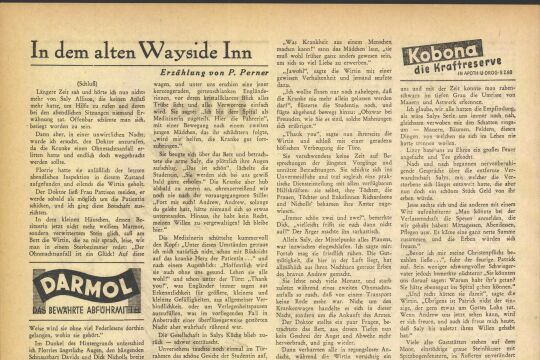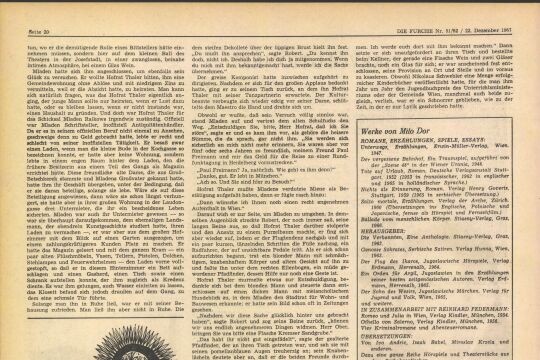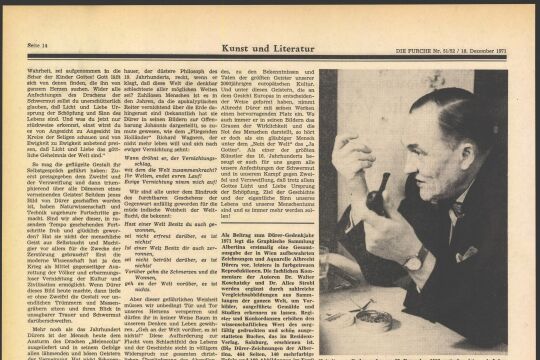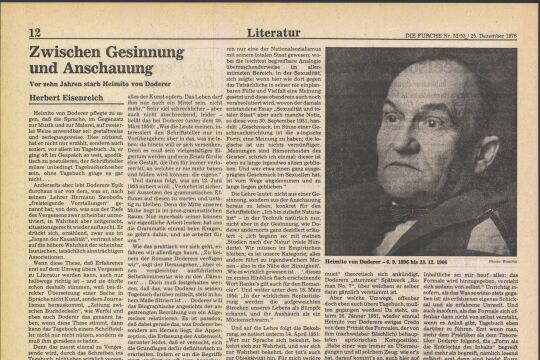„Hier ein Zimmer haben, ganz einsam ... und ein Tagebuch führen ...“ Wie gut kann ich den Dichter verstehen! Und wie sehr ist dieser Wunsch in diesen Tagen auch der meine geworden! Ich treffe also alle Anstalten, ihn mir wenigstens für ein paar Tage zu verwirklichen, und mobilisiere Freunde und Bekannte, Hausmeisterinnen und Makler; zuletzt erwäge ich sogar die Einrückung eines Inserats. So schön stelle ich mir das vor: Schon sehe ich mich an einem der Fenster der vornehmen Strudlhofgasse oder der ihr benachbarten Pasteurgasse Posten beziehen, bei Schönwetter mich über die Brüstung eines Balkons beugen, den Ausblick auf die Stiege genießen und über alle Vorgänge auf dieser „Lebensbühne“ Protokoll führen.
Es ist eine kurze Sackgasse und der Abschnitt, der für mein Unternehmen in Frage kommt, ist auch davon wiederum nur ein Stück, keine zehn Hausnummern. Aslan, König der Schauspieler, hat hier gelebt; eine Tafel am Portal erinnert daran. Ucicky, der Filmmann, hat hier seine Klimt-Sammlung zusammengetragen; der berühmte Seces-sionist war sein Vater. Die Initialen der bedeutenden Musikerin Isolde A. lese ich an einem der Klingelbretter — könnte der Rufname einer Cembalistin treffender gewählt sein? Der greise Kirchenfürst der Magyaren, über seinen Memoiren grübelnd, hat, hier ums Eck, sein Exil aufgeschlagen; die Nachbarn sehen den Menschenscheuen zuweilen, den roten Kardinalshut auf dem Kopf, im Garten auf und ab gehen. Das Palais, dessen Park vor der Abholzung die Stiege immergrün säumte, ist zum „Sperrgebiet“ erklärt, seitdem die Amerikaner darin ihre Abrüstungsstrategen eingemietet haben.
„Seltsam genug“, sagt Doderer. in den Tagebüchern,- ,wbn Südamerika bis Konstantinopel: Viele einzelne Personen, sobald sie nur ganz hervortreten, erweisen sich da als durch sehr konkrete Bezüge mit jener alten Stiege verknüpft, die zu einer terrassenförmigen Bühne dramatischen Lebens wird.“
Ich gestehe, daß mir diese Kupplerfunktion der Strudlhofstiege, so kunstvoll vom Autor auch all die Auftritte im einzelnen inszeniert sind, immer etwas outriert vorkam. Jetzt, wo ich, „an allen Ecken inspizierend“, dem Terrain auf so manches seiner Mysterien draufkomme, fange ich an, darüber anders zu denken. Andere, neue, nicht minder geheimnisvolle Beziehungen tun sich auf. Kann ich, beispielsweise, so einfach darüber hinwegsehen, daß sich einen Steinwurf vom Office der Atomabrüster entfernt, gerade nur über die Gasse, das Institut für Radiumforschung befindet? Und ist wirklich weiter am Walten eines Genius loci zu zweifeln, wenn ich sehe, daß der Nachbar der Pazmani-schen Kollegienstiftung, in deren Bei Etage sich jener entmachtete Budapester Kirchenfürst vor der Welt versteckt hält, die amerikanische Botschaft ist? Dabei gehe ich gar nicht so weit, den im Vorfeld der Stiege Düsterkeit verbreitenden Klotzbau der Heilsarmee in meine Erwägungen miteinzubeziehen, der während des Krieges ein wichtiges Domizil der SS war.
Immerhin kann es nun keine Frage mehr sein, daß ich mir den Gedanken, hier Quartier zu beziehen, aus dem Kopf zu schlagen habe. Die Polizei, die Tag und Nacht mit verstärkten Patrouillen das Stiegenviertel im Auge behält, müßte unweigerlich jeder Zimmerwirtin, die mich kurzfristig aufnähme, mit peinlichen Nachforschungen über meine Person zur Last fallen. Ein potentieller Botschaftsattentäter, ein zu allem entschlossener Pazifist oder gar ein Mindszenty-Entführer — eines von diesen müßte ich in den Augen der Behörde wohl sein.
Selbst ein Kaffeehausfensterplatz als Beobachtungsposten scheidet aus; während es sonst überall in dieser Stadt bis in den letzten Winkel von Cafes und Espressi wimmelt, von Branntweinstuben und Beiseln — hier, im Umkreis der Stiege, ist gastronomisches Notstandsgebiet. Das Cafe Brioni und das Wirtshaus „Zur Flucht nach Ägypten“, wichtige Lokalitäten der Romanhandlung, stehen zwar nach wie vor in Blüte, und selbstverständlich mache ich ihnen meine Aufwartung, hier bei einer Melange mit Nußkipferl, dort bei eingemachtem Kalbfleisch mit Markknödeln, aber beide, obwohl bequem zu Fuß zu erreichen, bieten keinen Ausblick auf das Orakel vom Aisergrund, auf den „Nabel der Welt“, auf Doderers „Hain des Genius loci“, „träufend und glitzernd von Beziehungsreichtum“.
Ich wickle also mein Unternehmen, statt stationär, vazierend ab und streiche um die Strudlhofstiege herum. „Susi und Peter“ — so lese ich in kindlicher Denunziantenhandschrift auf halber Höhe: sicherlich keine Doderer-Pilger, die sich hier verewigt haben. Der Denkmalpfleger drinnen im Rathaus, dessen nobles Wesen niich an jenen Johann Theodor Jaeger erinnert, Erbauer der Stiege, den der Dichter einen „feingebildeten Mann“ nennt, einen über sich selbst hinausgewachsenen Ingenieur und Humanisten, berichtet mir zwar, gelinde amüsiert, von allerlei ihm zu Ohren gekommener lokaler Idolatrie: von Schulklassen, die ihre Deutschstunde an der Stiege absolviert hätten — ich versuche, mir die Stufen als Schulbänke, die Rampen als Katheder vorzustellen — von der deutschen Gymnasiastengruppe, die den berühmten Romanschauplatz zum Ziel ihrer Maturareise erwählt habe und, am Ziel angelangt, sogleich in rauschhaftes Zitieren verfallen sei, und von der — ebenfalls deutschen — Volkshochschule, die bei ihrer Stadtrundfahrt, sowie diese den einschlägigen neunten Gemeindebezirk erreichte, auf zwei Draufgaben, bestanden habe: dem Freud-Museum und der Strudlhofstiege; aber ich selbst sehe mich in den Tagen meiner Recherchen allein mit meinen Aktivitäten. „Die Stiegen brachten es ... wieder einmal fertig, vollends verlassen zu sein.“
Ich starte bei dem Haus Währingerstraße 50, in dem der Dichter, endlich der Gegend seiner Träume nahe, bis zum Vorweihnachtstag des Jahres 1966 sein letztes Lebensdezennium verbracht hat und wo zu Zeiten immer noch das Telephon läutet: Doderer-Verehrer, die es sich in den Kopf gesetzt haben, in Begleitung der Witwe zur Stiege zu pilgern oder zum Ehrengrab auf dem Grinzinger Friedhof oder auch zum Doderer-Stammtisch im Gasthaus „Zur Stadt Paris“. Für sie selbst, darin minder sentimental als so mancher Leser, sind es nicht nur Gänge der Erinnerung, an die Stiege denkend „ganz in der Art, wie man an einen Menschen denkt“, sondern auch hausfraulich besorgte Nachschau — so, wie eine gute Femme menagere ihre Wirtschaft in Ordnung hält. Als sie eines Abends, erzählt sie, die Ampeln, welche die „hohen Kandelaber auf ihren schlanken, gegitterten Masten krönen“, von Lausbubenhand zertrümmert fand, war ihr erster Weg der zur nächsten Polizeiwachstube, Meldung zu erstatten von dem fatalen Frevel.
Ich gehe stadtwärts durch die Währingerstraße, die paar Schritte zurück bis zu jenem unansehnlichen Amtsbau, in dem die „Bezirksvor-stehung Aisergrund“ ihr Heimatmuseum unterhält und wo die Möbel aus Doderers letztem Arbeitszimmer, seine Totenmaske, die legendären Reißbretter, auf denen er die Komposition seiner Romane in ein wunderliches Koordinatensystem aus vielfarbigem Gekritzel zu bringen die Gewohnheit hatte, Pfeil und Bogen und andere persönliche Habe sich zum Doderer-Gedenkzimmer gruppieren, und biege dort, schräg vis-ä-vis in die Strudlhofgasse ein, in deren Umkreis sich bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts der Ansitz jenes kaiserlichen Hof- und Kammermalers Peter von Strudl befand, der dann auch der 120 Jahre später errichteten Treppenanlage ihren Namen gab. Es ist das Viertel der naturwissenschaftlichen Universitätsinstitute; nicht weit von hier wurde Schubert geboren, nicht weit von hier haben Lenau und Freud gelebt, nicht weit von hier sind Beethoven und Hebbel gestorben, nicht weit von hier haben van Swieten und Lise Meitner gelehrt. Der Kustos des Bezirksmuseums, der nur ehrlicher ist als andere Leute, wenn er in verschmitzter Anspielung auf die gravitätische Weitschweifigkeit von Doderers Schreibe das Rezept der berühmten regionalen Mehlspeisenspezialität heranzieht und das Scherzwort von der „Strudlteig-stiege“ in den Mund nimmt, sagt nichts anderes als der Dichter selbst, wenn er in seinem heimatkundlichen Mitteilungsblättchen von dem „Revier mit der höchsten Intelligenzquote der Stadt“ spricht.
Ich nähere mich der Boltzmann-gasse (die in der „Strudlhofstiege“ zunächst noch Waisenhausgasse heißt), ich passiere die lange Gartenmauer des Diözesan-Alumnats, die von Demonstranten so gern für ihre antiamerikanischen Parolen mißbraucht wird und entsprechend häufig den Verputz wechselt, lasse meinen Blick noch einmal die Fenster der Fünfzimmersuite des hohen geistlichen Emigranten entlangwandern („Die typische Wiener Hausherrenwohnung, Sie erkennen sie an den schönen Gardinen!“) und registriere summarisch das am unteren Ende der Gasse sich ansammelnde Kleingewerbe: Automatenaufsteller, Kinderkleidervermittler, Salzmandelerzeuger.
Dann rasch noch über die große Straßenkreuzung ein paar Schritte in das alte Stadtviertel Lichtental. Das Haus „Zum blauen Einhorn“, das bei Doderer eine so große Rolle spielt, steht zwar nicht mehr und ist durch einen Neubau ersetzt, aber der Abstecher erweist sich dennoch als sinnvoll: Gleich gegenüber, auf der anderen Seite der Liechtensteinstraße, klettert die Himmelpfortstiege den Abhang zur Nußdorfer-straße hinauf, und was ich da nun auf einen Blick an banaler neuerer Zweckarchitektur sehe, wird mir später, so weiß ich sofort, als Einstimmung auf die Strudlhofstiege noch von großem Nutzen sein. Mit wie erbärmlich prosaischen Mitteln ist hier genau der gleichen Funktion Genüge getan wie weiter drüben: der fußgängerischen Überwindung beträchtlichen Straßenniveauunterschieds auf engstem Raum. Dies hier, in der Tat, ist jene „Hühnerleiter formloser Zwecke“, von der der Dichter mit so viel Emphase seine „terrassenförmige Bühne dramatischen Lebens“ abhebt: „mehr als eine Verbindung zweier Punkte, deren einen man verläßt, um den anderen zu erreichen, sondern eigenen Wesens ... sich dem Schritt des Schicksals vorzubereiten.“
Ich gehe die Liechtensteinstraße zurück, überreif nun für die Strudlhofstiege. bereite rasch noch dem hochmütigen Dehio, der dieses Jugendstiljuwel aus dem Jahre 1910 als unter seiner Würde ignoriert, im Geist ein Autodafe und stürme sodann die Treppen und Rampen, als hätte der Dichter ihrem Benutzer nicht ausdrücklich zur Auflage gemacht, hier — ganz im Gegenteil — „würdig und ausholend“ und „kadenziert“ zu „schreiten“. Ist es denn wieder nur Zufall oder eben doch das geheimnisvolle Wirken des Genius loci, daß sich im Souterrain eines der Häuser gleich um die Ecke ausgerechnet ein Institut für Eurhythmie etabliert hat, das seine Klientel in der längst versunken geglaubten Kunst des ebenmäßigen Schreitens unterweist?
„Was weiß ein prädestinierter Ingenieur von einem Genius loci? Er wird ihn höchstens überall austreiben mit seinen Anstalten. Nicht aber ihn entdecken, wie Jaeger das hier vermocht hat, und eine Ode mit vier Strophen auf ihn dichten in Gestalt einer Treppenanlage. Das kann nur ein Humanist.“
Die Stiege, „strophengeteilt wie ein Gedicht“ — haben die Verse dieses Gedichts heute noch den nämlichen Klang? Bevor ich meinen Erkundungsgang antrat, hatte ich mir eingeschärft: Sei nicht zimperlich, sei nicht wehleidig, widersteh der Versuchung, wegen jedes verrückten Steines, wegen jedes gefällten Baumes gleich die „lokale Gottheit“ dieser „Wiener örtlichkeit“ ausgetrieben, gleich die Vollkommenheit dieses „musischen Gebildes“ zerstört zu sehen! Jetzt, wo ich vor ihr stehe, weiß ich: Dieser Vorsatz ist nicht einzuhalten.
Der Hang, der dem Werk den ihm kongenialen Rahmen gab: brutal abgeholzt. Der Platz davor: Eine Großbaustelle. Die Stiege selbst: unangetastet. Aber wird sie es auch immer bleiben? Der hellgraue Stein, das dunkelgrüne Geländer, die Kandelaber und Spaliere, Stufe und Rampe, Brunnen und Vase, Busch und Baum — alles ist blendend in Schuß, vermehrt noch um die Tafel neben dem steinernen Fischmaul, die man nach des Dichters Tod angebracht hat und die jenen Neunzeiler wiederholt, der dem großen Roman als Motto voraneilt. Und doch: Das Mißtrauen ist ein für allemal da, seit die „Dryade der Stiege“ die Faust im Nacken zu spüren bekommen hat. Hätten die Gewerkschaftler für ihr Hospiz wirklich keinen anderen Platz finden können? Da war plötzlich mit verdächtiger Promptheit die Böschung ins Rutschen geraten, der schräge Baumwuchs über Nacht zur öffentlichen Gefahr geworden — man kennt das von anderswoher, bald schon von überallher —, und das stille Einverständnis eventueller Kritiker glaubte man sich mit dem Angebot erlisten zu können, man werde das Objekt großzügig um ein Doderer-Denkmal bereichern, wie wenn neben dem Original, das in seiner Naturbelassenheit doch ein einziges Doderer-Denkmal ist und zugleich das einzig denkbare und würdige, sich nicht jedes Surrogat wie eine Karikatur ausnehmen müßte!
Die Experten für Stadtbildpflege, mit denen ich mich im Rathaus treffe, haben das plumpe Ansinnen denn auch zurückgewiesen. Zugleich erfahre ich aber, wie knapp der Spielraum bemessen ist, innerhalb dessen diese ewig gedemütigten Männer Initiative entwickeln können. Die Strudlhofstiege steht als öffentliches Bauwerk automatisch unter Denkmalschutz. Aber das tut auch jede Straßenbahnremise, jede Parktoilette. Und in der Amtssprache der Katasterverwaltung ist die ganz kunstvolle Anlage ohnedies nichts weiter als eine „öffentliche Verkehrsfläche“.
Dr. K., der das Gespräch mit mir führt, entzieht sich, für seine Person, freilich entschieden solcher magistratischer Sprachregelung: Für ihn ist die Strudlhofstiege, ganz im Sinne des Dichters, eine Lebensbühne, deren zweiflügeliger unterster Absatz übrigens den Theatergeher auch an den barocken Bühnenaufbau im Redoutensaal erinnern mag, drüben in der kaiserlichen Hofburg. Und in Heimito von Doderers Laudatio auf diese architektonische Sternstunde, die K. nicht von ungefähr zu einer Studie über „Baedeker-schreibende Dichter“ angeregt hat, sieht er — sein Wort in Gottes Ohr! — eine Pflichtlektüre für Stadtplaner.
„Der Meister der Stiegen hat ein Stückchen unserer millionenfachen Wege in der Großstadt herausgegriffen und uns gezeigt, was in jedem Meter davon steckt an Dignität und Dekor.“