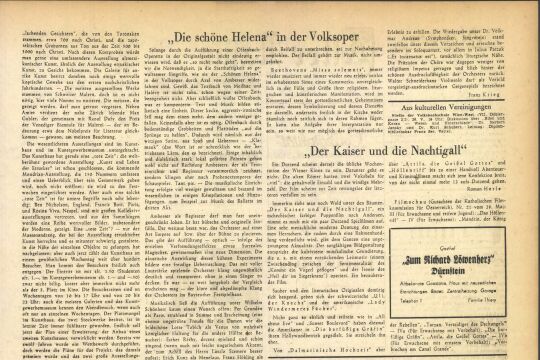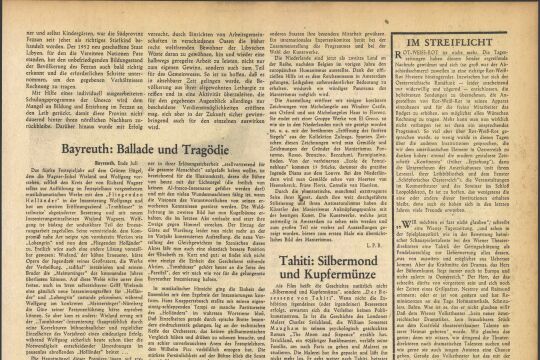Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Ereignis Kleiber
Eigentlich war dieser „Tannhäuser“ als Ersatz für die gefallene Festwochenpremiere der „Meistersinger“ geplant: Doch auch aus der musikalischen Neueinstudierung und der szenischen Erneuerung der Karajan-Produktion unter Christoph von Dohndnyi wurde nichts; nach mehrmonatigen Absagen und einem systematischen Abschreibeprozeß nun das Ergebnis: ein blamabler „Tannhäuser“, ein Dützendrepertoireabend, irgendwie, lieblos, ohne jede Stimmung auf die Bühne gestellt.
Daß Karajans Produktion heute nicht zuletzt auch wegen Erich Wendeis häßlich-öder Ausstattung kaum noch geschmackliche Aktualität besitzt, etwa im Unterschied zu seinem Wiener „Ring“ auch keinen neutralen Spielrahmen für Starbesetzungen ergibt, soll als Problem ausgeklammert bleiben. Ebenso ausgeklammert soll auch die Frage bleiben, warum man nicht endlich sich von dieser Pariser Fassung getrennt hat, um so mehr als die BaHettszenen dieser Wiener Aufführung ohnedies von kaum beschreibbarer Peinlichkeit sind. Unverständlich ist hier nämlich vor allem der Versuch, „Tannhäuser“ mit einer derart ungleichwertigen, zusammengewürfelten, proflllosen Besetzung „auf Sparflamme“ herauszubringen. Und noch dazu unter Leitung eines zwar hochbegabten, sehr ehrlich arbeitenden jungen Dirigenten, Hermann Michael, der aber die Probenzeit — ob sie wohl überhaupt genug war? — offenbar nicht genug genützt hat oder auch nicht die Kraft hatte, all diese Schlampereien des nicht recht zusammengewachsenen Teams zu korrigieren.
Schlimmster Alltag also in der Besetzung: Natürlich mit Ausnahme Hannelore Bodes, einer Elisabeth von idealer Wagner-Erscheinung, mit makellos-schönem, weichem Sopran, strahlender Höhe, imponierender Intensität lyrischen Ausdrucks. Doch sonst rundum vorwiegend Provinz! Wolfgang Schöne bringt zwar als Wolfram die ideale Erscheinung mit, bleibt aber in jeder Hinsicht allzu reserviert; seine Szene in der Sängerhalle, sein Lied an den Abendstern, die Begegnung mit dem gebrochenen Pilger Tannhäuser zeigen es: ein schlanker geschmeidiger Bariton, freilich eine Nummer zu klein. Man vermißt dynamische Kraft und Ausstrahlung.
„Tahnhäuser“ Hans Beirer ist allzu routiniert, leistet ich szenische Eskapaden, die ihm ein Dirigent strikte untersagen müßte. Er forciert, singt die heikelsten Stellen allzu gewaltsam; Joy Mclntyre ist eine scharfstimmige Venus ohne jeden verführerischen Reiz, Walter Kreppet ein unpräzise, polternder, geradezu peinlicher Landgraf. Alles in allem also ein sparsam-provinzielles Wartburg-Fest, von einer Art, daß sich die „dringenden Bedürfnisse“ der Auffrischung des Wagner-Repertoires aufhören sollten. Da lieber keinen „Tannhäuser“ als diesen!
Eine Orchesterprobe hatte Carlos Kleiber zwar nicht bekommen, aber er dirigierte seinen ersten Wiener „Rosenkavalier“ der Staatsoper auch ohne: Offenbar, weil er das Gefühl hätte, sich ganz auf dieses Orchester verlassen zu können. Es hat ihn denn auch nicht im Stich gelassen, bewies, was es an Konzentration, präzisem Reagieren, aufregender Intensität zu geben vermag, wenn... ja, wenn es eine so unverkennbare Persönlichkeit wie Kleiber am Pult hat und nicht einen jener mittelmäßigen Routiniers, die am Ring leider allzu häufig das musikalische Geschehen im Routinebetrieb, im Mittelmaß ersticken. Kleiber ist natürlich nicht nur eine faszinierende Persönlichkeit, er ist auch ein Handwerker von bestechender Exaktheit, einer, der weiß, was man von hervorragenden Musikern fordern kann und muß, um sie in ihrer Leistung zu steigern. Und das gab diesem „Rosenkavalier“ eine Dichte der Atmosphäre, wie man sie allzu selten erlebt.
Erfreulich auch die Damen dieser Aufführung: Gwyneth Jones, eine kultiviert-diskrete Marschallin, auch wenn die Stimme manchmal schon den Glanz etwas vermissen läßt; Trudeliese Schmidt aus Düsseldorf: ein Oktavian, so hübsch, elegant, jugendlich wie man ihn sich wünscht und obendrein ein schöner schlanker Mezzo, der sehr klug geführt wird; Hilda de Groote, eine liebenswerte Sophie mit korrekter Diktion, gelöstem Spiel ohne in aufdringliche Komik zu verfallen. Karl Ridderbusch ist als Darsteller noch immer kein Ochs. Pappig, aufdringlich, vom ersten Auftritt an outrierte Vorstadtkomödie, die er eigentlich nicht nötig hat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!