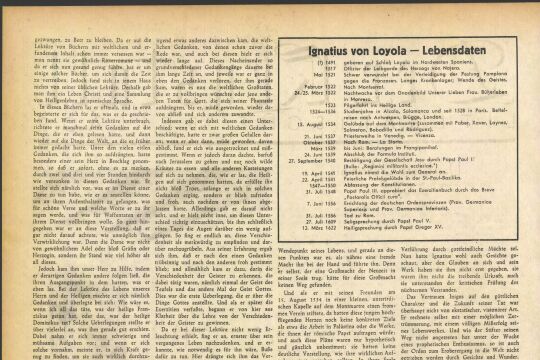Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Genie als Dilettant
An Adalbert Stifters „Nachsommer" ist der Verfasser verhältnismäßig spät geraten. Früher, seit seinen Knabenjahren schon, hatte er die „Bunten Steine" und andere kleinere Werke, wie sie in den „Studien" gesammelt sind, gelesen und studiert; der große Roman aber stand, halb Drohung und halb Verlockung, lange Zeit unberührt im Bücherschrank.
Was dann am „Nachsommer" überraschte, war die im Vergleich zu den früheren Werken unpoetische Sprache; ja, bei fortschreitender und wiederholter Lektüre wurde deutlich, daß hier nicht nur auf das eigentlich Poetische (oder was man so nennt), sondern auf den sogenannten guten Stil schlechthin, auf jedes Wirkende überhaupt, verzichtet ward zugunsten des möglichst einfachen und möglichst natürlichen Wortes. Auffällig war vor allem, daß Stifter hier keineswegs um das „genaue Wort" oder gar um das ausdruckstärkste bemüht ist, sondern, im Gegenteil, oft recht allgemeine, gleichsam weitläufige .Ausdrücke gebraucht.
Im „Nachsommer", diesem schon mehr als meisterlichen Werk, steht bereits das Bekenntnis: „In Sachen der Natur muß auf Wahrheit gesehen werden." Das ist Stifters Absage an den holden Schein, an die poetische Verklärung. Aber mehr noch: Stifter verzichtet im „Nachsommer" geradezu ostentativ auf seine erworbenen Kunstfertigkeiten, auf die Beherrschung seiner Mittel, auf sein Artistentum, konkret also: auf seine, auf seine eigene Sprache; er macht sich freiwillig zu dem niedersten Diener der Wahrheit, und deshalb steigt er freiwillig auf die unterste Stufe all derer herab, die mit der Kunst aktiven Umgang pflegen: auf die Stufe des Dilettanten.
„Obgleich meine Malereien", sagt der Ich-Erzähler im 1. Kapitel des zweiten Buches, „keine Kunstwerke waren, wie ich jetzt immer mehr einsah, so hat-ten sie doch einen Vorzug, den ich erst später recht erkannte, und der darin bestand, daß ich nicht wie ein Künstler nach Abrundung noch zusammenstimmender Wirkung oder Anwendung von Schulregeln rang, sondern mich ohne vorgefaßte Einübung den Dingen hingab und sie so darzustellen suchte, wie ich sie sah." Er begnügt sich damit, „ein großer Freund der Wirklichkeit der Dinge" zu sein, der es nie leiden konnte, „wenn man einen Gegenstand zu etwas anderem machte, als er war". Und genau das wird denn auch dem Er-
zähler zum Kriterium der Kunst im allgemeinen, der Literatur im besonderen: „Unter den Büchern waren auch solche, in denen Schwulst enthalten war. Sie gaben die Natur in und außer dem Menschen nicht so, wie sie ist, sondern sie suchten sie schöner zu machen, und suchten besondere Wirkungen hervorzubringen. Ich wendete mich von ihnen ab. Wem das nicht heilig ist, was ist, wie wird der Besseres erschaffen können, als was Gott erschaffen hat?"
Und später: „Die Gebirge standen im Reize und im ganzen vor mir, wie ich sie früher" - mit den Augen des Wissenschaftlers - „nie gesehen hatte. Sie waren meinen Forschungen stets Teile gewesen. Sie waren jetzt Bilder so wie früher bloß Gegenstände." Die Versuche legt er seinen Freunden vor. „Ihr Urteil ging einstimmig darauf hinaus, daß mir das Naturwissenschaftliche viel besser gelungen sei als das Künstlerische. Die Steine, die sich in den Vordergründen befänden, die Pflanzen, die um sie herum wüchsen, ein Stück alten Holzes, das da läge, Teile von Gerolle, die gegen vorwärts säßen, selbst die Gewässer, die sich unmittelbar unter dem Blicke befänden, hätte ich mit Treue und mit den ihnen eigentümlichen Merkmalen ausgedrückt. Die Fernen, die großen Flächen der Schatten und der Lichter an ganzen Bergkörpern und das Zurückgehen und Hinausweichen des Himmelsgewölbes seien mir nicht gelungen. Man zeigte mir, daß ich nicht nur in den Farben viel zu bestimmt gewesen wäre, daß ich gemalt hätte, was nur mein Bewußtsein an entfernten Stellen gesagt, nicht mein
Auge, sondern daß ich auch die Hintergründe zu groß gezeichnet hätte, sie wären meinen Augen groß erschienen, und das hätte ich durch das Hinaufrücken der Linien angeben wollen. Aber durch beides, durch Deutlichkeit der Malerei und durch die Verzögerung der Fernen, hätte ich die letzteren nähergerückt und ihnen das Großartige genommen, das sie in der Wirklichkeit besäßen."
Das ist eine ebenso herbe wie fundamentale Kritik seiner frühen poetischen Werke, der ersten „Studien"-Fassun-gen zumal. Er - und wir sprechen jetzt wieder von Stifter, denn was im „Nachsommer" über Malerei gesagt wird, er-. läutert gleichzeitig die Methode, in der der Roman geschrieben ist -, er also, Stifter, fängt ohne „Anwendung von Schulregeln" wieder ganz von vorne an, er gibt sich jetzt den Dingen „ohne vorgefaßte Einübung" hin; wobei er als seinen geistigen Fundus nicht mehr sein Wissen von den Gesetzen der Kunst, sondern sein Wissen von den Gesetzen der Natur empfindet, aus denen heraus dann im Lauf der Arbeit die Gesetze seiner neuen Kunst, der Kunst des „Nachsommer", wie von selber entstehen.
Zwar führt Stifter im „Nachsommer" sowohl praktisch - indem er diesen Roman schreibt - als auch theoretisch - indem er über das Malen schreibt - einen viel hundert Seiten langen Kampf gegen sein bisher erworbenes künstlerisches Können, gegen sein Artistentum; aber einmal erworbenes Können läßt sich nie mehr verleugnen; es hat den Geist gebildet, hat diesem eine bestimmte Beweglichkeit anerzogen und eine bestimmte Richtung gewiesen. Ja: je tiefer ein Können und ein Wissen in Vergangenheit geraten sind, desto sicherer wohnen sie in der Tiefe des Bewußtseins, aus der heraus sie wirken.
Dieser geistige Mechanismus gehört zum Genie, welches dem vorzüglichsten Meister eines voraus hat, nämlich die gleichsam traumhaft unbeschränkte Verfügungsgewalt über seine Mittel, einschließlich der allerwichtigsten Möglichkeit, diese Mittel zu ändern und zu biegen, ja zu ignorieren. Daraus entstehen die frappierenden Kühnheiten, die den genialen Werken eigen sind; Kühnheiten, fast möchte man sagen: Frechheiten, die wir bei den größten Meistern vergeblich suchen, denen wir hingegen beim Dilettanten so oft begegnen wie beim Genie. Indessen, was beim Dilettanten im Stadium des Einfalls steckenbleibt, was hier bloß in der Anlage neu, bloß als Versuch kühn, bloß als Wunschtraum groß ist, das hat beim Genie, weil dieses durch das Können hindurchgegangen ist, den vollen Grad und Wert der Wirklichkeit. Der Dilettant bleibt, das Genie wird wieder naiv; jener hält an der Vorderseite, dieses an der Rückseite der Unmittelbarkeit; jener verzichtet auf die Erwerbung der Mittel, dieses auf die erworbenen; jener bleibt arm von Geburt an, dieses wählt die Armut auf dem Höhepunkt des Reichtums.
So sehen wir das Genie als einen Dilettanten, dessen Geist von der Erfahrung des Artisten durchtränkt ist; oder, allgemeiner: als einen schaffenden Menschen, der nicht aus der Kenntnis der Bücher, sondern aus seinem Charakter heraus handelt, welchen die Bücher bilden geholfen haben. Und was wir in den genialen Werken, so wir den Blick nur auf einzelnes richten, als dilettantisch qualifizieren, das löst sich, wenn wir das Auge für das Ganze öffnen, zur höheren Ehre dieses Ganzen auf, und was auf dem niedrigen, wenngleich höchst achtbaren Rang des Könnens, wo das Makellose sein Recht fordert, rechtens als Makel gälte, das empfinden und ehren wir hier als den offenbar unerläßlichen menschlichen Tribut, an das Göttliche der Kunst.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!