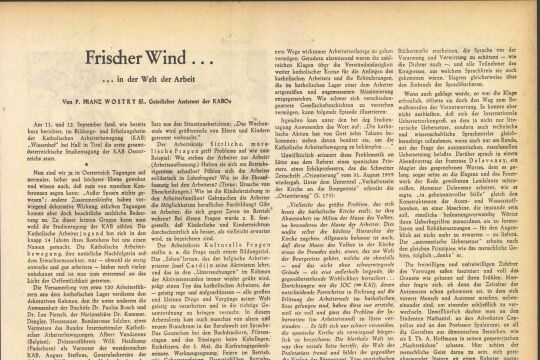Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Labyrinth nebenan
Anläßlich der Rauriser Literaturtage hat Klaus Hoffer den diesjährigen Preis erhalten. Nachstehend veröffentlich die FURCHE einige Reflexionen des jungen Autors über einen neuen Roman.
Durch einen unachtsam gegen ein Hoftor geführten Schlag - man weiß das - kann eine Katastrophe ausgelöst werden. Wehe, man vertut sich beim Zähneputzen oder Schuhzubinden. Ein Augenblick der Zerstreuung, und schon sind die Gesetze des täglichen Lebens außer Kraft: Man steht am Fenster, schaut selbstvergessen hinaus, greift gedankenlos nach einem Fläschchen und nimmt zwanzig oder dreißig Tabletten heraus. Weg ist man.
„Irgendwie mußt du kurz eingeschlafen sein. Denn hegst du nicht den ganz stillen Verdacht zu erwachen?" Mit diesen Sätzen, mit denen Kafka, der Meister der alltäglichen Verwirrung, vielleicht eine Geschichte hätte anfangen können, endet Gert F. Jonkes jüngster Roman „Der ferne Klang". - An seinem Ende ist, wie es am Anfang einmal heißt, alles - auf eine traumhaftklare Art und
Weise - „erschöpfend ungeklärt geblieben". Äfläilsai
Mit einem Blick auf ein gegenüberliegendes Haus also, welches „nach und nach immer deutlicher als ein in dem vom Sommer geschmolzen zerflossenen Horizont herumschwimmendes Ozeanschiff' erscheint, beginnt Jonkes Roman, und er hört auch damit auf - eine Mikrosekunde später. Dazwischen liegt, in abschnitten gegliedert, die Geschichte:
Der Ich-Erzähler, ein Komponist, der sich schon lange zu komponieren geweigert hat, wacht, ohne zu wissen, wie ihm geschah, eines Morgens in einer Irrenanstalt auf. Vorgeblich wurde er wegen eines Selbstmordversuchs dorthin eingeliefert. Er verliebt sich in eine Krankenschwester, die ihn an ene Jugendfreundin erinnert und plötzlich verschwindet. Um sie zu suchen, flieht er aus dem Irrenhaus. Obwohl er irgendwie vermutet, daß ihm die Flucht bewußt erleichtert wurde (der Direktor der Anstalt hatte mit der Schwester möglicherweise ein Verhältnis), versucht er, unbemerkt zu bleiben. Er sucht seine Liebe im Bahnhofskaffee (sie hat gesagt, sie sei regelmäßig dort), stößt dabei auf einen alten Bekannten, dem er seine Geschichte erzählt. Er weiß, daß die Krankenschwester auf dem Lande wohnt, also steigt er mit dem Bekannten, dem Schriftsteller Kalkbrenner, und einer Gruppe von Schauspielern, die zu einem Gastspiel fahren wollen, in einen Zug, der allerdings rätselhafterweise bloß eine große Schleife um die Stadt zieht, um im selben Bahnhof wieder einzufahren. Mit Kalkbrenner verbringt er trinkend die Nacht. Am nächsten Morgen, wieder in der Stadt, kommt er dazu, wie in einer volksfestartigen Revolution sämtliche Verwaltungsakten der Bürger vernichtet werden. Die Revolution, während deren Verlauf er seine frühere Jugendfreundin in einer enttäuschend verlaufenden Begegnung wiedertrifft, verändert nichts am Bestand der Realität.
Der Versuch, den Inhalt des Buches wiederzugeben, bringt so wenig wie eh und je. Das liegt wie immer daran, daß hinter einem solchen Unternehmen die Absicht steckt, etwas auf einen Begriff zu bringen - auf den
Begriff der Wirklichkeit. Das, was man gemeinhin so nennt, ist wohl der „ferne Klang", von dem der Titel von Jonkes Buch spricht: die Wirklichkeit, die alle dauernd im Mund führen und die dem Helden immerfort so unglaublich fern und erstaunlich vorkommt. Sie erscheint in Jonkes Roman als Gesamtkunstwerk, als das wiedererstandene „Naturtheater von Oklahoma" aus Kafkas „Amerika" -wie Nietzsche das einmal apostrophiert hat: die Welt als ein sich ständig ereignendes Theaterwerk.
Die Absurdität alles dessen, was dem Helden Jonkes widerfährt, könnte man freilich unschwer auf die Formel von den unserer Gesellschaft inhärenten Widersprüchen reduzieren. Sie finden sich natürlich auch in diesem Buch, aber die Absurdität des Lebens liegt auch noch ein Stück jenseits der Kategorien der Widersprüchlichkeit und Entfremdung. Angesichts der phantastischen Welt Jonkes (die wie sein Stil an die Erzählungen des großen polnischen Erzählers Bruno Schulz erinnern) und angesichts von Sätzen wie dem folgenden kommen einem diese Begriffe manchmal wie Platitüden aus einem Schmierentheater vor.
„Wenn mehr Leute", schreibt Jonke, „sich verpflichteter fühlten und im eigenen Kopf per Sie sich unterhielten, statt ständig mit sich selbst verbrüdert zu sein, wäre vieles oder alles ganz anders." Daraus spricht vielleicht jene Distanz zu dem, was einem passiert, die notwendig ist, um dem Leben einige so gute Seiten, wie in diesem Roman abzugewinnen. Vielleicht muß man tatsächlich, wie Kafka einmal in seinen Tagebüchern anmerkt, erst ganz kalt werden, um das beschreiben zu können, was einen so erhitzt hat.
Und da steht man dann einen Augenblick lang da, schaut zerstreut zum Fenster hinaus, wie es der Held in Jonkes Geschichte tut, greift versehentlich zu einem Fläschchen unbestimmten Inhalts, leert es aus, und wenn man Pech hat, waren es Schlaftabletten.
„Der ferne Klang" von Gert F. Jonke. Residenz-Verlag, Salzburg 1979, 270 Seilen, öS 225,-.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!