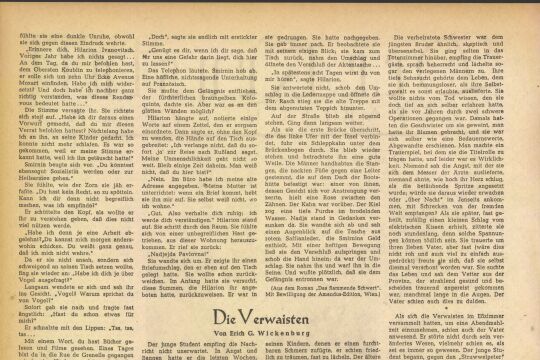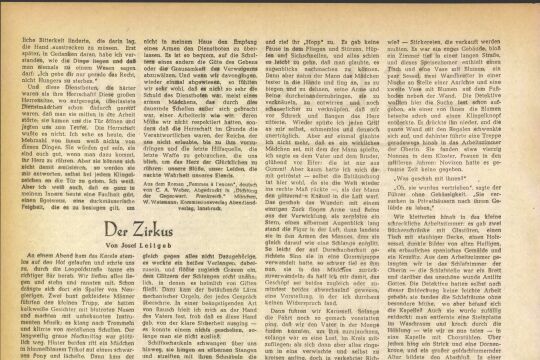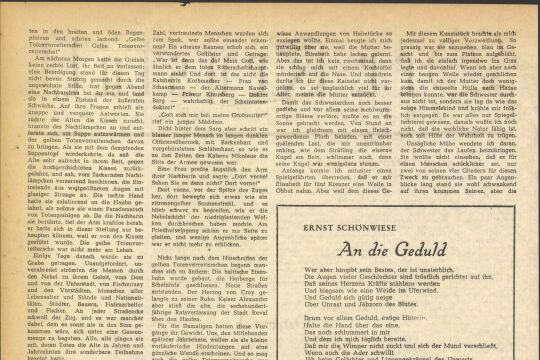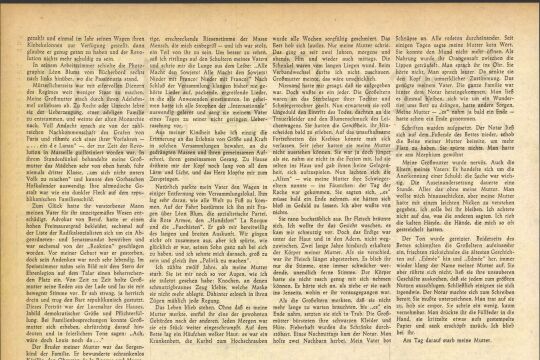Der Vorfall, der das Leben des Assistenten Mihail Sevcenko änderte, ereignete sich eines sonnigen Morgens am Rand der grünen Wiese zwischen dem Ökonomischen und dem Humanistischen Institut.
In der Nacht zuvor hatten sich die Schmerzen wieder eingestellt, die er so gut kannte. Abends hatte es begonnen; das leichte Pochen im Zahn, der sensible Widerhall des kreisenden Blutes und des Herzschlags. Er wußte, es würde kommen, deshalb schluckte er zwei Tabletten, legte sich ins Bett und versuchte einzuschlafen - trotz des Blitzens auf dem Fernsehschirm, vor dem seine Frau saß, wie jeden Abend, und geistlos in einem fort die Programme wechselte. Auch sie wußte, was bevorstand, deshalb drehte sie rücksichtsvoll den Ton leiser, doch das Bild flimmerte dennoch weiter, es knisterte und knackte und raubte ihm den Schlaf, den er so herbeisehnte. Endlich nickte er ein, doch als ihn nach kurzer Zeit ein bohrender Schmerz weckte, flackerte auf dem Bildschirm noch immer regenbogen-farbenes Licht. Nun wußte er, die Nacht würde lang werden. Der hoffnungslos ausgehöhlte Augenzahn, der dritte oben links, pochte anfangs in gleichmäßigem Rhythmus, dann aber immer unregelmäßiger und schmerzhafter, er bohrte, die Schmerzen zogen die linke Gesichtshälfte hinauf, drückten in den Augen, hämmerten im Gehirn. Auch seine Frau schlief nicht, sie machte ihm Umschläge, die er bald krampfhaft gegen die Wange drückte, bald aber wieder ärgerlich wegriß und durchs Zimmer warf. Gegen Morgen war er wie betäubt von den Tabletten, die nicht halfen, mit irrem Blick und schmerzgemarte-tem Gehirn. In diesem Zustand, in dieser Situation, aus der es wirklich keinen Ausweg gab, beschloß er, zum Zahnarzt zu gehen.
Mihail Sevcenko war überzeugt, an seinen schrecklichen, immer wiederkehrenden Zahnschmerzen wären die Kommunisten schuld, so wie sie schuld waren an allem, was schlecht, widerwärtig und mißglückt war in seinem Leben. Zwar geht jeder Mensch seinen eigenen und deshalb unverwechselbaren Lebensweg, und doch war Sevcenkos Schicksal eine der bekannten, in Büchern, Artikeln und Essays auf unterschiedliche Weise beschriebenen und überaus ähnlichen Storys. Als er den Amerikanern die Geschichte von dem nichtigen Streit mit den Behörden in seinem unterdrückten, unfreien Heimatland erzählte, von jenem Streit, der im Gefängnis endete, von seiner Flucht und dem Zufluchtsort, den er im freien Land gefunden hatte, nickten sie höflich, und er wußte, damit konnte er niemanden mehr schocken: Der Umstand als solcher, die Sache überhaupt, war bekannt. Doch nur er wußte, was das alles hieß.
Nicht nur die Quälerei damals, die hatte er schon hinter sich, sondern auch das Leben hier in einer neuen Zivilisation, das Erlernen der Sprache, das Studium an der Universität, wo er als erwachsener, profilierter Mann in einer Bank mit lässigen, leichtsinnigen Studenten sitzen mußte. Er ertrug es, und er wußte, wofür. Bei dem mäßigen Stipendium, das ihm eine Emigrantenorganisation gewährte, biß er die Zähne zusammen. Er eilte von Prüfung zu Prüfung und schlug sich durch bis zur Assistentenstelle in der angesehenen Universität. Er biß die Zähne zusammen, wenn sie nicht gerade schmerzten. Doch das taten sie immer häufiger.
Es gelang ihm, alle Ängste und Traumen, die ihm das frühere Leben in die Seele gepflanzt hatte, mit innerer Disziplin zu besiegen, nur gegen die pochenden, immer wiederkehrenden Schmerzen in den Zähnen fand er keine Kraft und kein Mittel. Die Zähne hatte er sich schon damals verdorben, im Gefängnis überm Ozean, das heißt, sie verdarben ihm durch die schlechte Ernährung, den Mangel an Vitaminen, die ständige Zugluft, das Waschen mit kaltem Wasser. Aus jener Zeit rührte auch seine tiefe, unüberwindliche Angst vor dem Zahnarzt. Wenn er nur an jenen Gefängnisschlächter dachte, an dessen Zangen und Bohrer, dann wurde ihm schwarz vor Augen.
Eigentlich wurde ihm schwarz und rot, denn gerade als ihn der Gefängnisklempner mißhandelte, sah er wie durch einen Nebel dessen Gesicht und an der Wand gegenüber ein großes rotes Plakat mit fetten schwarzen Lettern. Dieses Plakat konnte er nie vergessen, ebenso wenig wie die dik-ken Bohrer. Er wußte, hier in diesem Land gab es andere Geräte. Seine Frau und seine Freunde redeten ständig auf ihn ein, sie brachten Prospekte von Turbo-Apparaten, bei denen sich die Bohrer mit so hoher Umdrehungszahl bewegen, daß die ganze Angelegenheit erwiesenermaßen völlig schmerzlos ist, sie erzählten ihm von den milden Spritzen und den sanften Händen blonder Dentistinnen; doch Mihail Sevcenko konnte seine einzige Angst vor dem heulenden Bohrer, vor dem Metall, das den Schmelz durchdrang und sich in den Zahn fraß, nicht überwinden.
Als er aber an jenem Morgen, von Tabletten betäubt, das Gehirn schmerzgemartert, mit irrem Blick, den rot aufsteigenden Ball anschaute, der ihn an die Sonnenaufgänge in seiner Heimat erinnerte, da verhieß ihm dieses Morgenlicht, daß er es dennoch schaffen würde.
Ausgiebig, doch mit aller Vorsicht und unter Stöhnen spülte er die entzündete Mundhöhle, in Ruhe zog er frische Wäsche an, band sich akkurat die Krawatte und stand dann klopfenden Herzens vor dem Spiegel. Er hörte, wie seine Frau im Nachbarzimmer telefonisch seinen Besuch anmeldete. Tausende Umdrehungen pro Sekunde, dachte er, tausend und mehr geräusch-und schmerzlose Turbo-Umdrehungen.
Ruhigen, festen Schrittes ging er am Gebäude der Ökonomischen Fakultät entlang, er wußte, gleich hinter der Ecke erwartete ihn die grüne Wiese, die sich weit hinzog, bis zu dem Haus, in dem die humanistischen Wissenschaften untergebracht waren, und erst dort, erst hinter der nächsten Ecke, waren die hellen Fenster der Ambulanz, in denen sich das Morgenlicht spiegelte. Er liebte die Wiese zu dieser Tageszeit, sie erinnerte ihn an eine Landschaft seiner Heimat, die er hatte verlassen müssen, an eine Wiese, von einem Bach durchflössen, an dem Weiden wuchsen. Trotz der erbarmungslosen Schmerzen, oder gerade deswegen, dachte er an seine ferne, verlorene Heimat.
In dem Moment, als er um die Ecke bog, sah er zweierlei. Er sah die große, grüne, sonnenbeschienene Wiese. Im selben Augenblick sah er an ihrem Rand, zwischen Gras und Fußweg, die drei oder vier Stände, um die er gewöhnlich einen Bogen machte. Hier stellten linksgerichtete Studenten marxistische Literatur aus, antiimperialistische Pamphlete, sie verkauften T-Shirts mit den Bildern von Che Guevara, Marx und anderen bärtigen Klassikern. Vielleicht hätte er sie übersehen, vielleicht wäre er an ihnen vorbeigegangen, ohne hinzuschauen, an dem Haufen junger Leute, die dort einen Kreis um die Stände bildeten. Vielleicht hätte er dann im Vorbeigehen seinen Schritt beschleunigt, wie immer, und sich an der Wiese, an dem Grün gefreut, er hätte sich der Erinnerung hingegeben, dem weichen Tritt über den Boden, in den seine Füße einsanken wie in einen Polster. Sehr wahrscheinlich hätte er sich anders benommen, sehr wahrscheinlich wäre sein Leben danach ganz anders verlaufen, wenn er an diesem unglückseligen Morgen nicht den betäubten Körper, den irren Blick und das schmerzgemartete Gehirn gehabt hätte, kurzum, wenn nicht die verfluchten Zahnschmerzen gewesen wären.
Ein schwarzhaariger Student mit Halstuch verteilte Flugblätter, die die Passanten nahmen, in die Tasche steckten oder beim Weitergehen lasen. Manche überflogen sie nur und ließen sie in den nächsten Papierkorb fallen, andere traten mit dem Flugblatt in der Hand näher zu den Ständen heran. Ein alltägliches Bild, das Mihail Sevcenko gut kannte und um das er jeden Morgen einen weiten Bogen schlug.
"W Tielleicht kam er an diesem Tag zu nahe heran, möglicherweise
▼ hatte der Pamphletverteiler auch gerade ihn aufs Korn genommen. Wie dem auch sei, plötzlich kam er auf Sevcenko zu und hielt ihm ein rotes, ein leuchtendrotes Blatt Papier hin, bedruckt mit fetten schwarzen Lettern. Sevcenko winkte nur ab und beschleunigte seinen Schritt. Doch ausgerechnet an diesem Morgen, es war sonst nie geschehen, ausgerechnet an diesem Morgen lief der Student ihm nach, holte ihn ein und hielt ihm den Zettel hin, ja er schwenkte ihn, wie es Sevcenko vorkam, sogar aufdringlich vor'seinem Gesicht. Mihail Sevcenko blieb stehen und sah dem jungen Mann in die Augen.
„Ich will den Zettel nicht", sagte er.
„Sie müssen ja nicht", antwortete der Student, „wir sind ein freies Land."
„Deshalb nehme ich ihn auch nicht", meinte Sevcenko.
„Sie müssen ihn nicht nehmen", wiederholte der Student mit dem
Halstuch. Er sagte es, ohne sich zu rühren, noch immer stand er vor Sevcenko und hielt ihm das Blatt hin. Nicht nur hin, sondern ihm entgegen, förmlich in ihn hinein.
Der Schmerz schnitt, der dritte links oben pochte. Mihail Sevcenko wollte den Burschen beiseite schieben und seinen Weg fortsetzen. Aber er tat es nicht. Er wich ihm aus und ließ ihn mit dem Packen Papier in den Händen stehen.
„He", rief da ein schwarzhaariger Marxist aus dem tiefsten Lateinamerika, „he Mister!" Sevcenko wandte sich nicht um. Er ging über das Gras den orangen, glänzenden Fenstern der Ambulanz entgegen. Die Schmerzen drückten die linke Gesichtshälfte hinauf bis in die Augen. Der junge Mann lief ihm hinterher.
„Vielleicht interessiert Sie das hier", sagte er und hielt ihm ein rotes Blatt Papier unter die Nase, es konnte durchaus das gleiche sein, wie es ihm schon der erste Student angeboten hatte.
„Ich habe gesagt, es interessiert mich nicht", sagte Sevcenko und biß die Zähne zusammen, daß ihm der Schmerz aus den Augen quoll.
„Das haben Sie für das vorige gesagt", antwortete der Lateinamerikaner, „aber nicht für dieses hier."
Später sagte der Student aus, Mihail Sevecenko hätte ihn schon in diesem Augenblick angegriffen. Sevcenko aber behauptete in den Verhandlungen, die dann folgten, er hätte das erst später getan, und der Student hätte die physische Unantastbarkeit, die akademische und persönliche Integrität als erster verletzt. . Eigentlich war es auch Sevcenko nicht recht klar, wer wen als erster berührt hatte, er erinnerte sich jedoch ganz bestimmt, daß er noch einmal ausweichen wollte. Er war nach links ausgewichen und hatte den Studenten mit der Schulter berührt, oder aber der Student hatte ihn seitlich gerempelt. Trotzdem war er danach noch ein Dutzend Schritte auf die Fenster der Ambulanz zugegangen. Orange glänzten sie in der ot jV . Sonne, so stark, daß er sich ' -die Sonnenbrille aufsetzen wollte. Doch als er in seiner Jackettasche nach der Brille griff, zog er gleichzeitig mit ihr auch ein rotes Flugblatt heraus. Beim Vorbeidrängen oder beim Zurückweichen hatte der Student es ihm geschickt in die Tasche geschmuggelt. Die Fenster glänzten rot, der Schmerz schnitt durch die Augäpfel zum Gehirn, mit tausend Umdrehungen, mit Turbo-Umdrehungen bohrte er sich durch die Hirnhaut, er bohrte wie die Turbo-Bohrer hinter jenen Fenstern, die sich in den Zahnschmelz fraßen, so wie damals, vor vielen Jahren in der Gefängnispraxis der dicke Bohrer in seinem Kiefer herumgefleischt hatte, daß ihm der Schädel dröhnte, daß ihm die Fetzen durch die Mundhöhle flogen. Sevcenko hielt an. Drehte sich um. Der Student stand noch immer mit dem Packen Flugblätter auf der Wiese. Er ging auf ihn zu. Jener stand da und lächelte. Er ging auf ihn zu, biß die Zähne zusammen und zerknüllte das Stück Papier. Die Zeugen verschwiegen diesen Umtand, diesen wesentlichen Umstand, daß er erst jetzt auf ihn zuging, die Papierkugel in der Hand. Das Lächeln des Studenten erlosch. Er trat einen Schritt zurück.
„Wir sind ein f...", sagte er. Wahrscheinlich wollte er sagen: „...reies Land", schaffte es aber nicht, denn Sevcenko packte ihn am Schlafittchen und stopfte ihm das Knüllpapier direkt zwischen die Zähne. Zwischen die zusammengepreßten Zähne, die gesunden, nicht schmerzenden, die weißen lateinamerikanischen revolutionären Zähne. Sevcenko sah Menschen über die Wiese gelaufen kommen, doch es half nicht mehr, erkonnte nicht loslassen, nicht aufhören. Erst ein paar Sekunden später kam er zu sich, als sie ihn von dem jungen Mann wegrissen. Da standen sich beide schlotternd und stammelnd gegenüber und sahen sich an, und beiden war nicht klar, was da soeben vorgefallen war. Jedenfalls hatte der Assistent Mihail Sevcenko Blutspuren an den Händen, so behaupteten die Zeugen. Ihm schien, als sei die transparente hellrote Farbe nicht Blut, sondern stamme von dem Flugblatt. Eine Analyse machte keiner. Blut oder nicht, der Vorfall war unerhört, das akademische wie 8as staatsbürgerliche Recht der freien Meinungsäußerung waren in vollem Umfang verletzt.
Es wurde eine Affäre, in vollem Umfang. Am nächsten Tag erschien eine Sondernummer der Studentenzeitschrift, da stand in großer Aufmachung auf der Titelseite: Wer stopft uns den Mund? Darunter eine gestümpelte Karikatur des Studenten mit dem Knüllpapier zwischen den Zähnen. Im Humanistischen Institut wurde eine Debatte über die akademische Freiheit anberaumt. Schmähblätter erschienen. Das Lokalfemsehen berichtete in den Mittagsnachrichten über den Vorfall. Auf einer Sonderkonferenz versammelten sich die Professoren der rühmlichen Universität. Der Assistent Sevcenko nahm nicht teil, weil er Zahnschmerzen hatte. Er schickte einen schriftlichen Bericht über die Angelegenheit, in welchem er bewies, daß der Student als erster Gewalt angewendet hätte, indem er ihm das Flugblatt in die Tasche steckte, das er zuvor höflich zurückgewiesen hatte. Von seinem Verhältnis zur Freiheit sprach er nicht. Auch nicht von den Zahnschmerzen. Der Dekan erklärte ihm durchs Telefon, alles sei zu weit gegangen, er kenne seine Vergangenheit, könne aber sein Vorgehen unmöglich verteidigen. Kurzum, der Assistent möge die Universität oder den Beruf wechseln oder sich selber ändern, wenn er es könnte.
Sevcenko änderte alles. Er schrieb seine Kündigung. Zog um. Nahmeine Stelle als Korrektor bei einer Versicherung an. Ausschließlich Nachtarbeit. Schlecht bezahlt und uninteressant. Dafür aber einsam und ruhig. Nur das suchte er: Ruhe und Einsamkeit. In den Folgejahren korrigierte er nachts die Drucksachen der Versicherung, tagsüber ging er durch den Park und saß stundenlang am Bach, wo Weiden wuchsen. Den Augenzahn, den dritten oben links, zog er sich selber heraus. Das Zahnfleisch entzündete sich und eiterte, doch seine Frau behandelte die Wunde mit Kamillentee, den ihm die Verwandten aus der Heimat geschickt hatten.
In den Nächten zum Sonntag und zum Montag, wenn nichts zu korrigieren war, versuchte er zu schlafen, denn den flüchtigen Schlaf an-den Nachmittagen konnte man nicht als solchen bezeichnen. Seine Frau, die jeden Abend in einem fort geistlos die Programme auf dem Bildschirm wechselte, mußte des öfteren aufstehen und ihn kräftig schütteln, wenn er im Schlaf stöhnte, bisweilen sogar schrie. Mihail Sevcenko stöhnte nicht vor Schmerzen im Zahn, in der Wange, in den Augen oder im Gehirn. Er hatte nur ständig den gleichen Traum: Über ihn beugt sich der Gefängnisklempner aus den früheren Jahren in seiner Heimat, und wenn er beiseite rückt, sieht Sevcenko auf der Wand gegenüber das rote Plakat mit den fetten schwarzen Lettern. Immer mehr glichen die Züge des Zahnklempners dem jungen Gesicht des schwarzhaarigen Burschen mit dem Tuch um den Hals.
Übersetzung von Astrid Philippsen.