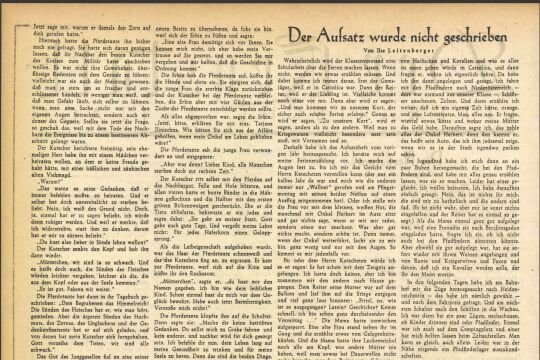Was äst ein Schaf, das im Kuhstali auf die Welt kommt? Ein Schaf oder eine Kiufh?
Oder: Ist der zufällig in Grönland geborene Neger ein Eskimo?
Absurdes Zeug. Wer fragt schon so etwas?
Gar nicht so wenige. Nicht nur alle in Kuhställen geborene Schafe. Nicht nur ale in Grönland geborene Neger. Das fragen alle, die irgendwo, wo sie nicht hingehören, geboren worden sind.
Alle, die eine Sprache sprechen, von der sie wissen, sie ist nicht die ihre, aber ihre nicht kennen. Alle, die eine Heimat lieben, von der sie wissen, sie ist nicht die ihre, aber die ihre nicht kennen. Alle, die „zu Hause“ sagen, aber wissen, daß sie in der Fremde sind, auch wenn sie ihre Heimat nicht kennen.
Als ich ein Kind war, sprach mein Vater oft von „zu Hause“. Und wenn mein Vater von „ziu Hause sprach“, so war das etwas ganz anderes als das ,jzu Hause“, das meine Mutter oder meine Großmutter meinten, wenn sie sagten, „heute bleiben wir zu Hause“, oder, „gut, daß wir bei diesem Regen zu Hause sind“.
Wenn wir einmal „zu Hause'V wären, sagte mein Vater oft, da würde ich Kuhherden sehen, viel größer als hier auf den Halden in der Steiermark. „Zu Hause“, da gäbe es Bauern, die wüßten gar nicht, wie viele Kühe sie hätten, so viele haben sie. Und Lämmer. Lämmer, deren Fleisch „zu Hause“ viel besser schmeckt als hier, weil ,,zu Hause“ ganz andere Gräser wachsen, von denen sie sich nähren. Und die Wälder. Wenn wir „izu Hause“ wären, da würde ich erst sehen, was ein Wald ist. „Zu Hause“ gibt es Wälder, in denen noch“ Bären leben und Wölfe. Und die Wölfe, die kämen im Winter bis in die Dörfer. Und nachts würde man die W,ölfe heulen hören und dürfe ohne Gewehr nicht vor die Türe gehen.'Auch ein Licht, müsse man immer mit sich tragen. Eine Lampe oder eine Fackel, denn Wölfe fürchten das Feuer.
Und dann erzählte mir mein Vater von Wäldern, in denen nur Ldnden-bäume stehen, und deren Duft in der Blütezeit das ganze Tal erfüllt und die einen Honig geben, der viel besser wäre als der von hier. Der steirisChe Waldhonig, der sei, verglichen mit dem Honig „zu Hause“, überhaupt kein Honig Den holten die Bienen nicht von blühenden Bäumen, sondern von schwitzenden Läusen.
Und zu Weihnachten, wenn der Christbaum brannte und ich meine Geschenke auswickelte, da sagte mein Vater, „zu Hause“ wäre das Weihnachtsfest viel schöner. Da gäbe es keinen Christbaum und auch keine „blöden Geschenke“. Da säßen alle in einem großen Raum um ein Feuer, über dem ein Schwein gebraten wird. Und man dürfe den Spieß nur ganz langsam drehen. Dann schmeckt das Fleisch besonders gut. Und während das Schwein auf dem Spieß bedächtig gewendet wird und auch während des Essens singen alle Weihnachtslieder, und einer liest dann auch das Weihnachtsevange-liuim vor. Und alle denken sie nur an die Geburt des Herrn und an die Erlösung der Welt. Zu Weihnachten „zu Hause“. Und nach dem Essen würde ein großer Kuchen angeschnitten, In dem ein goldener Dukaten eingebacken ist. Und für denjenigen, der in seinem Kuchenstück den Dukaten findet, würde das viel Glück für das kommende Jahr bedeuten. Und spät in der Weihnachtsnacht besuchten die Bauern einander und bewirten sich. Von Haus zu Haus würden sie gehen bis zum Weihnachtsgottesdienst am nächsten Morgen. Und die Weih-nachtslieder, die „zu Hause“ in der Kirche gesungen werden, wären viel schöner als die Weihnachtslieder hier.
Und als ich meine Großmutter im Sommer manchmal auf den Markt begleitete und den mir so verhaßten Spinat und die nicht minder widerwärtigen Bohnen und Kohlrüben umherliegen sah, träumte ich von den Märkten „zu Hause“, auf denen angeblich ganze Berge süßer Melonen aufgetürmt wären und Feigen und Trauben, so viele, daß die Bauern sie an einem Tag gar nicht verkaufen könnten und in der Nacht — und die Nächte wären „zu Hause“ sehr warm im Sommer — einfach neben ihren Melonen schliefen.
Und jedesmal, wenn mir meine Mutter ein Honigbrot gestrichen hatte, „damit der Bub seine käsige Farbe verliert“, und mir der Honig über die Finger floß und auf die Hose tropfte, dachte ich, wieviel besser der Honig aus den blühenden Lindenwäldern „zu Hause“ schmek-ken würde.
Alles, was ich • als Kind erlebte, und auch alles, was. ich tat und was ich hatte, empfand ich als vorläufig. Als vorübergehend. Und daher auch Unwichtig.
Meine Freunde waren für mich nur vorläufige Freunde. Und die Pflichten, die ich in der Schule dann hatte, waren für mich unwichtige Pflichten. Mußte ich doch Dinge lernen, die vielleicht nur für hier wichtig waren, aber nicht für „zu Hause“.
Lange Zeit fühlte ich mich von den Anweisungen der Professoren ausgenommen, und meine Mutter mußte sich in den Sprechstunden Klagen über meine skeptische Teilnahmslosigkeit anhören, die angeblich auch meine Kameraden schlecht beeinflußte. Bald setzte man mich in die erste Bank. Bald wieder in die letzte. Bald setzte man einen, der als moralisch gefestigt galt, neben mich, sobald man aber merkte, sein Ernst und seine Lernerfolge wären durch meine unmittelbare Nähe gefährdet, saß ich wieder allein. Und ich wüßte auch jetzt, im Nachhinein nicht einen Gegenstand, der mich wirklich interessiert hätte. Ich lernte ausschließlich um des lieben Friedens willen, der sonst durch schulweite Skandale — mitunter zerrte man mich zum Direktor — und mütterliche Tränen gefährdet war.
„Du bist hier nur Gast“, hieß es zu Hause dann. „Du hast dich als Gast anständig aufzuführen. Du mußt mehr leisten als die anderen. Zeig' ihnen, was du kannst. Vergeblich versuchte man, meinen Ehrgeiz zu wecken.
Das einzige, was in mir im Lauf der Jahre erwachte, war eher ein melancholischer Zweifel an dem paradiesischen „zu Hause“, von dem mein Vater immer seltener sprach. Langsam wurde mir bewußt, daß es wohl bei dem vorläufigen „zu Hause“ bleiben würde. Daß alles nur als vorläufig Empfundene wohl auch das Endgültige wäre. Daß nach dem von mir als unwichtig Belächeltem nichts Wichtiges mehr zu erwarten sei. Daß dieses „zu Hause“, von dem ich eine Kindheit lang geträumt hatte, nicht besser wäre als mein vorläufiges, höchstens ein anderes.
Ich fühlte dies besonders, wenn Verwandte von „zu Hause“ zu uns auf Besuch kamen Onkel, Tanten,Vetter. Fremde Menschen, die mich küßten, in einer fremden Sprache auf mich einredeten und erstaunt den Kopf schüttelten, als sie merkten, daß ich sie nicht verstehe. Ich dachte, daß ein „zu Hause“, für das ich eine fremde Sprache lernen müßte, kein „zu Hause“ wäre. Und so fühlte ich immer in jenen Augenblicken, in denen das „zu Hause“, von dem ich träumte, Wirklichkeit wurde, dessen Fremde.
Eigentlich schon bei meiner Taufe. Da mein Vater darauf bestand, daß ich nach orthodoxem Ritus getauft werde, wartete man damit solange, bis die ersten orthodoxen Geistlichen nach Graz kamen. Ich war damals schon acht Jahre alt. Stolz erzählte ich in der Schule, daß ich demnächst getauft werden sollte.
Der katholische Katechet stattete meinen Eltern einen Besuch ab und versuchte sie zu bewegen, mich katholisch taufen zu lassen. Erstens bestehe, so sagte er damals schon, zwischen der orthodoxen und der katholischen Religion ohnedies kaum ein Unterschied und außerdem sei an österreichischen Schulen kein orthodoxer Religionsunterricht vorgesehen, und die Taufe allein mache keinen Christen. Keinen katholischen und keinen orthodoxen. Schließlich einigte man sich. Meine Eltern versprachen, mich in den katholischen Religionsunterricht zu schicken, aber getauft werden sollte ich orthodox.
Ich erinnere mich noch genau an das mir unverständliche Taufritual. Ein Mann las mit erhobener Stimme aus einem Buch vor. Ich hatte, angeführt von einem Taufpaten, verschiedene Gänge zu vollführen. Danach goß der Pope, unverständliche Gebete murmelnd, aus einem kleinen Krug Wasser auf meinen Kopf.
Kaum war die Zeremonie zu Ende, betrat ein zweiter Geistlicher den Raum. Ein alter Mann mit schulterlangem Haar und langem Bart. Unwirsch stellte er dem Priester, der mich getauft hatte, einige Fragen. Sie fingen an zu streiten.
Ich wollte gehen. Mein Vater hielt mich zurück. Der alte Pope riß dem jungen schließlich das Meßgewand vom Leib und zog es an.
Das Ritual begann von vorne. Der Mann begann neuerlich mit erhobener Stimme zu lesen. Und ich wanderte mit meinem Taufpaten wieder im Kreis herum. Vor einer großen Waschschüssel blieben wir stehen. Der alte Pope — ich hatte Angst vor ihm, zag an meinem Hemd. „Ausziehen“, sagte mein. Vater.
Ich zog das Hemd aus. Man beugte mich über die Waschschüssel. Und der Pope goß einen Kübel Wasser über mich. Dann reichte man mir ein Handtuch.
An das Ende meiner seltsamen Taufe kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, daß ich später dann im katholischen Religionsunterricht immer eine angenehme Sonderstellung eingenommen habe. Alles, was geboten und verboten war, empfand ich als für mich nur bedingt verbindlich. Und als es für mich dann nach vielen Jahren gewiß war, daß ich außer meinem vorläufigen, nicht ganz ernst genommenen „zu Hause“ kein anderes habe, weitete ich dieses im Religionsunterricht kultivierte Bewußtsein der bedingten Verbindlichkeit aus auf alles, was ich dachte und tat.
Je nach Bedarf balancierte ich zwischen Zugehörigkeit und Fremdheit. War von den „Wdndischen“ und den „Tschusohen“ die Rede, fühlte ich mich zum Beispiel überhaupt nicht betroffen, da ich ja geborener Steirer war. Nur wenn ich manchmal einen Schulfreund besuchte, und wir in staubigen Läden auf alte Briefe stießen, Briefe aus dem Jahr 1874 oder 1877, Briefe aus Liezen, aus Stainz, aus Leoben, in denen sich seine Ahnen ihre Neuigkeiten mitteilten — daß „das mit der Rosa und der Ziege nun endlich ins Reine gekommen“ sei, daß „der Herr Großvater, wenn er weiterhin bei so guter Gesundheit bleibt, mit nach Mariazell“ werde fahren können —, da erschienen mir diese vielen Zeilen in nadeliger Kurrentschrift wie Moos, das einen alten Stein bedeckt. Moos, das mir von irgendwo Abgesehen runde und überwachsene Fel-sprengtem und kahl und kantig zwi-sen Gefallenem fehlte, und ich fühlte, daß ich fremd war.
Ich beneidete meine Freunde. Eine Tante in Stainz zu haben,, irgendeinen alten Verwandten, zu dem man dex Einfachheit halber Onkel sagt, in Leoben oder einen Cousin irgendwo ^draußen auf dem Land, den man während der Ferien besuchen kann, das erschien mir als großes, für mich unerreichbares Glück.
Und in der Geographdestiunde, wenn Steiermark oder Österreich durchgenommen wurde, da wußten meine Mitschüler über diesen oder jenen Ort viele Einzelheiten, kannten die Namen eines Flusses, eines Schlosses, einer Ruine, und wenn der Professor sie fragte, woher sie das wüßten, hieß es „ja, dort lebt mein Großvater“ oder, „meine Tante hat dort ein Geschäft“. Für mich aber waren die Namen dieser Flüsse und Berge fremde Namen.
Wenn in der Schule dann von „zu Hause“ die Rede war und der Professor zu mir sagte: „Na, das mußt du ja wissen, das ist doch deine Heimat“, zuckte ich verlegen die Achseln, weil ich auch meine Heimat nicht kannte und deren Berge und Flüsse auswendig lernen mußte wie die Berge und die Flüsse eines jeden anderen Landes. Und wie ich die Berge und die Flüsse der Steiermark zunächst auswendig gelernt hatte, bevor ich sie dann nach und nach auch kennenlernte.
Kein Großvater hat mich nach Stainz eingeladen und keine Tante nach Leoben. Und auch die Ferien habe ich nie bei einem Cousin auf dem Land verbracht. Was ich kennenlernte und wie ich es kennenlernte, war Zufall. Manchmal erinnerte ich mich an einen alten Brief in der Lade eines Schulfreundes. Manchmal auch an den Geographieunterricht.
Mehr gab es nicht, was mich mit den Orten, in die ich kam, und mit den Bergen und Flüssen, die ich sah, verbunden hätte.
Bis ich nach vielen Jahren dann zum erstenmal „zu Hause“ war. Als Gast. Als Gast, der die Sprache seiner Heimat nur sehr schlecht verstand. Als Gast, dem das vom Vater gelobte Lämmerne nicht geschmeckt hat, als Gast, der die Briefe seiner Ahnen in den alten Laden nicht einmal lesen konnte, denn sie waren cyrillisch geschrieben. Und die großen Wälder „zu Hause“ fand ich schön, aber fremd, und den Honig nicht süßer als den angeblich von schwitzenden Läusen gewonnenen, den ich bisher gegessen hatte.
Ich kann nicht sagen, daß ich enttäuscht war damals. Der Zweifel an der Vollkommenheit dieses von meinem Vater gepriesenen „zu Hause“, die ich schon lange gehegt hatte, waren in diesen Tagen einfach zur Gewißheit geworden. , Und ohne Wehmut fuhr ich wieder zurück. Zurück in dje Fremde, in der iCh geboren wurde, in der meine Eltern lebten, deren Berge und Orte mich an die Geqgraphiestunden erinnerten und an alte Briefe in fremden Laden und von der ich nun wußte, daß sie meine Heimat war. Meine fremde Heimat, deren anhänglicher Stiefsohn ich, ohne es recht zu merken, inzwischen geworden war.
Ein Schaf, das aus dem Kuhstall eigentlich gar nicht mehr hinaus-möchte.