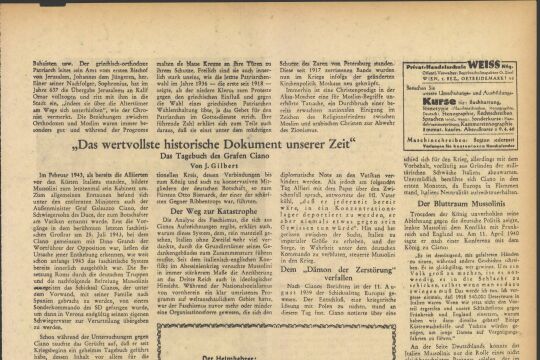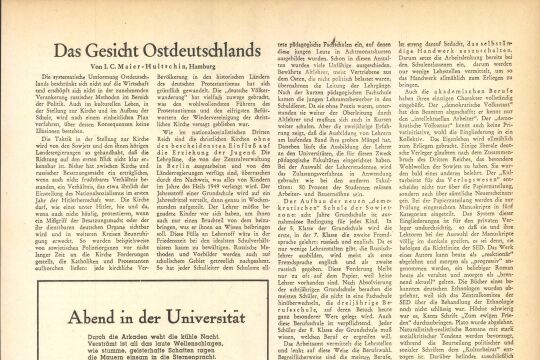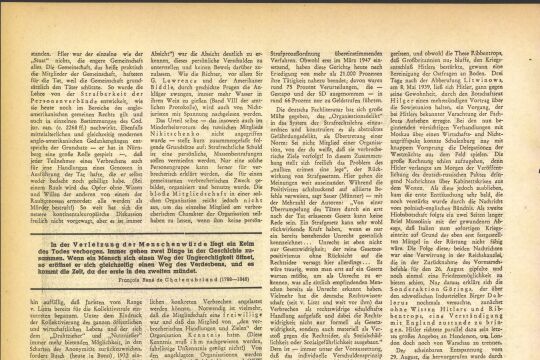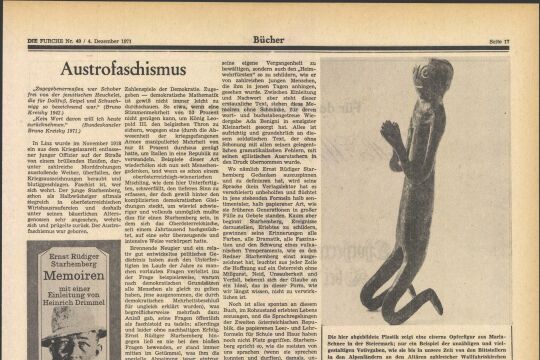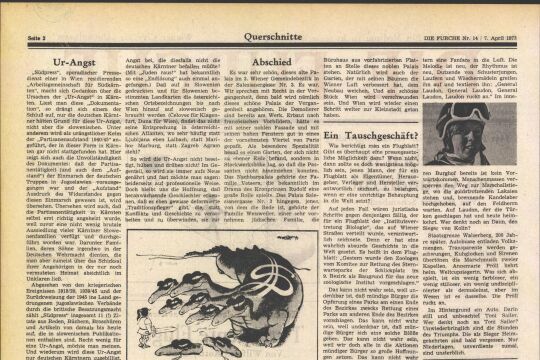Das vergebliche Juli-Abkommen
Vor vierzig Jahren wurde der „Deutsche Weg“, den Österreich seit dem Zusammenbruch der Doppelmonarchie bis in den Zweiten Weltkrieg hinein zu beschreiten versucht hat, um einen bedeutenden Meilenstein bereichert. Das Wiener Kabinett schloß mit der Reichsregierung am 11. Juli 1936 einen Vertrag, der die Beziehungen beider Länder nach der Auseinandersetzung um das Jahr 1934 erneut stabilisieren sollte. Hitler anerkannte die momentane Existenz eines unabhängigen, christlich-deutschen, autoritär geführten Ständestaates Osterreich. Der Preis, den er dafür forderte, war allerdings bedeutend höher, als zunächst angenommen wurde.
Vor vierzig Jahren wurde der „Deutsche Weg“, den Österreich seit dem Zusammenbruch der Doppelmonarchie bis in den Zweiten Weltkrieg hinein zu beschreiten versucht hat, um einen bedeutenden Meilenstein bereichert. Das Wiener Kabinett schloß mit der Reichsregierung am 11. Juli 1936 einen Vertrag, der die Beziehungen beider Länder nach der Auseinandersetzung um das Jahr 1934 erneut stabilisieren sollte. Hitler anerkannte die momentane Existenz eines unabhängigen, christlich-deutschen, autoritär geführten Ständestaates Osterreich. Der Preis, den er dafür forderte, war allerdings bedeutend höher, als zunächst angenommen wurde.
Trotzdem hat der „Führer“ das Juliabkommen nie unter seine Erfolge gereiht. Es war ihm stets mit dem Makel des mißglückten Put-sches vom Juli 1934 verbunden, seinem prinzipiellen Standpunkt in der österreichfrage zuwiderlaufend, mit der Gefahr einer Verzerrung des Endzieles, der Angliederung Österreichs, behaftet. Man mußte dafür sorgen, daß sich die andere Seite nicht falsche Hoffnungen machte, denn dazu schien man in Wien seit der Niederschlagung des braunen Aufruhrs immer wieder bereit zu sein! Tatsächlich gab es für den Ballhausplatz auch aus anderen Gründen kaum Ursachen, optimistisch zu werden. Daß man ungeachtet aller Schwierigkeiten so tat und das Juliabkommen als positives Ergebnis der eigenen Bemühungen wertete, auf dem man getrost weiterbauen konnte, ist aus dem Zwang der Situation, vielleicht auch aus dem damals plötzlich entdeckten österreichischen Nationalgefühl und dem damit verbundenen, ungewohnten Selbstvertrauen heraus zu verstehen. Wie aber lagen die Dinge wirklich, die noch' an jenem warmen Juliabend, rosig gefärbt, von prominenten Vertretern der Vaterländischen Front in einer Sondersendung der RAVAG skizziert wurden?
Zunächst — und dies verschwiegen die Redner in Radio Wien — bedeutete die Beziehung zu Hitler nicht das einzige Problem, das mit dem Abkommen zusammenhing. Seit Dr. Dollfuß gegen Berlin aufmuckte,
war Mussolini Protektor der Unabhängigkeit Österreichs. Die Westmächte überließen ihm diese Rolle, ja sie forderten dies ein übers andere Mal von ihm, um sich selbst anderen Fragen widmen zu können. Der abessinisch-spanische Krach zwischen London und Rom lag noch im Zeitenschoß verborgen. 1936 gingen die Sohicksalsuhren anders, und Österreich konnte sich das Benehmen des Sommers 1934 gegenüber den Deutschen nicht mehr leisten. Damals hatte sich das Kabinett mit eisigem Schweigen das Entschuldigungsgestammel des neuernannten Botschafters von Papen bezüglich der Juliereignisse angehört und ihn nachher mehr oder weniger aus dem Kanzleramt geworfen. Damals hoffte man auf schnelle innenpolitische Erfolge. Am 2. August erklärte Bundeskanzler Dr. Kurt v. Schuschnigg in einer Rede, daß seine Regierung
die Diktatur keineswegs als Ideal ansehe und glücklich sein werde, später die Bevölkerung im Rahmen des ständischen Systems zu befragen und auf ihren Rat zu hören. Zur selben Zeit sagte Starhemberg bei einem Empfang in dem noch immer von Bundesheer und Heimwehr gefechtsmäßig besetzten Kanzleramt, daß Papen keine Garantie gegen die deutschen Machenschaften darstelle und daß eine Restauration des Hauses Habsburg erst dann überlegt werden könne, wenn Schuschnigg den Wiederaufbau und die Sicherung Österreichs durchgeführt habe. Kein Zweifel, damals seinen die NS-Bewegung in Österreich auf ihre Anfangsstadien zurückgeworfen zu' sein, während sich die Regierung auf dem Höhepunkt ihrer Macht angelangt fühlte. Allerdings gab es bald besorgniserregende Pannen, etwa die Enthüllungen des „Telegraph am Mittag“ über Sondierungsgespräche Schuschniggs mit dem gemäßigten Nazi-Ingenieur Rheintaller oder die Verrätereien des Sicherheitschefs Dr. Sonnleith-ner im Solde der deutschen Spionage. Da und dort festigte sich der Eindruck, daß die Regierung eher mit den österreichischen Nazis, richtiger: mit ihrem „betont nationalen“ Vortrupp, wieder ins klare kommen wollte, als mit den illegalen Sozialisten, und zwar einfach deshalb, weil hinter den Erstgenannten doch die Macht des Reiches stand und letztere weitaus weniger entschlossene ausländische Befürworter hinter sich hatten. Dazu kam, daß sich Schuschnigg immer stärker auf den Katholizismus stützte und Starhemberg sich immer mehr an Mussolini hielt. Der dritte Sieger des Jahres 1931, Major Emil Fey, hatte niemanden, an den er sich hätte halten können und gab, auf seinen Kreis beschränkt, daher keine Basis für eine Verfestigung des Systems ab. Für alle Kritiker des historischen Geschehens war er als Scharfmacher gegen die Wiener Sozialdemokratie ebenso gekennzeichnet, wie als einer der schwächsten Faktoren auf Regierungsseite während des Dollfußmordes am 25. Juli 1934. So entschlossen sich Schuschnigg und Starhemberg, ihre nächsten Erfolge nicht bei der Ausweitung des Friedens nach links oder beim Absolvieren nationalsozialistischer Volksteile zu suchen, sondern in der Entmachtung Feys und seiner Anhänger.
An und für sich sprachen für die Zurückdrängung Feys und sein Ausscheiden aus dem Kabinett mehrere sachliche Gründe. Dagegen aber — und das wurde von Schuschnigg und Starhemberg übersehen — stand die Tatsache, daß man sich nach außen nicht den Schimmer einer Uneinigkeit leisten konnte.
Auch Starhemberg, der bei dieser Gelegenheit ein paar neue Vertrauensmänner auf Ministersessel brachte, wurde des Erfolges nicht froh. Er mußte sämtliche Wehrverbände trotz ihrer nunmehr offen zutage liegenden Meinungsverschiedenheiten nach und nach in die Miliz der Vaterländischen Front einrücken lassen, wo sein persönlicher Einfluß im Sinken begriffen war. Er mußte sich neue Aktivitäten ausdenken, seinerseits mit den salonfähigen Nazis verhandeln, noch stärker mit Mussolini zusammenarbeiten und die Arbeiterschaft durch
Versprechungen und wirtschaftliche Korrekturen auf seine Seite zu ziehen versuchen. Innerhalb der ersten Monate des Jahres 1936 wurde es Starhemberg klar, daß auch Schusch-nigg nicht auf vergangenem Lorbeer ausruhte, daß er als Kanzler
aber über weiterreichende Möglichkeiten verfügte als der Fürst. Zu einer Periode angestrengter außenpolitischer Aktivität beider Männer gesellte sich nun ein Zeitraum halbverborgener Konkurrenzaktionen am Innern des Landes.
Noch im Sommer 1934 hatte Schuschnigg erkennen müssen, daß sein ermordeter Vorgänger, trotz Lavierens nach allen Seiten, weitreichende außenpolitische Konzeptionen hinterlassen hatte, Dollfuß hatte mit einer Expansion Italiens auf dem Balkan gerechnet und dabei den Donauraum wieder unter österreichischen Einfluß bringen wollen. Er war zum Urheber der Zusamen-arbeit zwischen Wien, Budapest und Rom geworden, hatte den Italienern sogar Durchmarschrechte über Kärnten gegen die Jugoslawen versprochen und hatte Mussolini ganz von Hitlers Seite weggehalten. Schuschnigg wollte dieser Linie nicht ohne weiteres folgen, er begann vorsichtig auch um die Gunst der Westmächte zu werben und glaubte sich darin bestätigt, als der französische Ministerpräsident Laval am 7. Januar 1935 mit Mussolini in der Ewigen Stadt Verbrüderung feierte. Wenig später kam es zu einem Militärabkommen zwischen Frankreich und Italien, das Österreichs Grenzen leidlich schützte.
Aber das Rad der Weltgeschichte fing an, sich schneller als bislang zu drehen. Im März 1935 begann die deutsche Wiederaufrüstung, im April einigten sich England, Frankreich und Italien in Stresa zum letztenmal über ihre gemeinsame europäische Politik. Auch Österreich bekam von dort Zeichen des Wohlwollens und Hitler hielt, davon beeindruckt, die eher maßvolle Reichstagsrede vom 21. Mai. Seine Worte führten zu ersten diplomatischen Verhandlungen zwischen Berlin und Wien, in deren Verlauf die Deutschen ihr Verlangen nach einer Abstimmung wie im Saargebiet fallen ließen. Im Spätsommer wurde Europa jedoch offenbar, was Laval und Mussolini bei ihrer römischen Begegnung tatsächlich ausgehandelt hatten: Der Duce kehrte dem Balkan den Rük-ken und wandte sich Afrika zu. Seine Wacht am Brenner sowie Italiens Mitsprache im Donauraum schwächten sich zugunsten der Erlangung des Kaiserreiches Äthiopien von Monat zu Monat ab, die Südostpolitik des Dritten Reiches stieß nach und
gewann an Konturen. Der Bundeskanzler näherte sich angesichts dieser neuen Entwicklung vorsichtig Prag und den Staaten der Kleinen Entente, Starhemberg suchte Mussolini, der davon keineswegs erbaut war, zu beruhigen. Mit Besorgnis erkannten die beiden Österreicher, wie der Duce plötzlich auf bessere Beziehungen zu Hitler Wert legte und die österreichisch-deutsche Feindschaft als unbequem zu betrachten begann. Die Ungarn, deren man sich in Wien durch das gemeinsame Band der seinerzeitigen Römerprotokolle sicher glaubte, begannen nach Berlin zu schielen, zumal die Rhein-
landbesetzung Hitlers in der Luft lag, die das Ende der Vorherrschaft des Westens über das Abendland bestätigen sollte. Angesichts dieser Lage differenzierte sich die außenpolitische Haltung des Kanzlers immer deutlicher von den Ansichten seines Kompagnons. Schuschnigg sah sein Abrücken vom einseitig-italienischen Kurs, dem er selbst noch beim Hinauswurf Feys und der damaligen Kabinettsumbüdung gehuldigt hatte, durch die Ereignisse gerechtfertigt, obwohl auch er mit Mussolini weiterhin, zusammenarbeiten wollte. Er wußte ja noch nicht, daß alle seine neuen Freundschaften im Versuchsstadium steckenbleiben, ja, daß Italien und die Westmächte von ihrem bisherigen Standpunkt völlig abgehen und Österreich fallenlassen würden. Er fühlte nur, daß er sich bei Hitler einen besseren Ruf verschaffen könne, wenn er die eigene Macht im Lande ausbaute und sein christliches Deutschtum innerhalb der österreichischen Staatsgrenzen möglichst selbständig weiterentwik-kelte.
Da war Starhemberg anderer Meinung. Er glaubte unbeirrt an die großen Worte Mussolinis, an dessen Entschlossenheit, mit England bis an den Rand des Krieges zu gehen, also an eine Wendung, die damals auch vom „Führer“ Deutschlands ventiliert wurde. Starhemberg schwor auf das italienische Wirtschaftssystem und schätzte die etwas andersgearteten ökonomischen Versuche des Ständestaates gering ein. Erfüllt von solchen Ideen, fuhr er im Februar 1936 zum Begräbnis Georgs V. nach London und rutschte dort in seiner burschikosen Art auf dem Parkett der internationalen Politik aus. Er verärgerte die jugoslawischen und rumänischen Repräsentanten durch habsburgfreundliche Erklärungen, verstimmte die Freunde Habsburgs bei Verhandlungen mit den Franzosen, trat allerorts für Mussolinis Faschismus und AbbessinienfeMzug ein und sandte dem Duce später noch ein Glückwunschtelegramm zu dessen Siegen in Afrika. Seine Sondierungsgespräche mit Hitler-Leuten schlugen indessen fehl, da sich von Papen bereits auf Schuschnigg als den genehmeren Partner festgelegt hatte.
Die Serie offener Streitigkeiten zwischen Schuschnigg und Starhemberg begann 1936 mit einer Rede des
Heimwehrführers in Horn. Der Fürst warf dem Kanzler größere Hinneigung zu den Deutschen als notwendig vor und pries den italienischen Stil. Aber Schuschnigg war soeben bei Mussolini gewesen und verstand bereits, daß der österreichischen Regierung nichts anderes übrig blieb, als immer tiefere Verbeugungen vor Berlin wenigstens anzudeuten. Starhemberg, der sich mit seinem Anschluß an den Duce auf dem berühmten „Holzweg“ befand, ließ nicht locker und wurde in seinem Radikalismus gegen Braun und Rot womöglich noch schärfer. Der Kanzler entschloß sich daraufhin, seinem Konkurrenten ebenso den Boden unter den Füßen weg-' zuziehen, wie beide dies vor Jahresfrist gemeinsam mit Fey getan hatten. Er ließ Demonstrationen verschiedener Wehrverbände gegeneinander zu, marschierte selbst mit, beobachtete, wie Starhemberg mit dem entthronten Fey erneut herumstritt und machte den Fürsten am Morgen des 14. Mai 1936 im Ministerrat klar, daß er als politisch führender Partner im In- und Ausland unmöglich geworden sei. Das ominöse Telegramm Starhembergs an Mussolini und die Verstimmung der Westmächte darüber taten ein übriges, um auch dem Heimwehrexponenten Berger-Waldenegg als Außenminister wegzublasen. Anderntags reiste Starhemberg nach Italien, und zwar als frischgebackener oberster -Sportführer Österreichs, begleitet von der Fußball-Nationalmanschaft.
Inzwischen ging der deutsche Botschafter am Ballhausplatz ein und aus. In der Umgebung des Bundeskanzlers tauchten überdies immer öfter Exponenten der „betont-nationalen“ Kreise auf, die zwar nicht mit den ülegalen Nazis verwechselt werden wollten und die Eigenstaatlichkeit Österreichs hinnahmen, die aber doch zu Berlin beste Beziehungen unterhielten. Nach einem Weekend im Juli 1936, das von Papen. bei Hitler auf dem Obersalzberg verbrachte, schien die geheim vorbereitete deutsch-österreichische Verständigung reif für die Öffentlichkeit zu sein. Die Überraschung war auf allen Seiten groß. Die Leitung der österreichischen Nationalsozialisten hatte Mühe, ihren Anhängern das Paktieren Hitlers mit dem „Unterdrücker Schuschnigg“ zu erklären, die Vertreter des extrem-österreichischen Kurses sahen plötzlich die Möglichkeit vor sich, von ihrem bisherigen Herrn dem Feind geopfert zu werden. Für die meisten Unerfahrenen galt der 11. Juli als Anlaß zu großer deutsch-österreichischer Gefühlsduselei und „Schulter an Schulter“-Erinnerungen aus dem Ersten Weltkrieg. Die Westmächte mußten sich eingestehen, daß sie für Österreich zu wenig getan hatten und dieses Wenige nunmehr ins Wertlose umzuschlagen drohte. Die Nachbarstaaten steckten nach Vogel-Strauß-Art den Kopf in den Sand, doch ihre Diplomaten waren sich darüber einig, daß das Juli-Abkommen nur als Teil einer umfassenden deutsch-italienischen Verständigung anzusehen sei und daß Mussolini anfing, sich Hitler unterzuordnen. Dem Wortlaut des Vertrages nach handelte es sich um einen Nichteinmischungspakt, der jedoch in seinen Details eine Anzahl von Möglichkeiten zur Einmischung des Reiches in die inneren Angelegenheiten Österreichs offen ließ.
Eine selbständige Politik Wiens konnte jetzt nur noch sehr vorsichtig in Szene gesetzt werden, das Meiste, was dabei herauskam, war ein nicht gerade ehrenvolles Verzögern und Von-hintenherum-Opponieren. Mag sein, daß sich Hitler manchmal überlegte, ob er mit Schuschnigg vielleicht doch einen guten Fang auf die Dauer gemacht habe. Jedenfalls zeigte er sich bald vom Kanzler enttäuscht und befahl die Aufrechterhaltung der illegalen NS-Organisa-tion im Lande. Schon am 16. Juli sagte er beim Besuch von Parteifunktionären des braunen Untergrundes in Österreich, er brauche für diese Angelegenheit noch zwei Jahre Zeit.