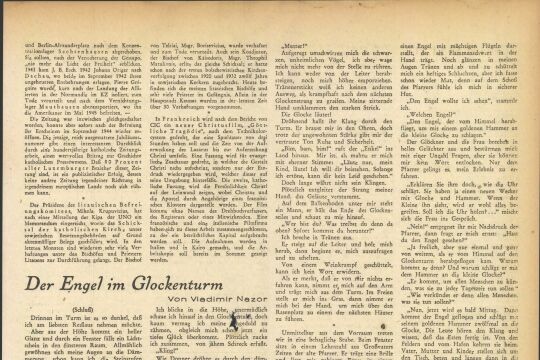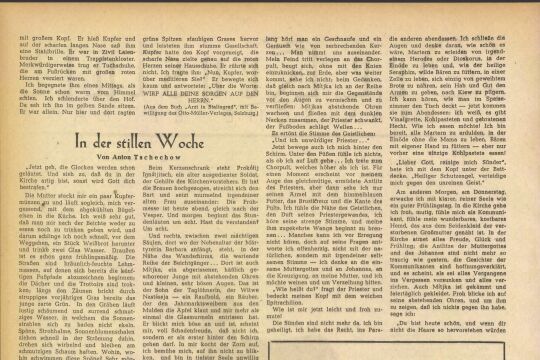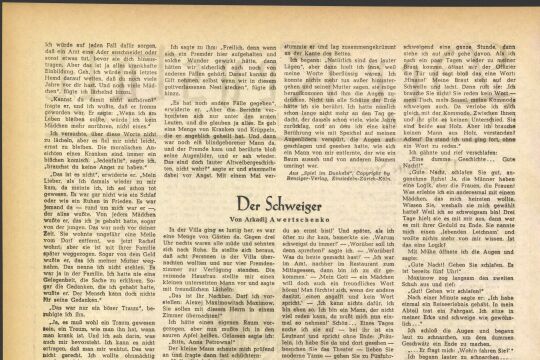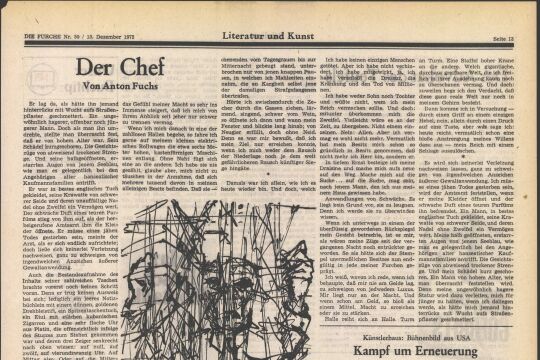Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Blick vom Kirchturm
Warum läßt Gott das zu? Ich denke die Frage, sage sie laut vor mich hin, ein-zweimal oder öfter, die Frage reizt mich, sie laut auszusprechen und zu wiederholen, wie den Frevler, der, wenn er einmal zu freveln begonnen hat, nicht mehr aufhören kann. Ich gehe die Kirchturmstiegen hinab, bleibe hin und wieder auf einem Absatz stehen, um zu lauschen oder an einer der wenigen Turmluken zwischen den Jalousien hinauszuspähen, gehe weiter, eine Hand am Holzgeländer, und vermeide die laut knarrenden Stufen; eigentlich knarrt jede Stiege, doch nicht gleich stark, und die laut knarrenden Stufen kenne ich, außerdem trage ich zu meinen Gängen auf den
Turm alte Schuhe mit einer weichen Sohle.
Ich bin seit siebenundzwanzig Jahren Pfarrer dieser Gemeinde, habe verschiedene Gewohnheiten angenommen, um die sich niemand kümmert, und eine außerordentliche Gewohnheit ist, außerhalb der Zeit der Gottesdienste durch die Tür der Seitenkapelle in die Kirche zu treten. Ich versichere mich, daß sich niemand im Kirchenraum befindet, sperre die Tür hinter mir ab, gehe durch das Mittelschiff zum Hochaltar, sehe mich um, ob alles in Ordnung ist, betrete auch die Sakristei, tue alles nur, um Zeit zu gewinnen und mich vom eigentlichen Plan abzulenken, dem ich aber dann folge, ein wenig an Sicherheit verliere, in den Turm gehe, stehenbleibe und lausche, ehe ich die Holzstiegen hinaufsteige.
Ich betrachte eine Zeitlang die dicke, giftgelbe Rauchsäule, die aus dem Schornstein steigt, die Dichte beibehält, wie geschoben wirkt, stellenweise durchlas-
sig und dünn wird, worauf der Schub nachläßt und einzelne Schübe erfolgen, ehe sie sich wieder zur Säule formen, die sich in einer gewissen Höhe auflöst, nachdem sie sich verbreitert hat. Weht der Wind, wird die Säule kurz nach dem Ausströmen erfaßt, zerstoben und in die Richtung getrieben, in die der Wind weht. Kommt dieser aus Südosten und ist er stark, treibt er den aufgelösten Rauch ins Dorf, und jedermann kann ihn riechen; es ist der unverwechselbare Geruch nach verbranntem Fleisch und verbrannten Knochen.
Ich besteige, aufgeschreckt durch den Geruch, den Turm, weiß nicht genau warum, denn die Erfahrung hat gezeigt, daß mir auch im Anblick des Ortes, dem der Rauch entsteigt, nichts weiter deutlich wird. Aber ich hoffe immer auf weitere Zeichen, die mir den Zweifel nehmen oder die Ängste bestätigen; das erstere trifft nicht zu, und somit bleiben die Ängste bestehen; man verbrennt in dem Schloß die Leichen der Menschen, die man vorher durch Gaseinwirkung getötet hat. Es sind Menschen, behaftet mit einem unheilbaren Gebrechen oder mit einer Geisteskrankheit, die man aus nah und fern hierher bringt oder Insassen aus einem Konzentrationslager, politisch oder rassisch nicht Geduldete.
Die letzte Gewißheit wird mir im Beichtstuhl zuteü. Der Ort, wird, außerhalb der Beichte, immer mehr dazu benützt, mir heimlich Nachrichten zukommen zu lassen, aber auch von Ratsuchenden, die mit den Erscheinungen der Zeit konfrontiert sind, wie im folgenden Fall.
Eines Tages kommt ein Mann in den Beichtstuhl, den ich nicht kenne, der nicht von hier ist. Er verlangt die Beichte, ich nehme sie ihm ab, und als ich ihm die Absolution erteilt habe und das Türchen zum Sprechgitter schließen will, drängt er das Gesicht ganz nahe an das Gitter und sagt eindringlich und sehr leise, er bitte noch um ein Wort. Es stellt sich heraus, daß er, vom Heeresdienst als untauglich zurückgestellt, im Schloß, in einer Kanzlei Dienst tut, und er bittet mich um Rat und Hilfe hinsichtlich des Tatbestandes, dem er ohne sein Wollen ausgesetzt sei, sagt er, zuzusehen, wenn auch indirekt, wie Menschen, Behinderte und Kranke, politisch und rassisch Verfolgte mit Kohlenmonoxyd getötet und ihre Leichen verbrannt werden, sagt er.
Ich frage nicht, lasse ihn reden, überlege, es könnte eine Falle sein, bereue im selben Augenblick, einem lauteren und bedrängten Mitmenschen Mißtrauen entgegengebracht zu haben und entschuldige vor mir selbst mein Verhalten mit den negativen Auswirkungen in dieser Zeit; es gebe gute Gründe, dem anderen zu mißtrauen, vor allem einem Mann in dieser Stellung, der sich gerade an mich wendet. Doch an wen soll er sich sonst wenden, eingedenk des Umstandes, wer ich bin und was ich darstelle und zu tun habe, nämlich Vertrauen zu erwecken in einer Zeit der Bedrohung.
Der Mann erzählt mir, was er auf dem Herzen hat, sein Mund ist noch immer am Holzgitter, als er erleichtert schweigt. Ich schweige ebenfalls, kann kaum einen Gedanken fassen, aber angeregt von seiner Offenheit, die ich erwidere, bringe ich mein Gesicht auch nahe an das Holzgitter und sage, es liege nicht in unserer Macht, hier gewaltsam einzugreifen, er müsse sich in Pein und Zweifel ganz der Fürsorge Jesu Christi anvertrauen und beten für die Opfer und für die Schergen, sooft es ihm möglich sei. Ich merke, daß er getrö-
stet den Beichtstuhl verläßt, bilde es mir wenigstens ein, ziehe den Vorhang über dem Glasfenster an der Tür ein Stück beiseite und sehe ihm nach; soweit ich den Mann von hinten beurteilen kann, ist er nicht mehr jung, sein Typ nicht alltäglich, der Hinterkopf bedeckt mit dichtem, grauem Haar. Ich bin erschüttert von der Begegnung und der nicht alltäglichen Erfahrung. So bleibe ich noch im Beichtstuhl sitzen, froh, daß niemand kommt, um die Beichte zu verlangen.
Seitdem, glaube ich, habe ich dort im Schloß einen Freund, und diese Gemeinsamkeit macht es mir leichter, das Wissen zu ertragen, dessen Tatbestand er mir darlegt und bestätigt hat.
Oft stehe ich hier und schaue durch die Holzjalousien der Luke im Glockenstuhl auf das Schloß hinunter, nur um immer wieder die Bestätigung des Dargelegten zu erhalten.
Die Bauernhöfe, große Vier-
kanter, die weit verstreut um das Schloß herum liegen, deren Bewohner ich kenne, sind von dichten Obstbaumbeständen umgeben, und der nächstliegende befindet sich in einiger Entfernung vom Schloß, sodaß die Leute dort, wenn sie nicht vorsätzlich das Schloß beobachten, wozu sie keine Zeit haben, die Vorgänge, die ich von hier aus sehe, nicht mitbekommen. Der eine oder andere, ich bin überzeugt, wird mißtrauisch sein, wagt es aber nicht, in Gesellschaft anderer etwas zu sagen, kaum anzudeuten. Zweifelsfreie Andeutungen macht man hin und wieder mir gegenüber, und ich reagiere in der Öffentlichkeit mit erzwungenem Gleichmut. Ist mir jemand, der solche Andeutungen macht, gut bekannt, nicke ich zustimmend und lege, wenn es die Situation erlaubt, den Finger an den Mund, was in Verbindung mit dem Nicken stille Zustimmung bedeutet. Ich bin überzeugt, daß viele nichts wissen, und auch
solche, die es wissen, nicht glauben können, ich hörte schon manchen leise sagen, er halte dies für unmöglich, worauf ich micht mit einem Stoßseufzer abwandte.
Die Rauchsäule wird dunkler, ich stehe fast zwei Stunden hier. Jetzt unterscheide ich drei Fußgänger, die sich auf der Landstraße von Osten nähern. Bisher konnte ich sie nicht deutlich erkennen, dachte auch an Einheimische, doch nun bin ich aufgeschreckt; ich habe das Gefühl, ich stünde den drei Menschen gegenüber, die immer schneller gehen; doch das ist eine Täuschung; ich kann ihre Bewegungen nur besser unterscheiden, je näher sie kommen, und bald jeden einzelnen gut sehen.
Vorne gehen zwei, dahinter geht einer. Vorne, das sind ein Mann und eine Frau, sie tragen Mäntel, und der hinter ihnen ist ein Uniformierter, das sehe ich, auch das Gewehr über seiner Schulter. Der Mann neben der Frau hinkt auf einem Bein, hält den Kopf gesenkt, auch die Frau, die hin und wieder aufblickt und in die Landschaft schaut, keiner scheint etwas zu sagen, die Schritte des Mannes sind schwer, sein Körper strafft sich, wenn er das Bein, auf dem er hinkt, hebt. Die Frau ist jünger und wirkt größer als der Mann, sie beugt sich nun zu ihm hinab und sagt etwas, worauf der Uniformierte den Kopf hebt und die Frau ansieht. Der Mann verhält seinen Schritt und wendet sich um, der Uniformierte deutet mit der Hand auf das Schloß, die Frau ist stehengeblieben, beschattet die Augen mit der Hand und läßt sie sinken, oder besser, sie fällt am' Körper herab, die Frau geht weiter, den Kopf gesenkt, der Mann holt sie ein, dreht sich aber nach ein paar Schritten zu dem Uniformierten um. Der Mann sagt etwas, der Uniformierte scheint ihm eine Antwort zu geben, die Frau ist inzwischen weitergegangen, ohne sich um die beiden zu kümmern, als gäbe es für sie keinen Grund stehenzubleiben und hinzuhören. Der Uniformierte faßt den Mann am Arm und veranlaßt ihn, weiterzugehen, worauf sich die alte Ordnung wiederherstellt. Noch immer hoffe ich, auch wenn ich weiß, daß es vergeblich ist, auf eine Veränderung, auf einen gewaltsamen Eingriff, bis die drei in die Zufahrtsstraße zum Schloß einbiegen.
Die Gewißheit, die doch zu erwarten war, überwältigt mich; ich schäme mich der kalten Beobachtung, bei der ich keinen anderen Gedanken aufkommen ließ, und der mich nun auf die Knie zwingt; ich hebe die Hände, sage laut die Segensformel, den beschwörenden Blick auf den Mann und die Frau gerichtet. Ich gehe die Stiegen hinunter, achte nicht auf die Geräusche, die ich mache, sperre die Tür in der Seitenkapelle auf und trete ins Freie.
Das Sonnenlicht, das von der gegenüberliegenden Friedhofsmauer reflektiert wird, blendet mich, ich gehe wie ein Traumwandler, eine Bereitschaft für alles in mir; so könnte ich ins Schloß gehen. Eine junge Frau, die an einem Grab steht, grüßt mich, ich nicke, sie schaut mich prüfend an, ich denke, ja man soll es nur merken, ein älterer Mann am Friedhof stor sieht zur Seite — es ist mir gleichgültig —, jemand, der weit weg ist, ruft, der ältere Mann wendet sich um — wie gezwungen er es tut, nur um mich nicht beachten zu müssen —, meine Beine tragen mich rasch weiter, bleiben vor der Tür zum Pfarrhof stehen, zwei Kinder grüßen mich und sehen mich sprachlos an, was mich zu mir selbst zurückruft; ich lächle den Kindern zu und nicke, ehe ich ins Haus trete.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!