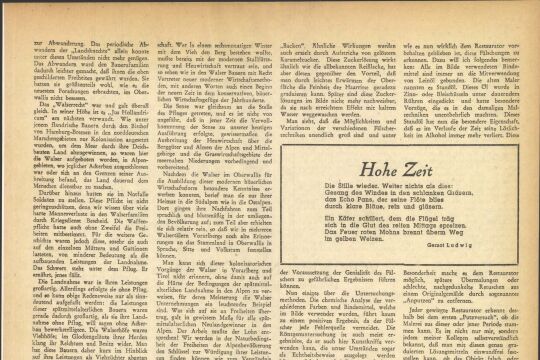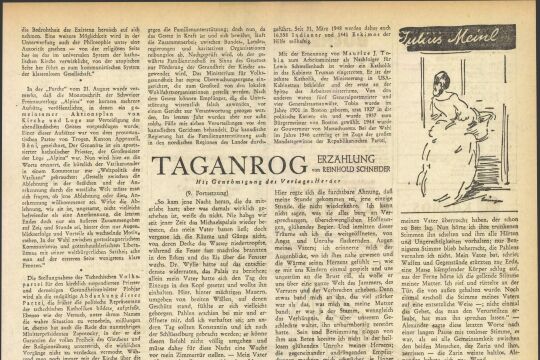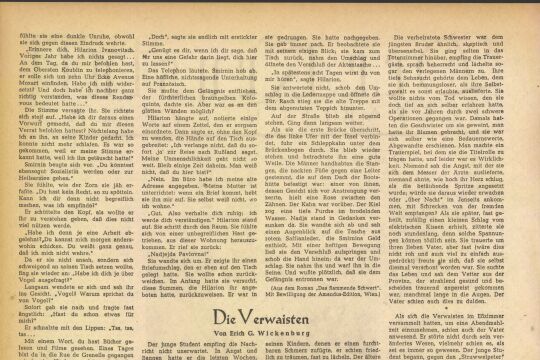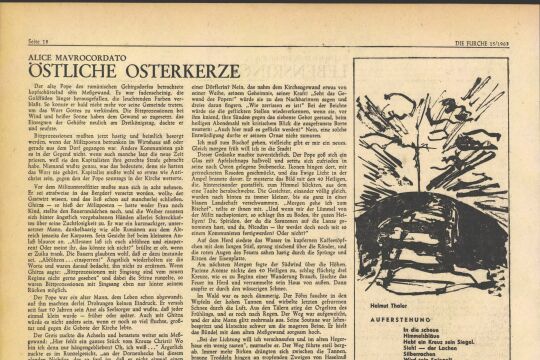Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Bruder von drüben
Der Psychiater hatte mir schon einige Fragen gestellt, um die Diagnose der endogenen Depression zu festigen. Er erkannte in gleichem Maße die Ursache in den harten Kriegs Jahren wie in der beruflichen Unrast der Gegenwart. Nun kam noch eine Frage: „Haben Sie Schuldgefühle?“
Ich stutzte, denn ich hielt mich für einen Menschen mit den üblichen Fehlern, aber Schuld im Sinne der bürgerlichen Moral oder gar des bürgerlichen Gesetzbuches lag einfach nicht vor. So erwiderte ich den festen Blick, von dem die Frage begleitet war: „Im allgemeinen: nein! Dennoch quält mich etwas, das ein Menschenalter zurückliegt, immer wieder. Ich glaube allerdings, daß ich heute in der gleichen Lage nicht anders handeln würde ...“
„Sie müssen deutlicher werden, wenn Sie sich ein wenig befreien wollen!“
„Ich habe einen Menschen getötet. Im Kriege zwar, wie es damals millionenfach geschah. Nicht freilich von Graben zu Graben, wofür Höhere die Verantwortung tragen mochten, sondern es war ein Mann, der sich bereits in Gefangenschaft befand. Mich entschuldigt dabei keineswegs die Tatsache, daß ich vorher wie nachher Gefangentötungen seitens der damaligen Gegner aus einiger Entfernung erleben mußte, sondern nur mein übergroßes Mitleid für einen Unrettbaren. Aber innerlich frei werde ich davon nicht, ein Leben, und sei es für Minuten, verkürzt zu haben.“
„Erzählen Sie, wenn es Sie erleichtert. Sie sind heute der letzte Patient. Wir können uns ein wenig Zeit nehmen. Seien Sie mainer ärztlichen Verschwiegenheit gewiß!“
Und so berichtete ich denn: Es war August 1943. Seit drei Tagen tobte an der Minusfront eine neue Schlacht. Der starke Feind war mit Übermacht eingebrochen und die neue Sechste Armee hatte große Mühe, diesen Einbruch abzuriegeln. Vor achtundvierzig Stunden hatte es für uns Alarm und einen nächtlichen Anmarsch gegeben. Statt auszuschnaufen, war es am Montag in Steppenglut kilometerweit in geöffneter Ordnung dem „Iwan“ entgegengegangen, von dem man nicht wußte, wie weit er im Schutze der unübersichtlichen Balkas vorange-gekommen war. Dürres, kniehohes Gras in der erbarmungslosen Mittagssonne im Klima des Asowmee-res. Kein Schluck Wasser!
Von einer Anhöhe aus sahen wir endlich den einstigen Divisionsgefechtsstand Alexejewka vor uns lie-
gen. Das Dorf lag in unheimlicher Ruhe, langgezogen in Maisfelder gebettet.
Kurzes Rasten. Ein Kradmelder war herangeflitzt: „Regimentsbefehl! Alexe jewka ist sofort zu nehmen. Feindstärke unbekannt. Granatwerfer geben Feuerschutz!“ Es schien ein Himmelfahrtskommando zu sein, doch jedes Zögern war sinnlos. Kurze Befehle! Es ging dann wie auf dem Übungsplatz. Erst die letzten siebzig Meter über freies Stoppelfeld waren ganz unverschämt von der feindlichen „Ari“ eingedeckt worden. Der offensichtlich nur schwache Feind hatte den Ort fluchtartig verlassen. Ein defektes Feind-MG lag unter einem Pflaumenbaum,
dessen Früchte uns im Vorbeigreifen labten. Nicht ein Mann war ausgefallen.
Da jagte ein Beiwagen-Krad herbei. Der Ordonanzoffizier sprach uns sein Lob aus, überbrachte aber gleichzeitig den Befehl, sofort nach Osten Anschluß zu suchen und eine fast aufgegebene Panzerabwehrgruppe schützend zu umigeln. Wir alle fluchten erschöpft, doch Befehl war Befehl. Ein eigener Stukaangriff kam uns zunutze, und wir schafften es noch einmal.
Vierundzwanzig Stunden lagen wir dann schon in dieser Hölle. Noch konnten wir standhalten, obwohl es ein richtiger Dauerfeuerzauber war. Noch immer bestand leidliches Gleichgewicht, aber sehr schmerzliche Verluste waren unter meinen Leuten eingetreten. Mancher meiner braven Kerle lag tot in oder neben seinem Schützenloch. Es gab weder Schlaf noch etwas zu trinken. Das Küchenfahrzeug konnte erst nachts nach Alexejewka kommen. Mancher Verwundete war zurückgerobbt, mitten durch die Unsicherheit des Zwischengeländes.
Plötzlich schrie ein Mann halblinks
hinter uns ganz hysterisch: „Herr Leutnant, Panzer, Panzer! Sie sind durchgebrochen!“ Schon rasten, aus unserem eigenen Hinterlandsdorf Alexejewka kommend, vier T 34 auf unsere Stellungen zu. Ich zeigte mehr Ruhe, als ich besaß und brüllte: „Leute, hinein in die Löcher! Hier stehen doch unsere Panzerjäger!“
Stur richteten diese ihre Rohre gegen die Eindringlinge. Da brannte einer, dort ein zweiter, ein dritter entkam, doch ein vierter kam gerade durch eine leicht versumpfte Ebene auf uns zu. „Ruhig Blut! Liegen bleiben!“ brüllte nun der Panzerjägerleutnant, „der gehört auch uns!“ Er visierte kaltblütig an. Atemraubende
Detonation. Der Koloß stellte sich auf wie ein wütender Stier und blieb bewegungsunfähig liegen. Bald hob sich ein Arm aus der geöffneten Turmluke.
„Feuer einstellen!“ rief ich meinen Leuten zu, die sofort zu ihrer Waffe gegriffen hatten, „sie geben sich gefangen!“ Ein Hüne stieg aus, ein zweiter Mann folgte und beide blieben mit erhobenen Armen stehen. Wir winkten Gewährung.
NUn tauchte der Lange, von uns mißtrauisch beobachtet, in den Stahlkörper zurück und zog mit aller Kraft einen Kameraden heraus und bettete ihn neben dem Panzerwrack ins Steppengras. Es war der Fahrer. Sein Unterleib war von einer Pakgranate zerfetzt worden.
Die Gefahr in unserem vorgeschobenen Stützpunkt blieb weiterbestehen. Nach dem Panzerschreck wies ich die Männer auf ihre Plätze zurück. Die beiden unversehrten Gefangenen ließ ich durch einen beherzten Mann zu unserem Bataillonsgefechtsstand zurückbringen, falls es ein Durchkommen gäbe. Der todwund geschossene arme Kerl aber lag traurigen Blickes vor mir. Er wußte um den Tod, dem er als Panzermann schon oft ins Auge gesehen haben mochte. Sicherlich hatte er fürchterliche Schmerzen, doch wies er Bemühungen meines Sanitätssoldaten mit einer verzichtenden Handgebärde zurück. Hier gab es nichts mehr zum Verbinden. Kein Wort fiel zwischen uns, denn keiner beherrschte die Sprache des anderen. Unweit unserer Toten würde auch er bald ein toter Mann sein.
Der Sanitätsgefreite Hahn war im bürgerlichen Leben Pastor. Er sah mich fragend an, ich aber schwieg.
„Herr Leutnant, wir müssen ihm helfen, er leidet unmenschlich!“ Ich zuckte mit den Schultern: „Wir können ihn vor dem Abend nicht abtransportieren, Hahn! Wir haben selbst zwei Schwerverwundete, die die Dämmerung herbeisehnen. Aber bei denen ist wenigstens noch Hoffnung. Wer weiß, wie lange der Iwan bei einer solchen Wunde zu leben haben wird. Geben Sie ihm eine Spritze zur Linderung!“
„Ich habe nichts mehr. Alles aufgebraucht. Wir müssen ihn mit einem Gnadenschuß erlösen!“ Bitter rief ich ihm zu, als ob ich in ihm das Ethos des Abendlandes anklagen wollte: „Du sollst nicht töten! So heißt es doch in den Zehn Geboten?“
„Herr Leutnant, wir töten als Soldaten Tag um Tag, Stunde um Stunde, und wir berufen uns dabei auf ein anderes Gesetz.“
„Hahn, der Mann hat sich uns gefangengegeben. Das Rote Kreuz schützt sein restliches Leben, selbst
wenn die Sowjets der Genfer Konvention bis jetzt nicht beiget, .ten sind.“
„Dieser Mensch kann von keinem Arzt mehr gerettet werden, nicht einmal seine Schmerzen kann ich lindern. Handeln wir also barmherzig an ihm nach einem anderen Gotteswort: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! Ich müßte herausbrüllen und wäre nicht so tapfer wie dieser Iwan. Er wird uns dankbar sein dafür.“ .
Ich nickte ihm schließlich zu. Der Todwunde bettelte wirklich mit einem Blick, in dem Staunen und Todesverachtung gemischt war, Schluß zu machen. Er war keiner von den jüngsten mehr und mochte an Weib und Kinder denken, die er nicht mehr sehen durfte.
So bückte ich mich denn zu ihm nieder und streichelte ihm die fahle Wange, als gerade wieder eine Schmerzwelle seine Zähne zusammenpreßte. Seine Augen dankten schwach für die Liebkosung. Mein Entschluß war herangereift. Ich zeichnete mir, wie in Kindertagen gelernt, das Kreuz auf die Stirne und
tat es dann ihm, als ob ich ihm ein Sakrament zu spenden hätte, und siehe da, auch er bekreuzigte sich in der Weise des Ostens. Dann trat ich hinter ihn und löste den Schuß aus meiner Pistole. Er traf die Mitte des kahlgeschorenen Schädels. Ohne Zuckungen sank das Haupt zurück.
„Du hast getötet!“ schrie eine Stimme in mir. „Sie waren barmherzig!“ sagte mir der Gefreite und legte ganz unsoldatisch seinen Arm auf meine Schulter, als ich, selbst zum Umfallen müde und leicht verwundet, am Leichnam des feindlichen Panzerfahrers vorbei zu meinen Posten weiterging.
Ich dachte in dieser kurzen Kampfpause an die Mutter, die ihn geboren, und an die Frau, die ihn geliebt, nicht minder als an meine Mutter und an mein Weib und an meinen Bruder, der an der Nordfront stand. Und ich wußte dann, daß ich ihm in solcher Lage den gleichen Liebesdienst, wenn auch blutenden Herzens, erwiesen hätte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!