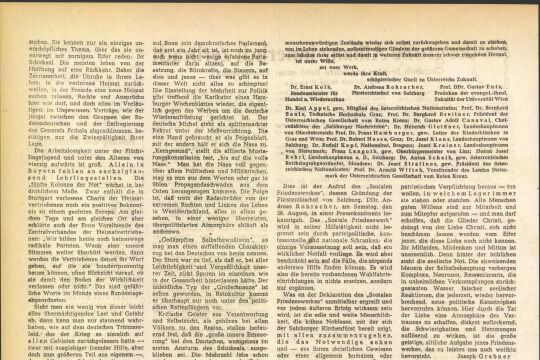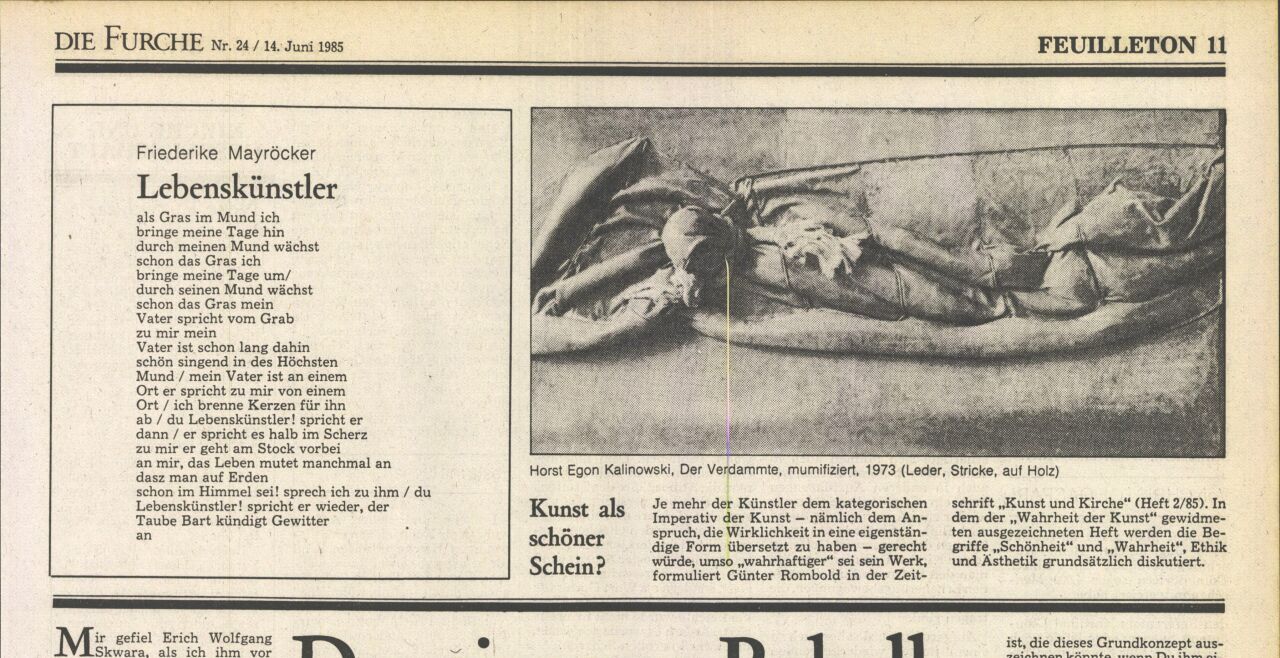
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der einsame Rebell
Mir gefiel Erich Wolfgang Skwara, als ich ihm vor acht Jahren bei einer Lesung in der österreichischen Botschaft in Washington zum erstenmal begegnete. Er war umgeben von schönen Frauen und vom kosmopolitischen Flair der literarischen Welt; er las aus seinem Buch „Pest in Siena”, und der Abend grub sich in meine Erinnerung ein.
„Pest in Siena” ist der Roman eines sterbenden Kontinents, des abendländischen Kontinents, und der Autor zelebriert die „wunderbare, die herrliche Inszenierung” seines Niedergangs. Mich bestachen die mitleidlose Abrechnung mit liebgewordenen Klischees, das Durchbohren glatter gesellschaftlicher Oberflächen und polierter Seelenfassaden und nicht zuletzt die melodiöse Bilderkraft seiner Sprache, die er nach vielen Jahren des Aufenthaltes in den USA ganz frei von Anglizismen gehalten hat. Aber ich rebellierte gegen seine pessimistische Weltsicht, gegen die unverhohlene Freude an Dekadenz und Verfall, auch gegen die Verherrlichung von Jugend als Inbegriff von Unschuld, der man, weil der Schönheit verschwistert, „fast alles verzeiht”.
Und die Jungen, die nicht schön sind? Und die Alten, die sich an der Dekadenz Europas nicht freuen können? Und a^ jene, die den Untergang einer Epoche nicht gleichsetzen mit dem Untergang einer Zivilisation oder gar der Welt?
Ich schickte diese Fragen dem Autor nach Ellicott City in Maryland nach, und es entwickelte sich ein sich in Richtung Freundschaft tendierender Diskurs zwischen einem Dichter, der interessiert an Reaktionen, und einem Journalisten, der eingenommen für ein Sprachzeugnis war, das über den Tag hinaus Bestand verhieß.
Erich Wolfgang Skwara ist ein Sinnenmensch — eine der vielen starken Eigenschaften an ihm. Ich weiß nicht, ob er den Ausspruch von Anton Wildgans kennt, wonach der Friede der Welt auf dem Frieden der Sinne baut. Ich glaube daran, und ich weiß daher, wie oft Erich Wolfgang Skwara beim Essen, Trinken und Lieben Weltfrieden gestiftet hat. „Trinken is Einswerden mit der Erde”, lesen wir in seinem Roman „Schwarze Segelschiffe”, wo Tristan auch die lässige Verurteilung jeglichen Berufes als „abscheuliche Prostitution” proklamiert.
In jedem der Skwara-Romane steckt ein Stück Autobiographie. Das schließt den Hinweis - in seinem soeben erschienenen Roman „Bankrottidylle” - auf die Notwendigkeit einer Schonung seines Lebens mit ein, und ich verrate damit nichts aus dem Intimbereich des Dichters, hat der doch seinen Don Juan im Buch „Pest in Siena” selber sagen lassen, er verachte die Schriftsteller, die ihre Charaktere und Geschichten frei erfinden. Skwara verachtet sich als Schriftsteller nicht.
Wir dürfen also annehmen, auch er habe keine übertriebene Vorliebe für feste Berufe, Schreibtischfron und gesellschaftliche Rituale. So werden wir ihm andeutungsweise wohl auch in Georg Robert Knabe begegnen dürfen, der Hauptperson der „Bankrottidylle”, der als Europäer im Fakultätsstab der amerikanischen Cheat University den Auftrag erhält, eine Million Dollar herbeizuschaffen oder die Ab-
Schaffung seines Lehrstuhls zu erleben. Er schreibt — dies der Roman - seinem Dekan einen Brief, warum er sich, je mehr er über diesen absurden Auftrag nachdenkt, immer mehr als fleischgewordene „stolze Verweigerung” fühlt, „mitzumachen bei diesem gemeinen Spiel” - was er freilich dann doch in gewisser Weise tut, frivol wie auch andere Skwa-ra'sche Romanhelden. Auch ein gutes Stück Snobismus, Hang zur Hochstapelei - auch noch im zynisch beschlossenen Spiel mit dem Ende — fehlen nicht. Derselbe Held hat zuvor noch die „veralteten Forderungen” verlacht, „die uns zur Rechenschaft ziehen wollen für unser Handeln, für unser Herz”; hat uns die freche Behauptung ins Gesicht geschleudert, „daß nur Egoisten über den Durchschnitt hinauswachsen”; hat sich zu einem Rassismus besonders bösartiger Natur bekannt: zum Rassismus, „der gegen die Rasse Mensch gerichtet ist, gegen den Menschen, den ich nicht lieben kann, bevor er nicht einige Änderungen im Grundkonzept erfährt...”
Was ist, Erich Wolf gang, mit denen, die Du selber sehr wohl zur Rechenschaft ziehst, den ganzen Roman hindurch? Was ist, Erich Wolfgang, mit den Nichtegoisten an Deiner Wiege, an Deinem Herd, an Deinen vielen Wegen? Warum willst Du, Erich Wolfgang, den Menschen in seiner Grundkonttruktion geändert sehen, von dem Du dennoch bekennst, daß Du ihn „anfassen und besitzen” möchtest „mit der qualvollen Gier des Süchtigen”? Warum willst Du den Menschen abschaffen, dessen Schönheit Dich immer wieder überwältigt? Warum willst Du „die Raserei der Sinne” nicht „durch Liebe stören lassen”, wenn es vielleicht die Liebe ist, die dieses Grundkonzept auszeichnen könnte, wenn Du ihm eine Chance ließest?
Ich ertappe mich also wieder bei den vielen Fragen einer ambivalenten Reaktion auf einen Skwa-ra-Roman, die mir notwendig erscheint. Ich ertappe mich ebenso aufs neue als Gefangener jener Verführung, die allen seinen literarischen Werken anhaftet. Wie, wenn er ein Zerrissener wäre und ich auch? Wenn er mehr brutale Ehrlichkeit aufbrächte mit sich und der Welt als ich mit der Welt und mit mir selbst? Wie, wenn sein Zynismus wahrer als mein Rigorismus wäre? Wenn er recht mit der Behauptung hätte, daß man gleichzeitig ein schwieriger Mensch, und ein simpler Geist sein kann? Wie, wenn auch von mir gälte, was der idyllische Bankrotteur von sich bekennt: „Man irrt sich im Tonfall ein Leben lang”? Wie, wenn in seiner Selbstbezichtigung „Ich hätte mich nicht so weit von den Wurzeln entfernen sollen, wenn diese auch faulig waren” mehr Demut steckte als in meinen Fragen, Erich Wolfgang?
Dieser Dichter, er sagt es selbst von sich, ist eine ständige Irritation. Er gibt einem in aufdringlicher Weise zu denken. Aber was sonst sollte ein Dichter geben? Er schafft Unruhe in jener Seele, von der er zutreffend behauptet, daß Europa mit diesem Begriff „Schindluder treibt seit urdenkli-chen Zeiten”. Aber was sonst sollte ein Dichter schaffen?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!