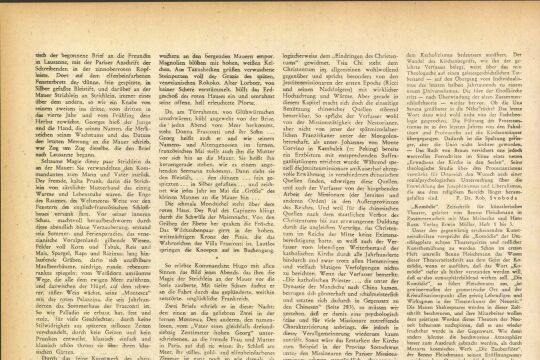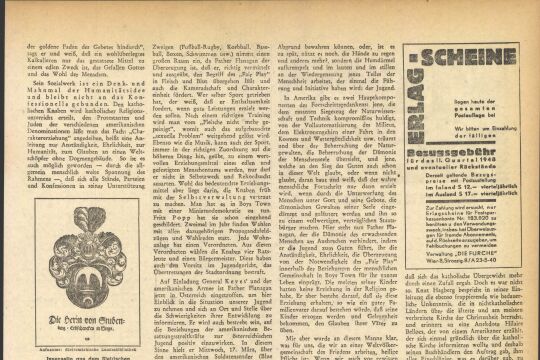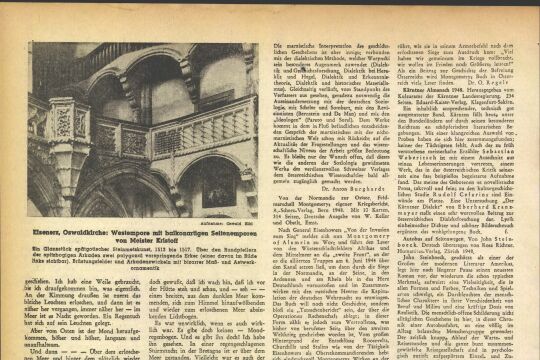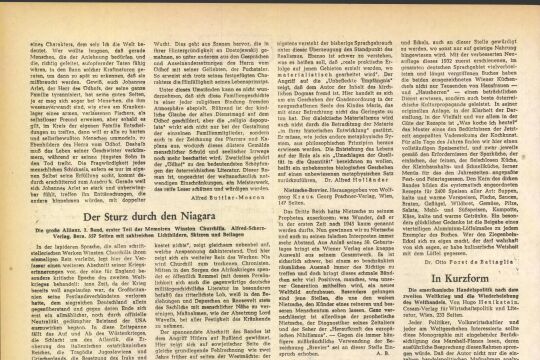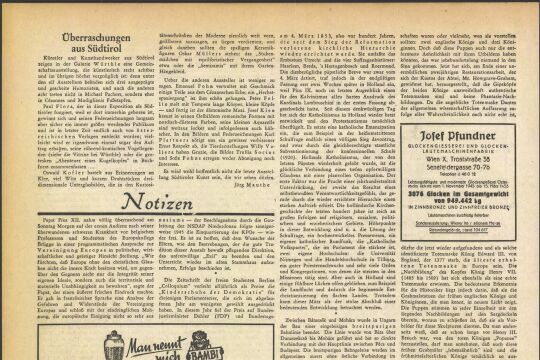Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Fall des Bruce Marshall
Von Sigmund Freud stammt der Verdacht, wonach der Verlust des menschlichen Schamgefühls ein Anzeichen des Alterns ist. Dieser Lehrsatz des Psychiaters soll im Falle des nunmehr 73 Jahre alt gewordenen Autors des hier besprochenen Buches nicht direkt auf die Person des Dichters angewendet werden. Zur Diskussion steht eine bedeutendere Frage: Nämlich, ob nicht Bruce Marshall in seinen letzten Büchern jene Symptome der Vergreisung abgesunkener und absinkender Eliten und ihrer Kultiviertheit aufzeigt, die es nicht zuwege bringen, mit Anstand alt zu werden. Die vielmehr Ihre Dekadenz mit jenem jugendlichen Make-up versehen, das ihnen gestatten soll, inmitten der Zwanzigjährigen die sexuelle Revolution jüngster Tage mitzumachen.
Bruce Marshall bringt für seinen Status praesens fast alle diesbezüglichen Voraussetzungen mit. Dem schottischen Infanterieoffizier des Ersten Weltkrieges, der als Heimkehrer zum Katholizismus übertrat, anstatt anglikanischer Geistlicher zu werden, hat man in den fünfziger Jahren den ironischen Stil, mit dem er die Probleme der Kirche in einer undogmatischen Form anging, gern honoriert. Eine Reform der Kirche war fällig und warum sollte nicht ein katholischer Autor Bestseller werden, der die Runzeln und Falten der Mutter Kirche doch offensichtlich mit der Absicht aufzeigt, dafür rechtzeitig noch die richtige Kosmetik zu finden. Was dabei an Tiefgang abging, ersetzte „menschliche Wärme“ und da bis unlängst die Kirche von Bruce Marshall in jedem seiner Bücher schließlich im Dorf gelassen wurde, überlasen seine Fans die längste Zeit Passagen, in denen der Dichter etwas als katholisch sein sollend herausstellte, was in Wirklichkeit sein höchstpersönlicher Mischmasch grundsatzloser Lebensphilosophie war. Trotzdem: Der Weg, den Bruce Marshall vom „Wunder des Malachias“ (deutsch 1950) bis zum „Silvester in Edinburgh“ (deutsch 1973) zurückgelegt hat, ist weit und das Finale des Dichters und seines Lebenswerks für den Leser tragisch, der nicht eine zeitbedingte Symptomatik realisiert und für sich den Schluß daraus zieht. Der Unterschied zwischen dem Wunder von 1950 und dem Silvester von 1973 ist so groß und so bedrückend, wie der Vergleich des schottischen Infanterieoffiziers von 1918 mit dem Kasinohistörchen erzählenden Exzahlmeister aus der hintersten Etappe des Zweiten Weltkriegs, wovon Bruce Marshall hic et nunc einen Absud liefert. Noch einmal kommen jetzt zu Silvester der junge Soldat, der Börsenmakler, der Wirtschaftsprüfer und der alternde Suitier zu Wort. Aus den Erfahrungen dieser Epochen seines eigenen Lebens mixt der Autor ein Geschehen, das während eines halben Jahrhunderts einen Mittelpunkt hat:
Diesmal liegt dieser Mittelpunkt bereits fernab von Pfarrhöfen, einsamen Priesterwohnungen und Kirchen. Am Silvestertag der Menschheit des Bruce Marshall scheinen die Kleriker und ahre Betriebsstätten nur noch als Episodisten und Hintergrund auf. Inmitten dieses Spiels von Lüge und Inkompetenz bewahrt zuletzt nur noch der anständig gebliebene, nichtkonvertierte Frontkamerad und Geistliche nichtkatholischer Konfession dank Frontdienstleistung und hinlänglichem stillschweigenden Verständnisses für die sexuellen Probleme und Erlebnisse der übrigen Heimkehrer-Crew von 1918 ein Profil. Für den „Rest“ ist ein Stundenhotel in Edinburgh quasi Girozentrale einer endlosen Serie von Akten der Promiskuität, wobei der Autor in der Beschreibung der Wahlfreiheit der sexuellen Beziehungen nicht gerade zimperlich, sicher aber nicht so leserwerbend ist wie das, was jüngere Porno-schriftsteller als „zeitkritische Ausleuchtung“ der bürgerlichen Welt verhökern. Während in Bruce Marshalls vorletztem Werk („Der Bischof“, deutsch 1970) der unter dem Eindruck der Enzyklika „Humanae vitae“ anarchistelnde Autor einen zölibatsmüden Generalvikar und eine dem Kloster entlaufende Nonne noch knapp vor einem Finale im gemeinsamen Weekend auf die Bremsspur bringt, zögert er jetzt zu Silvester nicht mehr zu sagen: Für die Kirche ist Matthäi am letzten.
Der letzte Überlebende der fraglichen Heimkehrer-Crew von 1918 genießt noch einmal die Reparatur seines fleischliohen Daseins in einer Klinik; nicht zuletzt unter den Händen einer „umwerfend hübschen Masseuse“ die „auch Privatpatienten“ nimmt und die dem ein bißchen von Ga-ga befallenen alten Herren bewußt macht, daß es „älteren Herren lieber (ist), wenn (sie) sie in der Wohnung besucht“. Und also läßt Bruce Marshall seinen Helden den Beschluß fassen, besagte Masseuse zu seinem „viaticuim“ aus dieser Welt zu machen; noch einmal beißt er die Zähne zusammen und findet so den „einzigen Ersatz für eine Kirche, die versagt“ hat.
Moderne Romanciers, zumal solche katholischer Herkunft, finden heutzutage kaum noch ein „Tabu“, das nicht vorher bereits ein noch modernerer und findigerer Kollege aufgebrochen hat. Mary McCarthy, Output der katholisierenden Periode in den USA, mußte in ihrem unlängst in deutscher Übersetzung erschienenen Spätling „Bilds of America“ (London, 1971) zu einer subtilen Schilderung der technischen Ausrüstung sowie der Formen der Benützung von Aborten Zuflucht nehmen. Dabei beweist die Amerikanerin einen Reichtum an technologischen Kenntnissen, der sowohl einem Spenglerlehrbuam als auch einer langjährigen Abortfrau alle Ehre machen könnte.
In sogenannten hochkonservativen Kreisen sind derlei Hinweise samt Textproben ebenso unerwünscht, weil degoutant, wie die simple Feststellung, daß es heute katholische Geistliche gibt, die „amtieren“, bis sie ihrer Pension sicher sind. Um nachher nicht nur die Soutane an den Nagel zu hängen, sondern beim Magistratischen Bezirksamt ihren Austritt aus der Kirche anzuzeigen. Jeder performiert seinen Austritt in seiner Manier. Bruce Marshall eben den seinen — ich meine den aus einem guten Regiment, in dem er einmal gedient hat. j
SILVESTER IN EDINBURGH. Von ! Bruce Marshall. Hoffmann und j Campe, Hamburg 1973. 332 Seiten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!