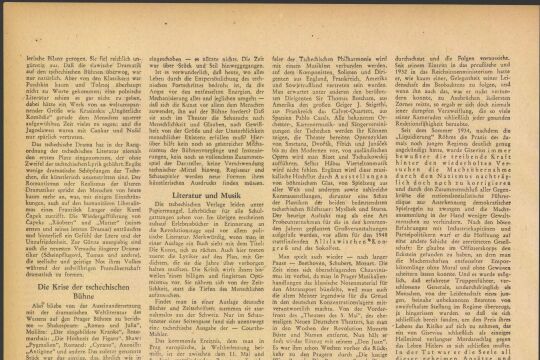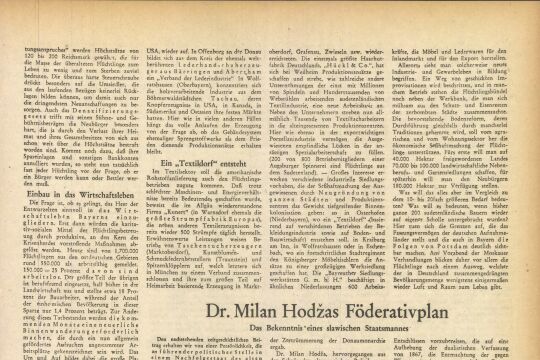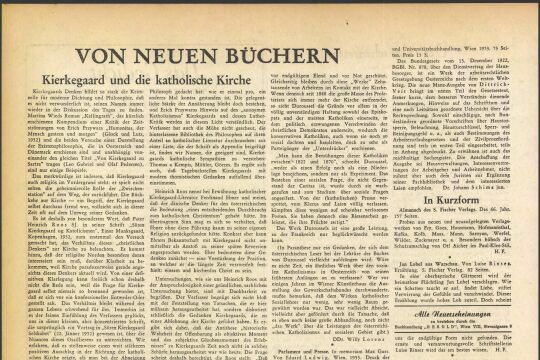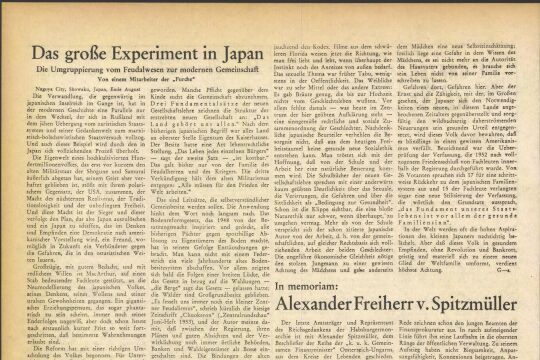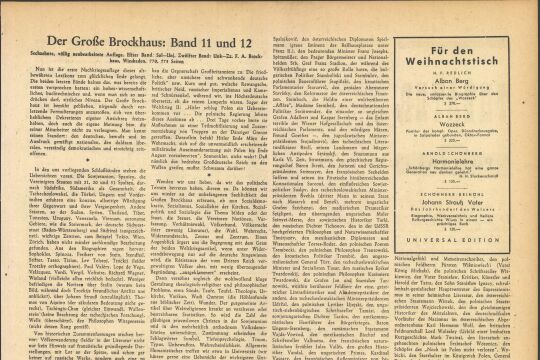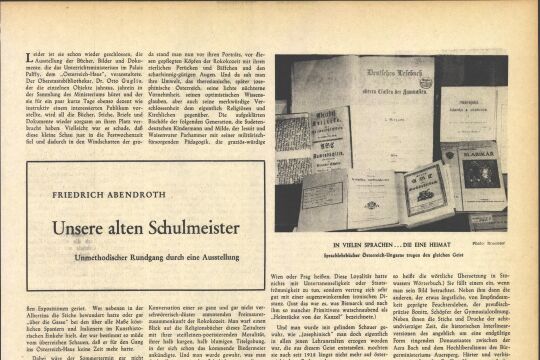• „Wann i a Büachl siech, hob i scho gfressn!“ (Von zahlreichen Autoren als Ausspruch des christlichsozialen Politikers Hermann Bielohlawek zitiert.)
• „Das Image einer Person (Personengruppe) oder Sache ist die Gesamtheit der Vorstellungen und emotionellen Einstellungen, die sich mit der in Frage stehenden Person (Personengruppe) oder Sache verbindet. Das Image kann bewußt gemacht werden, zum Beispiel das Image eines Politikers usw.“ (Wörterbuch englischer und amerikanischer Ausdrücke in der deutschen Sprache.)
Seit zwei Generationen kennt man in Österreich einen Namen, der mit einem Wort ausdrücken soll, was man ansonsten mit wortreichen Anklagen gegen kleinliches Spießbürgertum, intolerante Geisteshaltung und ausgesprochene Bildungsfeindlichkeit zu sagen pflegt. Indem man eine bestimmte Personengruppe (Beispiel: eine politische Partei) oder eine Sache (Beispiel: Gegenstand einer Wahlentscheidung) mit der üblichen Vorstellung vom „Geist des Bielohlawek“ verbindet, distanziert man sich selbst davon, beansprucht man für sich: Weltoffenheit, Toleranz, Bildung. Wer auf Bielohlawek abzielt, nimmt teil an der landesüblichen Raunzerei nach dem Schema: So etwas kann doch nur in Österreich passieren. Menschen, die von Haus aus gewohnt sind, sich auf ihre fortschrittliche oder konservative, gut bürgerliche oder linksradikale Herkunft und Anschauung etwas zugute zu halten, haben, indem sie besagten Geist feststellen, hinlänglichen Grund dafür, mit nobler Distanziertheit zu sagen: Also damit hat unsereins nichts zu tun.
Wer war der Bielohlawek?
Hermann B. (1861 bis 1918) stammte aus der Wiener Vorstadt. Sein Vater war Schlossermeister. Er fing auch als Schlosserlehrbub an, wurde aber dann das, was man in Wien damals einen „Budelhupfer“ nannte. Nachdem er auch die Handelsschule besucht hatte, lernte er in der Standesorganisation der Handelsangestellten den späteren Abgeordneten Dr. Julius Axmann kennen. Der Akademiker imponierte dem B., die Methoden des Axmann kamen aber später weder der christlichsozialen Bewegung noch dem B. zugute. Mit 28 Jahren war B. schon Vizepräsident des Vereines der Handelsangestellten, das Jahr darauf Vorstandsmitglied der Gremialkrankenkasse. Nachdem B. bereits in jungen Jahren in der „Wiener kaufmännischen Zeitung“ geschrieben hatte, wurde er 1899 Herausgeber der Wochenzeitung „österreichische Volkspresse“ und blieb es bis zum Tode. Von 1897 bis 1911 gehörte B.’ mit Unterbrechungen dem Abgeordnetenhaus an; von 1906 bis 1918 dem Wiener Gemeinderat; von 1905 an führte er bis zum Tode im niederösterreichischen Landesausschuß als Mandatar die Referate Wohlfahrtswesen und Gewerbeförderung.
Der Tag, an dem B. sein bleibendes Image bekam, war der 6. Mai 1898. Im Abgeordnetenhaus griffen Christlichsoziale und Sozialdemokraten die Regierung wegen des „Kornwuchers“ der Getreidehändler an. Der von der Kurie des Großgrundbesitzes als Abgeordneter gewählte liberale Handelsminister Dr. Baernreither konnte sich aus der bald uferlosen Polemik heraushalten. Um so wilder gerieten die beiden Fraktionen aneinander. B. tat sich dabei als Zwischenrufer hervor. Um den wahren Wortlaut dieser Wortgefechte zu erfahren, ist es zunächst notwendig, in den stenographischen Protokollen des Abgeordnetenhauses (1898, Band 1, Seite 1176 ff.) nachzulesen. B. nahm insbesondere einen sozialdemokratischen Sprecher aufs Korn, der sich bei dieser Gelegenheit wie jener Typ des Parlamentariers gab, der besonders gründliches und detailliertes Sachwissen dartut, indem er häufig Zitate gebraucht und auf Bücher oder Fundstellen in Büchern nach Art einer Vorlesung hinweist. Als der Sprecher wieder theoretische Ansichten und die dazugehörigen Ausführungen, die ein Professor in einem „umfangreichen Buch“ niedergelegt hatte, als besonders lesenswert hinstellte, fing die Serie der Zwischenrufe an:
Erster Zwischenruf des B: „Schon wieder ein Buch, das hab’ ich schon gefressen!“ Und nach Zwischenrufen von verschiedenen Seiten wieder B.: „Lesen kann ja jeder! Aber Sie können nur lesen, sonst gar nichts! Erzählen Sie einmal, was Sie selbst wissen, nicht immer, was Sie gelesen haben!“ Darauf der Sprecher: „Schauen Sie, Herr Kollege Bielohlawek, ich kann wahrhaftig nichts dafür, daß Sie eine solche Scheu vor Büchern haben.“
Mit diesem dialektischen Kniff machte der von B. Herausgeforderte den ursprünglich in einem ganz anderen Sinn gebrachten Zwischenruf zu einem scheinbar fatalen Eingeständnis des B. In jener Zeit, in der es weder Hörfunk- noch Fernsehreportagen aus dem Parlament gab, hing es von den Tageszeitungen ab, ob einer der unzähligen Zwischenrufe in der Öffentlichkeit vermerkt wurde und was daraus in der öffentlichen Meinung wurde. Friedrich Funder, damals junger Parlamentsreporter der „Reichspost“, erfaßte den Kem der Polemik wahrscheinlich richtig: B. wollte die eigene Meinung des Sprechers hören, nicht aber das, was vorher andere geschrieben hatten. Die „Arbeiter-Zeitung“ machte die Replik des sozialdemokratischen Abgeordneten („der bücherscheue B.“) zu einem Zwischentitel ihres Parlamentsberichts, begnügte sich aber im redaktionellen Teil mit einem eher gutmütigen Spott. Das bewußte Image fixierte die „Neue Freie Presse“: Sie legte dem B. Worte in den Mund, die dieser nicht gebraucht hatte („Bücher lese ich nicht“) und sie verdrehte dem B. das Wort im Mund („Lesen ist keine Kunst“).
Das Gerücht wächst mit der Entfernung
Mit der Zeit wuchs das ausgestreute Gerücht an Bedeutung. 1911 hielt Josef Redlich den B. und „das ganze ungebildete ,lot’ (= Haufen)“ in dem Sinn geradezu für „wahlentscheidend“, als dieser Haufen daran schuld gewesen sein soll, daß sich die „allgemeine Abneigung“ gegen die Christlichsozialen wandte und viele „anständige und gebildete Menschen“ dieser Partei bei einer Wahl die Stimme versagten. Redlich, später selbst Minister, war aber redlich genug, auch jene zu nennen, die besagte Abneigung unter die Menschen gebracht hatten und jene, die davon den Nutzen hatten: die liberale Presse und die Gegner der Christlichsozialen, diesmal vor allem die Freisinnigen.
Das ominöse Zitat überlebte den B. und auch das Ende der christlichsozialen Partei im Jahr 1933. In seiner grundlegenden Darstellung des Parteienwesens (1955) und in einem 1960 gehaltenen Vortrag hat Adam Wandruszka festgestellt, daß die Gegner der Christlichsozialen immer dann, wenn sie diese als „übelste Dunkelmänner und Kulturbanausen“ hinstellen wollten, regelmäßig den B. zitierten und zitieren. In dieser Hinsicht reflektiert auch Jacques Hannak in seiner Renner-Biographie (1965) auf den B. und rechnet ihn zu jenem Typ eines „rabiaten, wild um sich schlagenden, ziellosen und kulturlosen Kleinbürgertums“. Was Wandruszka eher als Tendenz gegnerischer Polemiken in Betracht zieht, ist für Friedrich Heer authentisch und, gestützt auf Rudolf Henz, geradezu „vielen Verantwortlichen aus der Seele gesprochen“.
Heer übergeht dabei kritiklos Friedrich Funder, der nicht nur selbst Zeuge des Vorfalles im Jahr 1898 gewesen ist, sondern fünfzig Jahre nachher in seinen Erinnerungen „Vom Gestern ins Heute“ wünscht, die Christlichsozialen hätten es auch in der Spätkrise ihrer Partei um 1932 noch verstanden, Männer wie Kunschak, Jodok Fink, Bielohlawek und Spalowsky hervorzubringen. Robert Ehrlich, bis 1918 Sektionschef im Ministerratspräsidium, schreibt in seinen 1956 herausgekommenen Erinnerungen an seinen Dienst im alten Österreich, daß B. von den Intellektuellen mit Vorliebe als „klassischer Vertreter des Know- nothingtums“, der Ungebildetheit, hingestellt wird. Indessen könne nach einigen Äußerungen der Bummelwitzigkeit nicht ein Politiker abgeurteilt werden, der ein „hervorragendes Organisationstalent“ gewesen ist und dem Niederösterreich „einige ausgezeichnete Anstalten“ verdankt.
1968, zum 50. Todestag des B., erinnert man sich seiner im Wiener Rathaus. Die „Rathaus-Korrespondenz“ konnte sich auf das stützen, was 1918 ein Zeitgenosse des B. diesem im Nachruf der „Arbeiter-Zeitung“ bezeugte: Ein begabter, arbeitsamer Mann. Nicht leicht zu ersetzen. Ein Schlosserlehrbub, der nicht nur eine erstaunliche Karriere machte, sondern sich auch „änderte“. Der zuletzt sogar „zur Kunst ein inniges Verhältnis fand“. Bei aller Demagogie im Dienst der Christlichsozialen voll Mutterwitz. Und im Wiener Rathaus stellte man mit dem Takt des politischen Gegners, in Niederösterreich mit Stolz fest, was auch noch im Jahr 1968 von B. geblieben ist: der Bau der Heil- und Pflegeanstalt „Am Steinhof“, das Zentralkinderheim in Gersthof, eine fortschrittliche Säuglingsfürsorge und die Erinnerung an die Leistungen der Kriegsfürsorge im ersten Weltkrieg.
Der rabiate Kleinbürger
Hans Moser hat mit seiner populären Soloszene in „Essig und öl“ den Typ des Greißlers, der sich im Niedergang seines Gewerbes an den Dr. Karl Lueger erinnert, lebendig erhalten: der „brave Steuerträger“, dem der Bürgermeister die Hand gibt, weil er für seine Stadt nichts fürchtet, „solange sie solche Bürger hat“. Dieser Typ, seither im Klassenkampf zwischen Kapitalisten und Proletariern zermürbt und in der
Ära von Konsumverein und Supermarket ausgepowert, war nicht immer jener bereits resignierende Raunzer, als den ihn der Moser gespielt hat. 1789, in Paris, war der Fleischhacker Legendre ein besserer Redner als der steife Robespierre. Und trotz aller Brutalität war schließlich der Legendre humaner als der unbarmherzige junge Camille Desmoulins, dem auf Legendre zuletzt nichts anderes einfiel als die Sottise des Intellektuellen: daß nämlich „dasjenige Tier, dem die Natur die schallendste Stimme gegeben hat (der Esel), nicht gerade geeignet ist, Gesetze zu machen“. 1848 noch standen die Intellektuellen in den Redaktionen und die Gewerbetreibenden in einer Front, brachten sie gleichzeitig die Pressefreiheit und die Gewerbefreiheit heim. Später gefielen sich manche Publizisten zuweilen in der Produktion jener Gags, mit denen sie „Greißlerpäpste“ und dergleichen karikieren möchten. Selbst ein Julius Raab mußte sich in dieser Klassifikation gefallen lassen, im Politischen als „Reserveoffizier aus St. Pölten“ eingestuft zu werden: Provinz, Ersatzreserve für die Politik.
Gerade im Zeitalter der Intellektualisierung und Verwissenschaftlichung des Politischen mußte Eindruck machen, was Heer 1968 über die miese Situation im Wien der Ära Lueger zu sagen wußte: Hier brennende Typen wie Adolf Loos und Otto Wagner; dort niederträchtige Banausen, denen der .B aus der Seele gesprochen hat. Daß Loos zu jenen gehört, die 1910 aus guten Gründen den Heimgang Luegers betrauerten, ist inzwischen festgestellt worden. Aber wer kümmert sich, indem er B. zitiert, daß dieser es gewesen ist, der 1905 die Ausführung jenes Werkes rettete, das Otto Wagner mit zu Weltruhm verhalf: Den Bau der Kirche Am Steinhof. Als B. das Wohlfahrtsreferat übernahm, war das Projekt Wagners so gut wie erledigt. Es lag ein Beschluß des Landtags vor, demzufolge anstatt der erforderlichen Bausumme von einer halben Million Kronen höchstens 300.000 Kronen für den Bau einer Anstaltskirche aufgewendet werden sollten. B. setzte zunächst durch, daß er selbst in die „Baudeputation für Wien“ gewählt wurde. Dann kämpfte er für jenen Reassumierungsantrag, mit dem der Landtag am 2. September 1905 die notwendige halbe Million Kronen zur Ausführung des Projektes Wagners bewilligte.
Die „Arbeiter-Zeitung“ von 1918 hat wahrscheinlich recht: der B. hat sich in den zwanzig Jahren seines öffentlichen Wirkens, die dem Vorfall des Jahres 1898 folgten, geändert; so wie jeder Politiker mit 37 Jahren nicht unbedingt auf der vollen Höhe der Leistungsfähigkeit und des Könnens ist. Für B. waren es wahrscheinlich die Not, die er im Wohl- fahrtsreferat kennenlernte; die wachsenden Existenzsorgen des Klein- und Mittelgewerbes; und vor allem: die Folgen des Krieges, mit denen er es in der Kriegsfürsonge zu tun bekam, die bewirkten, daß er im Alter in einem anderen Sinn radikal wurde. Es gibt auch viele kluge Aussprüche des B. Diese aber passen nicht in das bewußt gemachte Image und sie passen jenen nicht, die von diesem Image Gebrauch machen.
Dieser Satz trifft für die politisch Toten noch mehr zu als für die Verstorbenen. Hier wird keine Apologetik geschrieben und der Biographie, dem Psychogramm des B. nicht vorgegriffen. Es geht auch nicht um die Textberichtigung in einem Treppenwitz des Jahres 1898. Die Technik, mit der zuweilen in der Politik ein Image „bewußt gemacht wird“, ist in Frage gestellt. Denn das unwahre Image schadet nicht nur momentan einer Person, einer Sache; es ist, wie es sich im Fall B. herausstellt, ein fortwirkendes Übel.
In unserer Zeit fällt es einem Politiker oft nicht schwer, zuletzt sein eigener Biograph zu werden und sein Image zu retuschieren. Der B. hatte das zweifelhafte Privilegium, daß andere Schreiber die frühen Exzesse seines Temperaments „unsterblich“ machten, der „Rest“ aber Schweigen ist. Wer liest heute noch in alten Jahrgängen von Zeitungen jene Produkte einer liberalen Publizistik nach, in denen alles, aber auch richtig alles zwischen Himmel und Erde, in einer oft niederträchtigen Manier heruntergefetzt wird? Wer kennt und kümmert sich noch um die Ausbrüche des wilden Zorns im Klassenkampf, um die oft brutalen und unzweideutigen körperlichen Drohungen? Das aber gehört zu dem, was heute „in“ ist. Und der B. gehört zu dem, was heute „out“ ist. Out, aus, fertiggemacht, gebrauchsfertig als Image, das paßt, wenn man eine „Person (Personengruppe) oder eine Sache“ sozusagen „dokumentarisch“ deklassieren will.
Der Tod erreichte den B, als er bei der Ausführung seines letzten bedeutenden Unternehmen war. 1916 war es ihm gelungen, die erste ge- samtösterreichische „Vollversammlung der Gewerbeförderungsanstal- ten und gewerblichen Körperschaften“ zu schaffen. Anlaß war die überall hervortretende Not des Klein- und Mittelgewerbes, vor allem die in der Nachkriegszeit zu erwartenden Schwierigkeiten. Noch einmal haben auf dieser gemeinsamen Basis der Kaiserliche Rat Pastyrak aus Brünn, der tschechische Landeshauptmannstellvertreter Jelinek, der jüdische Vertreter aus der Bukowina, der Kammervertreter aus Triest und die Vertreter aus allen
Kronländern einvernehmlich über Maßnahmen für die Zukunft, die für sie noch die gemeinsame war, im Niederösterreichischen Landhaus beraten. Auf der dritten Tagung der Vollversammlung (1917) war es ein Tscheche, der namens des Plenums dem B. für seine, diesmal nach oben hin bewiesene, Courage dankte und ihn bat, auszuharren.
Zum Image des B. gehört, daß er nicht nur ein dumm-dreister Politiker gewesen ist, sondern auch ein korrupter. Also mußte es sich nach seinem Tod herausstellen, welche Werte in der Virlassenschaft steckten. Hatten nicht eigene Parteifreunde verschiedenes gemunkelt,
damals im Elferjahr, als sie den B. zum Sündenbock machten, bevor sie sich selbst aus der christlichsozialen Bewegung verkrümelten? Nicht einzusehen, warum in der Ära der Schieber und Kriegsgewinner nicht auch der Landesreferent für Gewerbeförderung im Umgang mit Armeelieferanten einiges „erübrigt“ hätte. Für sich und die seinen; und für die Söhne gute Verdienstmöglichkeiten statt Frontdienst. Gab es nicht gefällige Regimentsärzte, die dem Verwalter so vieler Spitalsbetten verbunden waren, seine Söhne superarbitrieren, untauglich schreiben konnten? Und waren Töchter des B. nicht aussichtsreiche Partien für Geschäftemacher? Man lebte schließlich in jenen „letzten Tagen der Menschheit“, deren ganzen Schmutz nachher Karl Kraus in so genialer Manier aufgewirbelt hat. Und war nicht überhaupt der B. Urtyp jenes „Herrn Karl“, den Helmut Qualtinger so lebensecht gab?
Herr Qualtinger, der selbst nachher schrieb, diese österreichische Vergangenheit sei schäbig geworden.
Und das blieb vom B: Zwei Söhne, der eine aktiver Oberleutnant, der andere Einjährig-Freiwilliger. Eine Tochter, verheiratet mit einem Beamten. Und die Witwe, laut Aktenlage, „ohne nennenswertes Vermögen“. Die öffentliche Hand liquidierte die Spesen des Pompe funėbre und der Witwe gnadenhalber, was man in der Monarchie einen „Su- stentationsbeitrag“ nannte. Zum Begräbnis war die Prominenz, wie üblich, erschienen. Was auf fiel, war, daß in der Reihe der Minister auch der k. k. Minister für Kultus und Unterricht Ludwig Cwiklinski anwesend war. Das Ressort dieses Ministers hatte mit Gewerbeförderung und Wohlfahrtswesen nichts zu tun. Cwiklinski war Pole, ein feingebildeter Mann, zu dessen Konzepten auf legislatorischem Gebiet die ersten modernen dienstrechtlichen
Vorschriften für Lehrer gehören, an denen er noch als Sektionschef gearbeitet hatte. Nach dem Krieg wurde er Universitätsprofessor in Polen und auch in dieser Republik redeten die Studenten in Posen den alten Herrn noch gerne mit Exzellenz an; nur auf seinem Partezettel durfte 1940 nicht stehen, daß er einmal in Österreich Minister gewesen ist.
Warum stand dieser gebildete Mensch, weder ein Connationaler noch ein Parteifreund noch ein Ressortkollege des B., am Grabe dieses B.? Der Unterrichtsminister hatte den Geist des Bielohlawek noch erlebt. Und war trotzdem gekommen? So fragt sich heute ein Gebildeter. Wo man doch jetzt weiß, was der B. für einer gewesen ist.
„Das Image einer Person (Personengruppe) oder Sache ist.. aber das ist besser in der Einleitung nachzulesen.