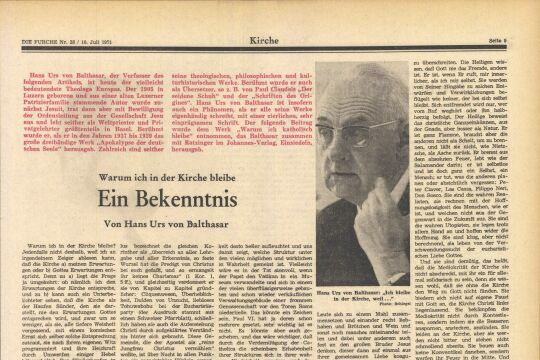Mein Freund, der Atheist — einer von jenen, denen die tragische Gnade intellektueller Hoffnungslosigkeit nicht verweigert ist und die zur Gänze wie aufgezehrt sind von der Leidenschaft des Absoluten — warf mir unlängst vor: „Was schert euch Christen das alles, ihr habt ja euer Trostkissen, dem ihr euch Abend für Abend überlassen könnt!“
Mein Freund konnte natürlich nicht ahnen, daß der Glaube ein zumindest ebenso großes Abenteuer ist wie der Unglaube, beladen, wie der Glaube ist, mit all dem Verhängnis, all der Unabsehbarkeit und all der Dunkelheit, die der Begriff des Abenteuers in sich schließt. Er konnte nicht ahnen, daß einem Christen oftmals nur ein letztes Kissen (ohne Trost) übrigbleibt: die beiden gekreuzten Balken, dieses königliche Sterbekissen seines Herrn und Meisters. Er ahnte auch nicht, wie undurchdringlich in einem Gläubigen die Nacht des Glaubens werden kann. Kurzum, er ahnte nichts von dem Abenteuer, das einen Menschen bis an jene äußerste Grenze verschlägt, an der unser Meister sein „Eli, Eli, lamma sabaktni“ schrie.
Die katholische Theologie läßt die
Vermutung durchaus zu, daß Christus lange Zeit sogar für seine eigene Mutter ein Rätsel war. Ein Rätsel blieb er für seine Jünger mehr oder minder bis zu seiner Auferstehung
— und auch noch später vielleicht; davon berichten mit großer psychologischer Glaubwürdigkeit die Evangelisten. Was für ein Abenteuer muß es doch gewesen sein, damals, seiner Lehre zu lauschen. Freilich
— kein geringeres damals als heute, für die Menschen des Atomzeitalters.
Bleiben wir fürs erste im biblischen Raum, von dessen ideologischer Substanz wir ja immerhin im großen und ganzen leben. In diesem Raum gibt es den Fall des europäischen Intellektuellen, wie er uns auf exemplarische Weise in Ernest Renan entgegentritt, unbeirrbar seiner Vernunft vertrauend, innig an den siegreichen Fortschritt der Technik glaubend, ganz bezaubert vom Kult der Immanenz; ihm hat sich das Tor einer rosigen Zukunft geöffnet, Endpunkt der Weltgeschichte, und selbstbewußt betritt er dieses Tor, ein Prometheus, ein Fackelträger erlöster Freude.
Was für berauschende Perspektiven! Der französisch-preußische Krieg von 1870/71 Wird der letzte aller Kriege sein, Leo XIII. das letzte aller Gespenster, die durch den Vatikan geistern; Millionen erheben sich hinter Comte, Feuerbach und Marx, um von diesen in das neue Kanaan geführt zu werden, das Land der Verheißung, das von Liberte, Egalite und Fraternite überfließt.
Und in welches Land der Verheißung taumelten wir hundert Jahre später? In die Trümmerstätten zweier Weltkriege, in denen, 50 Millionen Menschen ihr Leben verloren.
In den Wahn nationalsozialistischer Ideologe und Praxis. Und daß Arbeit frei mache, stand auf den Toren sowohl von Hitlers Dachau wie von Stalins Gosudarstvennoe Upravlenie Lagere j. Und von Zeit zu Zeit stimmt man im großen Weltorchester die Instrumente für die Ouvertüre des Dritten Weltkriegs, und in den Rüstkammern wartet die Zerstörungskraft von 30 Milliarden Tonnen Sprengstoff mit der 'Wirksamkeit
von 23 Millionen A-Bomben vom Typ Hiroshima. Unsere Philosophie hat sich dem Nichts und der Faszination des Todes verschrieben, unsere Kunst der Auflösung und dem Absurden. Prometheus leidet an Herzinfarkt und Krebs oder wenigstens an zusammengebrochenen Nerven. Seit der Monderoberung erobert uns in unseren Betten die Grippe.
Mythen gegenüber verhält sich der Mensch des 20. Jahrhunderts, zurückgeworfen auf seine ursprüngliche Tragik, immer reservierter. Jeder Tag findet ihn skeptischer gegenüber den Surrogaten des Göttlichen. „Paradies auf Erden?“ Vor hundert Jahren noch klang diese Formel so wenig ironisch, daß der Fürst der Ironie in Person, Heinrich Heine, sie ohne Scheu gebrauchte. In unserem Jahrhundert konnte sich das nur Chruschtschow, der bäuerliche Tollpatsch, leisten; seitdem aber ist die Formel aus dem imma-nentistischen Wortstrom verschwunden. Marcuse besaß genügend Humor, um in seiner Philosophie das irdische Paradies gegen ein „Ausruhen“ im Diesseits auszutauschen. Ein Ausruhen, das theoretisch genau so existent ist wie die Aktivität seines Schülers Cohn-Bendit soziologisch existent ist.
Ist der Glaube heute wirklich ein gewagteres Abenteuer, als er es bisher war? Braucht der Christ wirklich, um zu glauben, ein größeres intellektuelles Risiko? Die philologische Kritik ließ, trotz aller Bemühungen, sie zu zerstören, die Evangelien als Urkunden bestehen. Die Naturwissenschaft entdeckte in der Materie einen neuen Abglanz des Ursinns, des Logos, einen Abglanz, den der Mensch vorher nicht einmal ahnen konnte. Für den modernen Physiker wurde die Materie, die man vorher für begreifbar gehalten hatte, zum unbegreiflichen Geheimnis und hinter allen Abgründen des infinitesimal Kleinen öffnen sich immer neue Abgründe. Wenn Materie gleich
Energie, Energie gleich Materie sein können, dann ist auch ein geistiges All weniger unglaubwürdig, als es dumpfer mechanizistischer Vernunft vordem geschienen haben mag. Und während all dem verkündeten die Großen der Literatur, von Dostojewski bis Solschenizyn, christliche Botschaft, kam ein Rouault in seinen Gemälden von der evangelischen Thematik nicht los. Frankreich vor allem schenkte dem Christentum in
diesem Jahrhundert eine ganze Plejade der Geister, die zutiefst vom Sturmatem der Evangelien erfaßt war. Und in Rom begann die Kirche, nach dem Verlust ihrer weltlichen Macht, im Genie eines Leo XIII., in der Schlichtheit eines Pius X. und im urchristlichen Charme eines Johannes XXIII. neu zu erstrahlen; der Galerie katholischer Heiliger wurden ein Jean Vianney und die seraphische Therese von Lisieux hinzugefügt. Zahlreiche Mystiker haben dieses unser Jahrhundert zu einem der prophetischen unter den christlichen Zeitaltern gemacht. Und der Himmel war dieser unserer Erde sehr nahe: wie nahe, das hatte in Lourdes nur eine einzige junge Französin gesehen. In Fätima sahen es 40.000 Portugiesen gleichzeitig.
Mit einem Wort: verglichen mit der Lage, in der sich seine Glaubensbrüder vor hundert Jahren, geschweige denn im 15. oder im 19. Jahrhundert befanden, ist der Christ von heute auf mancherlei Art privilegiert. Privilegiert ist er schon in Hinblick auf eine neue Erfahrung seiner christlichen Berufung; vom ideologischen Frost des Sillabus hat ihn der Pfingstgeist des Zweiten Vatikanums befreit; die Braut Christi hat den Purpur abgelegt, aber gerade dort, wo sie an äußerer Attraktivität verloren hat, reift in der Kirche eine neue Sauberkeit des Wortes heran und in den Köpfen der Hierarchie greift die Erkenntnis Platz, daß Christentum seinem Wesen nach nicht so sehr Disziplin wie Liebe ist. Und doch: der Weg zu Christus wurde nicht gerade idyllisch und der Glaube an Christus hört nicht auf, ein Abenteuer zu sein. Andernfalls hätte der Herr nicht gerade uns selig gepriesen, die wir, anders als seine Jünger, nicht sehen, und dennoch glauben.
Man kann freilich auch die Meinung vertreten, daß es heute schwieriger sei, Christ zu sein, als bisher. Das Christentum ist nicht mehr, wie
einst, die Atmosphäre, in der die Menschen atmen; das ist in keiner der großen Städte mehr der Fall, auch nicht in der Stadt Rom. Als Christ kann man heute nicht nur inmitten der Berufskollegen, sondern auch inmitten der eigenen Verwandtschaft sehr einsam sein. Glauben, das heißt heute, die Isolation wählen, .heißt gegen den Strom schwimmen (gegen einen Strom dreifachen Begehrens), heißt, sich für eine Haltung
entscheiden, die von den anderen durchaus als psychopathisch beurteilt werden kann, wenn nicht sogar als regelrechter Affront gegen den gesunden Verstand. Und zu all dem ist dem Christen die allgemeine Stimmung der Zeit nicht fremd, jene moderne Daseinsangst, die er mit den NichtChristen teilt.
Auch im kulturellen Raum sieht sich der Christ isoliert. Er findet dort nicht die unbewußte Sehnsucht nach dem Göttlichen, die — wie Fulton Sheen es bezeichnete — „schwarze Gnade“ eines Franz Kafka, sondern nur platte Entsakralisierung. Und mit der sogenannten katholischen Kunst wird er, falls begabt, noch weniger anfangen können i— so viel unfreiwillige Komik ist darin!
Kurzum, auch heute muß sich der Christ durch Dantes „wilden, tiefen und dunklen Wald“ schlagen und darin die Abenteuer des Glaubens bestehen. Denn wie kann sich unsere kostbare, aber begrenzte Vernunft einen Menschen zwischen Tod und Auferstehung vorstellen, eine Kontinuität des Ich ohne Körper, ohne Nerven und ohne alle wesentlichen Voraussetzungen einer Persönlichkeit? Wie ist eine Kontinuität möglich nicht nur außerhalb von Zeit und Raum, sondern auch außerhalb irdischen Schmerzes und losgelöst von allen Bindungen, die da von der Frau bis zur Heimat reichen?
Nichts kann phantastischer sein, als am Ende zu bekennen: ich glaube an die Auferstehung des Fleisches und an das Leben der künftigen Welt! Unter dem Gesichtswinkel des modernen Individualismus besteht ja das Abenteuer vor allem darin, daß wir auferstehen werden; weniger darin, daß Gott unser Vater ist, in geschichtlicher Zeit Mensch wurde und in der Eucharistie unter uns wohnt. Wäre mit dem Tode alles zu Ende, so wäre Gottes Liebe zu uns doch reichlich uninteressant.
Engt das christliche Abenteuer unsere Persönlichkeit ein? Tatsache
ist jedenfalls, daß Christus zu diesem Abenteuer nicht nur alle Völker und Berufe, sondern auch alle Charaktere, alle Temperamente und Begabungen aufgerufen hat. In der Ahnengalerie christlicher Helden erfreut eine große Mannigfaltigkeit unser Auge; da gibt es alle menschlichen Spielarten vom Choleriker bis zum Phlegmatiker, vom Dilettanten bis zum Organisator, vom glühenden Ekstatiker bis zum soliden Finanzmann, vom sensitiven Nervenbündel bis zum strohtrockenen Realisten. In unserer Ahnengalerie gibt es den römischen Centurio und den griechischen Philosophen, den malenden Bruder Angelico und den kraftstrotzenden Renaissanceherrn, einen französischen König, einen italienischen Schmied, einen spanischen Sol-
daten; polnische Rebellen, englische Denker, deutsche Bäuerinnen; oder den südamerikanischen Ingenieur, den irischen Halenarbeiter, die Pagen am Hofe des afrikanischen Negerkönigs; oder den niederländischen Studenten, den italienischen Universitätsprofessor, den französischen Bettler und den slowenischen Bischof; kurzum: neben Genies wie Augustinus und Benedikt Labre oder dem Schriftsteller Francois de Sales den „Narren Gottes“ Filippo Neri, neben der herrscherlichen Organisatorin Teresa de Avila die unscheinbare Therese von Lisieux. Man könnte fast sagen, daß Gott mit jedem neuen Heiligen uns verwirren und die Klischees zerstören will, die wir uns von „Heiligkeit“ gemacht haben. Ein Spiel wahrlich, mit unseren hagiographischen Fiktionen, und nicht ohne Humor. Wird Maximilian Kolbe kanonisiert, so kanonisiert die Kirche in ihm nicht nur den Märtyrer von Auschwitz, sondern auch den Forscher und Vorläufer der Kosmonautik. Und wenn Johannes XXIII. kanonisiert wird, so erhält unsere Galerie nicht nur das Bild eines bezaubernden Gesellschafters mit viel Sinn für Witz, sondern auch eines heiliggesprochenen Historikers hinzu.
Auch in dieser Hinsicht übertrifft Gott alle unsere Vorstellungen; wo sonst gibt es diese Achtung vor der Einmaligkeit jedes Geschöpfs, wo sonst diese künstlerische Freude an der Vielfalt des Menschen und des Universums, wo sonst, neben allem anderen, diese unausschöpfliche Phantasie?
Und dies ist ein neuer Horizont, der sich vor den Augen des angstgequälten Menschen der Atomzeit geöffnet hat, ein neuer Horizont, unter dem das christliche Abenteuer nicht nur unser würdig, sondern auch sehr beglückend werden kann.