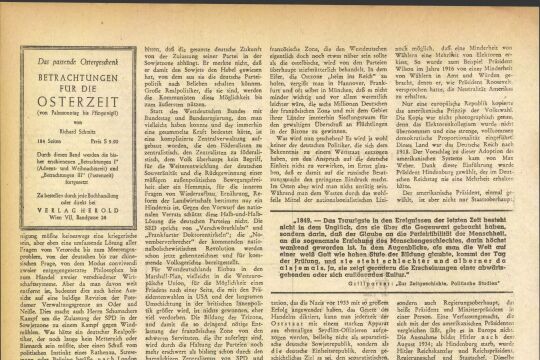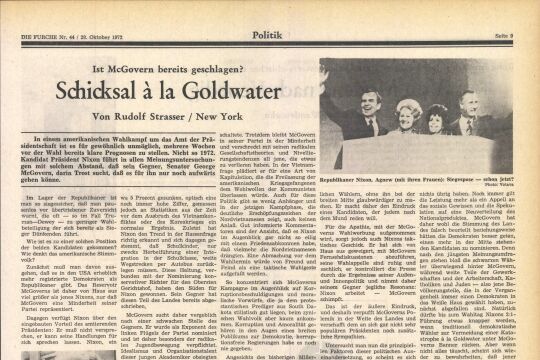Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der nächste Präsident der USA
Alternder Schauspieler mit reaktionären An- und Absichten: so einfach wie dieses Klischee ist Ronald Reagan (häufigste Aussprache: rägän oder räigän, seltener riegän) nicht. Zu seinen Stärken gehört, daß er unterschätzt wird.
Das galt lange auch für seine Präsidentschaftschancen, die ihm noch vor einem Jahr niemand zubilligen wollte. Heute weiß man: in wenigen Tagen ist der Ex-Demokrat der frühen sechziger Jahre offizieller Kandidat der Republikanischen Partei, und daß er am 4. November (mit 70!) gewählt wird, ist keine Unmöglichkeit mehr. Ron Reagan ist erzkonservativ im Reden und pragmatisch im Handeln. Immerhin wurde er zweimal mit großer Mehrheit zum Gouverneur von Kalifornien gewählt, wo es zweimal so viele Demokraten wie Republikaner gibt.
In seiner Gouverneurszeit. (1966-74) reformierte er das Steuersystem, baute wider aller Erwarten Konsumenten- und Umweltschutz aus, bremste den Zuwachs an Beamten und regierte skandalfrei.
Kernstück seiner Präsidentschaftsversprechen ist eine 30%ige Einkommen-, Lohn- und Körperschaftssteuersenkung für drei Jahre und eine verstärkte Verteidigung. Er ist für die Superrakete MX, die Neutronenbombe und den Atombomber B1 (die letzten zwei vertagte Carter), gegen SALT II und diplomatische Beziehungen mit Peking auf Kosten Taiwans. (Wetten, daß er Beziehungen wie SALT II mit Miniretuschen schlucken würde?)
Der Nichtraucher und gelegentliche Wodkatrinker Reagan liebt die Familie (vier erwachsene Kinder) und Freunde, ist kein Gesellschaftslöwe und hört auf seine Frau Nancy. Er träumt von einer „Regierung durch Kabinettskollegialität” (die noch jeder Präsident versucht und wieder aufgegeben hat) und mit Leuten, „die gar nicht Minister werden wollen und Gehaltseinbußen erleiden”.
Wahrscheinlich würde sich in der US-Politik außer markigeren Sprüchen relativ wenig ändern. Er gibt zu, daß er mit dem Carter-Programm ganz gut regieren könnte - „aber er hat es ja nicht durchgesetzt”.
Aber auch Reagan käme als Neuling nach Washington und würde ein Opfer von Kongreß und Bürokratie: neben seinem Alter die zweite bedenkliche Perspektive.
Carters Ende?
Jimmy Carter, mit 56 der jüngste der drei Kandidaten, hat ein hartes Schicksal zu bestehen: Nach Vietnam und Watergate, Nixon und einer Presse, die Blut gerochen hatte, kam er als erster Südstaatler nach 127 Jahren in ein Washington, dessen Kongreß, Bürokratie und Medien die feste Absicht hatten, nie wieder einen starken Präsidenten zuzulassen.
Der „neugeborene” Baptistenprediger predigte auch in der Politik Güte, Sauberkeit und Mitgefühl und stolperte über Intrigen, Korruptionsverdacht selbst im Freundeskreis und mitleidlose Kremlstrategie.
Man mußte allen seinen wichtigen Programmpunkten herzhaft zustimmen: Budgetsanierung, Energiesparkonzept, forcierte Abrüstungsverhandlungen, Eindämmung der Waffen-und Kernenergieverbreitung, Förderung der Menschenrechte.
Dann zwangen ein aufsässiger Kongreß und ein aufsässiger Kreml zu ständigen Kehrtwendungen, die ein mit mehr Führerqualitäten ausgestatteter Präsident natürlich souveräner bewerkstelligt hätte.
Außenpolitisch gab es unbestreitbare Erfolge: die Panamakanal-Verträge, SALT II, der israelisch-ägyptische Friede von Camp David, entgegen verbreiteter Auffassung auch die Menschenrechtskampagne.
Pleiten im Kongreß mit seiner Energiepolitik, Düpierungen durch Moskau und das Drama in Iran verunsicherten ihn und verwandelten seine Selbstgewißheit in bloße Sturheit.
Ein schon deutlich eingeleiteter Trepd zum Abbau der Arbeitslosigkeit kehrte sich wieder um, auch Inflation und Handelsbilanzdefizit steigen wieder, der Dollar wurde erst auf einem Tiefpunkt stabilisiert.
Man darf sich aber nicht täuschen: Dieser Mann hat noch immer Reserven. Der Tölpel, als den ihn manche europäische Medien malen, war er und ist er nicht. Im Wahlkampf hat er ungeheure Nehmer-, Steher- und Comeback-Qualitäten. Obwohl derzeit etwa zehn Prozentpunkte hinter Reagan, wird er diesem eine harte Aufholjagd liefern.
Sollte er, was denkbar ist, wiedergewählt werden, müßteer sich schleunigst um einen besser qualifizierten Mitarbeiterstab umsehen. Die Mittelmäßigkeit der „Georgia-Mafia” im Weißen Haus hat an seinem Niedergang entscheidenden Anteil. tl eder zweite Wähler der USA ist unglücklich darüber, daß er nur die Wahl zwischen Carter und Reagan haben sollte. Darauf baut einer, der lachender Dritter werden möchte: der liberale (im amerikanischen Sprachgebrauch heißt das progressive) Republikaner John B. Anderson, 58 Jahre alt, langjähriger Kongreßabgeordneter des Bundesstaates Illinois.
Der silberhaarige, etwas pro-fessoral, aber politisch durchaus professionell' wirkende Sohn eines aus Schweden eingewanderten Greislers kandidiert, weil er sich als Republikaner in den Vorwahlen nicht durchsetzen konnte, als Unabhängiger, ohne daß er seiner Partei den Rücken gekehrt hätte.
Diese ist ihm auch gar nicht sehr böse, weil er vermutlich dem demokratischen Präsidenten mehr Stimmen wegnehmen wird als Reagan.
Derzeit sympathisieren rund 20 Prozent der Wähler mit Anderson. Seine Strategie ist es, diese Ziffer bis Oktober auf etwa 30 Prozent hinaufzutreiben, was nach Expertenmeinung am Wahltag rund zehn Prozent echter Stimmen ergäbe.
Damit könnte er vermutlich eine absolute Mehrheit der Wählerstimmen für Carter oder Reagan verhindern und die Präsidentenwahl würde ins Repräsentantenhaus verlagert, wo jeder der drei eine neue Chance hätte.
Stimmen sucht er, wo er sie finden kann - also nur bei den konservativen Republikanern und in den Südstaaten nicht. Sein Vizepräsidentschaftskandidat wird vermutlich ein Demokrat, vielleicht sogar eine Frau oder ein Neger sein.
Sein Programm ist vage: eher liberal-progressiv in der Außen-, gemäßigt konservativ in der Wirtschaftspolitik.
Er will auch bei den Verteidigungsausgaben sparen, statt einer Steuersenkung die Progression an einen Index binden, eine neue Benzinsteuer einführen, gleichfalls das Budget ausgleichen.
Seine Frau Keke, mit der er 27 Jahre verheiratet ist, wäre wie Rosalynn Carter oder Nancy Reagan eine „politische” First Lady.
Wie Carter ist auch Anderson protestantischer Laienprediger, bezeichnete aber jüngst (in einer sehr pro-israclischen Rede vor jüdischen Zuhörern) sein Eintreten vor 20 Jahren für einen Einbau Jesu Christi in die Verfassung als „Irrtum”.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!