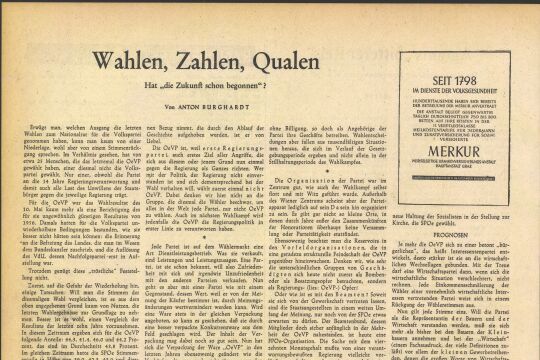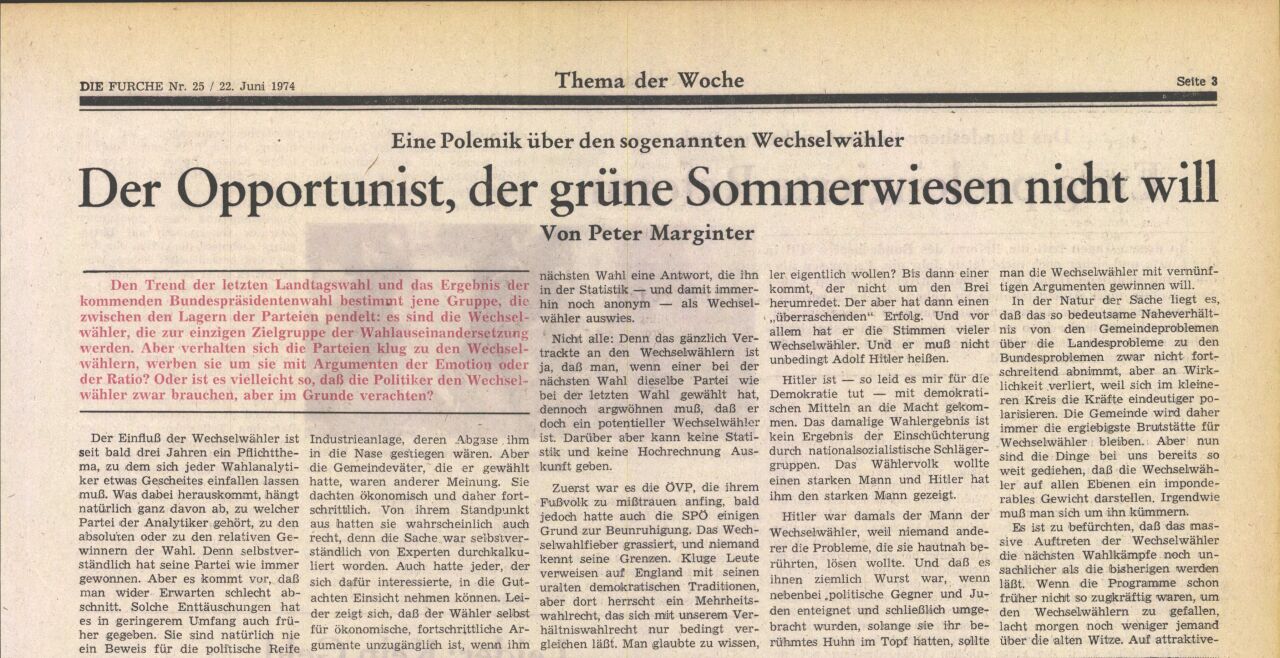
Der Opportunist, der grüne Sommerwiesen nicht will
Den Trend der letzten Landtagswahl und das Ergebnis der kommenden Bundespräsidentenwahl bestimmt jene Gruppe, die zwischen den Lagern der Parteien pendelt: es sind die Wechselwähler, die zur einzigen Zielgruppe der Wahlauseinandersetzuno Werden. Aber verhalten sich die Parteien klug zu den Wechselwählern, werben sie um sie mit Argumenten der Emotion Oder der Ratio? Oder ist es vielleicht so, daß die Politiker den “Wechselwähler zwar brauchen, aber im Grunde verachten?
Den Trend der letzten Landtagswahl und das Ergebnis der kommenden Bundespräsidentenwahl bestimmt jene Gruppe, die zwischen den Lagern der Parteien pendelt: es sind die Wechselwähler, die zur einzigen Zielgruppe der Wahlauseinandersetzuno Werden. Aber verhalten sich die Parteien klug zu den Wechselwählern, werben sie um sie mit Argumenten der Emotion Oder der Ratio? Oder ist es vielleicht so, daß die Politiker den “Wechselwähler zwar brauchen, aber im Grunde verachten?
Der Einfluß der Wechselwähler ist seit bald drei Jahren ein Pflichtthema, zu dem sich jeder Wahlanalytiker etwas Gescheites einfallen lassen muß. Was dabei herauskommt, hängt natürlich ganz davon ab, zu welcher Partei der Analytiker gehört, zu den absoluten oder zu den relativen Gewinnern der Wahl. Denn selbstverständlich hat seine Partei wie immer gewonnen. Aber es kommt vor, daß man wider Erwarten schlecht abschnitt. Solche Enttäuschungen hat es in geringerem Umfang auch früher gegeben. Sie sind natürlich nie ein Beweis für die politische Reife des Wählervolks gewesen, sondern meistens eine Folge der gemeinen Taktiken, mit denen es dem absoluten Gewinner gelang, die eben erst der Unmündigkeit entwachsenen Jungwähler zu betören. Die Wahlpropaganda hatte sich daher vor allem an die Jungwähler zu wenden, das Muatterl mit dem Öpa am Kaffeetisch war eine Pflichtübung, die man den Altgetreuen schuldete, aber den Ausgang der Wahl kaum beeinflußte. Und auf den Jungwähler hatte sich die Propaganda so schön eingeschossen — mit grünen Sommerwiesen, schmucken Eigenheimen und herzigen Gschrappen, Anzügen, die fast nach Maß aussahen, für den konfektionsgerechten Papa, blitzsaubere amerikanische Küchen für die ebenso junge wie schlanke Mami und ein bisserl Beat und Geschmuse für jene, die erst im Begriff waren, sich zu finden. Heile Welten. Warum auch nicht?
Selbstzucht der Parteien
Es war alles in Butter, bis die Wechselwähler auftraten. Ein Wechselwähler ist ein Mensch unbestimmten Alters, der bei einer bestimmten Wahl eine andere Partei als bei der letzten Wahl wählt. Ein Renegat also, ein Opportunist und überhaupt ein Schwein. Aber das darf man sich als kluger Politiker nur denken, weil man ja die Wechselwähler nicht ver-grausen will. Nicht einmal nach einer Wahl, die man nur relativ gewonnen hat, darf man sagen, was man über ihn denkt. Man muß ihm bestätigen, daß er ein hohes Maß an politischer Beife bewiesen hat, nur leider nicht richtig informiert war. Was auch nicht seine Schuld war, oh nein, sondern höchstens eine gewisse Kurzsichtigkeit, die ihn hinderte, die Lügen, die der Gegner als Information auftischte, als solche zu erkennen. Vielleicht muß man sogar etwas an die Brust klopfen und gestehen, daß die eigene Information nicht durchschlagskräftig genug war. Die Sommerwiesen waren grün wie gehabt, die Eigenheime schmucker denn je und die Gschrappen so herzig ... Was gut und teuer ist, hat man diesen Schweinen als Information geboten. Nicht einmal das Muatterl und den Opa hat man vergessen! Aber der Wechselwähler wollte nicht, und darum soll man sich jetzt über das, was der Wechselwähler wollte, den Kopf zerbrechen. Wahrhaftig eine arge Zumutung, wenn man bedenkt, daß der Wechselwähler bei der nächsten Wahl womöglich etwas ganz anderes will. Laut sagen können, daß der Wechselwähler mit unserer Form der Demokratie nicht vereinbar ist...!
Dabei haben unsere Parteien den Wechselwähler selbst gezüchtet. In den tiefsten Lagen der Demokratie, auf der Gemeindeebene, ist es passiert. Da gab es irgendwelche Probleme, die den Wänler hautnah berührten. Eine Autobahn quer durch die Gemeinde, die ihn gehindert hätte, seine gewohnten Wege zu gehen und seine schöne Heimatstadt, wie er fand, verschandelt hätte, oder eine
Industrieanlage, deren Abgase ihm in die Nase gestiegen wären. Aber die Gemeindeväter, die er gewählt hatte, waren anderer Meinung. Sie dachten ökonomisch und daher fortschrittlich. Von ihrem Standpunkt aus hatten sie wahrscheinlich auch recht, denn die Sache war selbstverständlich von Experten durchkalkuliert worden. Auch hatte jeder, der sich dafür interessierte, in die Gutachten Einsicht nehmen können. Leider zeigt sich, daß der Wähler selbst für ökonomische, fortschrittliche Argumente unzugänglich ist, wenn ihm
der Fortschritt in die eigene Nase stinkt. Er wog den ihm vorgerechneten Gemeinnutz gegen den Eigennutz ab, den er sich an den fünf Fingern abzählen konnte, und war dagegen. Daß der Wähler grundsätzlich ein Egoist ist, war eine herbe Enttäuschung. Daß die Gegner skrupellos mit diesem Eigennutz spekulierten und sich ihrerseits Experten angeheuert hatten, die sogenannte Alternativen austüftelten, war natürlich zu erwarten gewesen. So kam es ungeheuerlicherweise nicht nur zu relativen Gewinnen, sondern zu echten Verlusten.
Das böse Wahlgeheimnis
Freilich konnten auch echte Verluste die Partei nicht in ihrem Kern treffen. Das Problem, an dem sie das eine Mal gescheitert war, war durchaus ephemerer Natur. Aber die Folge dieser Wahlen war viel schlimmer: Treue Wähler, die nie davon geträumt hatten, daß sie gegen ihr erstes vor der Urne abgelegtes Bekenntnis verstoßen könnten, hatten ihre Stimme dem Gegner gegeben! Wie sie das mit ihrem Gewissen ausmachten, weiß Gott und vielleicht ihr Beichtvater. Das Wahlgeheimnis deckt sogar Renegaten, Opportunisten und Schweine. Aber auch rundherum wurde alles anders. Selbst wenn es nicht so aussah, denn die Autobahn und dij Industrieanlage wurden natürlich nicht gebaut. Anders wurde es, weil nicht nur diese Renegaten usw. die Erfahrung gemacht hatte, daß man seine Stimme nicht immer derselben Partei geben muß und trotzdem die Welt nicht einstürzt, daß man im Gegenteil dafür als mündiger Staatsbürger gefeiert wird. Anders wurde es, weil von den übrigen Wählern — in der Gemeinde, im Land und in ganz Österreich — manche sich zu fragen begannen, was es mit der Selbstverständlichkeit ihres Bekennertums auf sich habe. Und mancher von denen, die sich fragten, gab bei der
nächsten Wahl eine Antwort, die ihn in der Statistik — und damit immerhin noch anonym — als Wechselwähler auswies.
Nicht alle: Denn das gänzlich Vertrackte an den Wechselwählern ist ja, daß man, wenn einer bei der nächsten Wahl dieselbe Partei wie bei der letzten Wahl gewählt hat, dennoch argwöhnen muß, daß er doch ein potentieller Wechselwähler ist. Darüber aber kann keine Statistik und keine Hochrechnung Auskunft geben.
Zuerst war es die ÖVP, die ihrem Fußvolk zu mißtrauen anfing, bald jedoch hatte auch die SPÖ einigen Grund zur Beunruhigung. Das Wechselwahlfieber grassiert, und niemand kennt seine Grenzen. Kluge Leute verweisen auf England mit seinen uralten demokratischen Traditionen, aber dort herrscht ein Mehrheitswahlrecht, das sich mit unserem Verhältniswahlrecht nur bedingt vergleichen läßt. Man glaubte zu wissen,
was der (eigene) Wähler will. Was aber will der Wechselwähler?
Das ist eine Preisfrage, die kein Politiker zu beantworten wagt Wenn die Politiker tatsächlich nichts anderes als Leute wären, die nach oben wollen, wäre das Rezept einfach. Sie müßten nur das Ergebnis einer einigermaßen verläßlichen demoskopischen Untersuchung hernehmen und zu Forderungen umformulieren. Das Kreuz ist, daß viele Politiker, obwohl es ihnen sowieso fast niemand zutraut, eine Art Prinzipien haben. Die Ergebnisse der demoskopischen Untersuchungen zeigen leider oft, daß die Ansichten der Wähler dem zuwiderlaufen, was der nationale oder internationale Anstand gebietet. Oder auch dem, was ökonomisch und daher fortschrittlich ist. Außerdem traut sich jeder halbwegs selbstbewußte Politiker zu, das Ganze und seine Erfordernisse besser zu erkennen als das Wählervolk, dessen durchschnittlicher Erkenntnisstand sich in einer solchen Untersuchung niederschlägt.
Wechselwähler und der „starke Mann“
Daß es so ist, ehrt zweifellos die Politiker. Prinzipien haben und sie vertreten ist immer eine ehrenhafte Sache. Fragt sich vielleicht, wie sich das mit einer repräsentativen Demokratie verträgt. Vom Konzept her verlangt doch die repräsentative Demokratie, daß die Vertreter des Volkes den Willen des Volkes — oder wenigstens der Mehrheit der Wähler — vertreten und durchsetzen. Was legitimiert die Vertreter, die Vertretenen zu bevormunden und — zu ihrem Besten oder nicht — etwas anderes zu wollen als sie? Beim Mehrheitswahlrecht ist es relativ leicht, den Vertreter beim Wort zu nehmen. Beim Verhältniswahlrecht müßte man die Vertreter beim Programm nehmen. Aber wie soll das geschehen, wenn kein Programm alles auszudrücken wagt, was die Wäh-
ler eigentlich wollen? Bis dann einer kommt, der nicht um den Brei herumredet. Der aber hat dann einen „überraschenden“ Erfolg. Und vor allem hat er die Stimmen vieler Wechselwähler. Und er muß nicht unbedingt Adolf Hitler heißen.
Hitler ist — so leid es mir für die Demokratie tut — mit demokratischen Mitteln an die Macht gekommen. Das damalige Wahlergebnis ist kein Ergebnis der Einschüchterung durch nationalsozialistische Schlägergruppen. Das Wählervolk wollte einen starken Mann und Hitler hat ihm den starken Mann gezeigt.
Hitler war damals der Mann der Wechselwähler, weil niemand anderer die Probleme, die sie hautnah berührten, lösen wollte. Und daß es ihnen ziemlich Wurst war, wenn nebenbei .politische Gegner und Juden enteignet und schließlich umgebracht wurden, solange sie ihr berühmtes Huhn im Topf hatten, sollte
niemanden wundern, der an die Erbsünde glaubt. Aber schon der alte Kain hätte sich, als die Gaben auf seinem Altar nicht so schön brannten wie auf dem Abels, zunächst einmal fragen sollen, ob Gott nicht ein anderes Opfer von ihm verlangte.
Gewiß gibt es Forderungen, die nicht in der Form erfüllt werden können, in der sie sich in einer demoskopischen Untersuchung ausdrücken. Aber man müßte zumindest versuchen, zu ihren Ursachen zurückzuta-sten. Sie liegen nicht immer so offen zutage wie bei der Autobahn und der stinkenden Fabrik.
Zum Beispiel die Geschichte mit dem Paragraph 144 StG: Da wird viel und mit echtem Engagement von der Heiligkeit des keimenden Lebens geredet und von den Grenzen der Verantwortung, die eine parlamentarische Mehrheit auf sich nehmen darf. Statt darüber zu meditieren, sollte man ein wenig mehr darüber nachdenken, was au tun wäre, um auch die Anlässe zu Abtreibungen aus dieser besten aller Welten zu schaffen. Dagegen sein ist hier nicht genug. Wären die empörten Christen bereit, ungewollte Kinder zu übernehmen? Ohne Nasenrümpfen und so selbstverständlich, wie man eben zuzugreifen hat, wenn man das Leben eines Menschen retten will. Wären sie bereit, auch dort schon zu helfen, wo bereits die Schwangerschaft eine überdurchschnittliche Belastung darstellt? Vielleicht könnten sie damit erreichen, daß dann die erlaubten Abtreibungen seltener werden als es die bislang verbotenen sind.
„Kalt vom Herumreden“
Bei Autabahnverläufen und Industriebauten genügt es, das Expertengeschwätz zu überhören und der allgemeinen Stimmung der Betroffenen zu folgen. Vorausgesetzt, daß die Betroffenen zahlreich genug sind, um ins Gewicht zu fallen. Bei allem, das etwas ferner liegt, muß man sich viel, viel mehr einfallen lassen, wenn
man die Wechselwähler mit vernünftigen Argumenten gewinnen will.
In der Natur der Sache liegt es, daß das so bedeutsame Naheverhältnis von den Gemeindeproblemen über die Landesprobleme zu den Bundesproblemen zwar nicht fortschreitend abnimmt, aber an Wirklichkeit verliert, weil sich im kleineren Kreis die Kräfte eindeutiger polarisieren. Die Gemeinde wird daher immer die ergiebigste Brutstätte für Wechselwähler bleiben. Aber nun sind die Dinge bei uns bereits so weit gediehen, daß die Wechselwähler auf allen Ebenen ein imponde-rables Gewicht darstellen. Irgendwie muß man sich um ihn kümmern.
Es ist zu befürchten, daß das massive Auftreten der Wechselwähler die nächsten Wahlkämpfe noch unsachlicher als die bisherigen werden läßt. Wenn die Programme schon früher nicht so zugkräftig waren, um den Wechselwählern zu gefallen, lacht morgen noch weniger jemand über die alten Witze. Auf attraktive-
re Verpackungen fällt ein aufgeklärter Verbraucher auch nicht mehr hinein. Und daß der Wechselwähler besonders aufgeklärt ist, wird ihm von allen Seiten eifrig bescheinigt. So schnell ändern sich die Verhältnisse auch wieder nicht, daß man den Parteiweisen alle vier Jahre nagelneue Kolumfouseier abfordern könnte. Trotz der hohen Prämie, die dafür winkt, wäre zudem der Aufwand sehr hoch. Was die Wechselwähler wirklich wollen, läßt sich meistens nicht so leicht in ein Programm einbauen.
Man wird also die emotional ausgerichtete Propaganda, die bisher auf die Jungwähler konzentriert war, auf breiter Front anwenden müssen. Zwischen dem jungen Glück, das über die Sommerwiesen hüpft, und dem alten Glück, das sich rund ums Kaffeehäferl verbreitet, wird man ein Glück einfügen müssen, das es noch nicht gibt. Ein Glück für die mittleren Jahre, in denen man allmählich begreift, daß Sommerwiesen und Kaffeehäferln in der Wachs-tumsgesellscha'ft keinen Platz haben, und an das Glück des Konsumenten so gewöhnt ist, daß man auch darüber nur mehr müde lächelt. In einer Zeit, in der die menschlichen Kontakte zunehmend verflachen, ist die Masche mit dem Großen Freund vielleicht noch die wirksamste. Auf jeden Fall ist sie die billigste. Natürlich nicht der Führer und auch nicht der Vater, sondern der Kumpel. Nicht ohne Fehl und Tadel, aber mit einer glücklichen Hand, Ein Mann, der es irgendwie geschafft hat, irgendwie wird er es weiter schaffen.
Persönlichkeitswahlen auf etwas niedrigerem Niveau. Die Wechselwähler werden mitgehen, wenn man sie richtig anpackt. Auch Wechselwähler lassen sich einseifen. Wer seinen Schaum zu schlagen versteht, darf auch in Zukunft bei der Politik bleiben. Solange er nicht glaubt, daß der Brei vom Herumreden wirklich kalt wird.