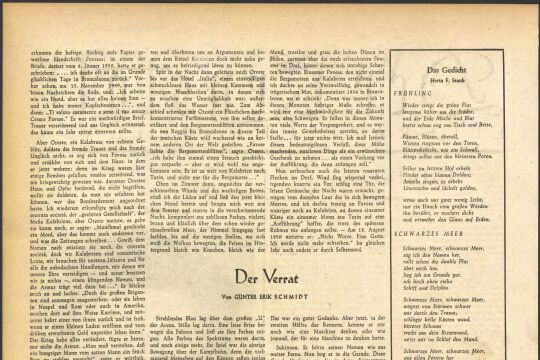Die Nation erbebt: Toni Brandl im ersten Durchgang gestürzt!
„Ein Omen?“ fragte, nur scheinbar besorgt, der „Express“ und erläuterte: „Ein Allround-Athlet wieKilly wächst da zweifellos nicht heran. Unser Toni wird sich entscheiden müssen, ob er ein Abfahrer oder ein Torläufer sein will.“ „Aber er sei eben“, schrieb das „Tagblatt“, „leider kein Taktiker, sondern ein Draufgänger: hätte auf sicheren Platz statt auf wackeligen Sieg spekulieren müssen.“ In Garmisch war er dann immerhin Neunter geworden, aber der Sturz in Madonna bewegte noch lange die Gemüter. Die „Nachrichten“ fühlten sich, unter dem Titel „Olympia-Trauma“, tief ein in die Psyche des traurigen Helden: „Diese ewigen vierten Plätze haben ihn nervlich zermürbt.“ „Aber Toni kommt wieder“, prophezeite der „Morgen“, auch auf der Sportseite stehen die Zeitungen ständig im härtesten Konkurrenzkampf, gerade wie die auf der Piste sich Tummelnden.
Mit der Nation bangt auch sein Eheweib, aus verständlichen, wenn auch ganz anderen, tief fraulichen Gründen. „Toni muß im Weltcup unter den ersten Zehn sein, sonst ist es aus. Ja, wahrhaftig, sonst ist es aus“, wiederholt sie stumpf, wie schon selber geschlagen. Es: das war jetzt im Februar die Olympiade, war auch sein Start in der nächsten, der übernächsten Saison in den schmuk-ken Farben des ÖSV-Teams, war aber eigentlich ihr Verhältnis mit Fuad Barsani, der, neben ihr auf dem Bettrand hockend, schwer an der Zigarette zog: wie einen Seufzer nach innen tuend. Fuad Barsani war Kurde: kurzes, doch dichtes Haar über niedriger, ständig gerunzelter Stirne; ein Doktor, der an dem örtlichen Krankenhaus hier seine Lehrjahre absolviert und danach eine Praxis eröffnet hatte. Und an dem Beginn dieser Praxis im schönen Kitzbühel, ihm ganz besonders verschönt durch die zahlreichen Beinbrüche vornehmlich westdeutscher Urlauber, welche zu ihm in Behandlung, beinah' wie am Fließband, abtransportiert wurden, war ganz leibhaftig — sie hatte sich tief in den Finger geschnitten — Roswitha gestanden. Er hatte sofort die hier richtige Diagnose gestellt und die Leidende richtig behandelt; ansonsten freilich baute er, der einst als Kinderarzt hatte zurückkehren wollen, jetzt eine neue Karriere, seine ganze Zukunft wortwörtlich auf Gips statt auf jenen Sand, dem er vorlängst, irakischer Staatsbürger letzter Ordnung, bereits verhaftet, entronnen war. Frühes Unglück — er war noch nicht zehn, als er erstmals tötete — in dem Kleinkrieg bald diesseits, bald jenseits der Grenzen stets fremder Länder, hatte ihn vorzeitig weise gemacht: weder suchte er nun sein Heil in der Ehe noch auch in fruchtlosen, weil nur die Zeit und das Geld verschlingenden Abenteuern mit Schönen der Nacht oder gar des Skihangs, sondern er suchte und hatte gefunden, die von gemeinsamem Egoismus wohlig gepolsterte Mittellage — auch Lage wortwörtlich — dazwischen: in der selbst der saubersten Ehe an Treue vergleichbaren, ja überlegenen Liaison mit Roswitha, des weißen Heroen gelangweilter Gattin. Selber langweilig war sie indessen mitnichten, im Gegenteil eher von Feuer und Flamme für alles echt Männliche, und gerade Männlichkeit eignete unserem Doktor in hohen Graden. Er war nämlich fähig, normal — mit dem Kopf und dem Herzen zugleich — zu denken, und hielt daher — um ein hier naheliegendes Beispiel zu geben — den Spitzensport für genau das, was er ist: ein Mittel der Volksverdummung, weshalb er, der Sport nämlich, hier in Österreich in das Ressort des Ministers für Unterricht fällt. Der Gips-Künstler, schon als solcher ein Mann des Maßes, verstieg sich sogar, wenn auch nur im Scherze natürlich, zu der trotz Roswithas beredtem Schweigen gewagten These, der Sport mache überdies impotent: Sportler — wir folgen hier nur dem Doktore — müssen gut aussehen, dieses zwingt sie zur Eitelkeit, Eitelkeit heißt sie den Bauch ständig einziehen, und eben dies Einziehn des Bauches verursacht dann Störungen, gleichsam Sperrungen, mit der Zeit dann gar Abtötung von Gefäßen und Nerven, welche im Bette von Nutzen sind. Wie auch immer: der Arzt, da er absolut keinem Sport oblag, war fast immer fit und genoß daher doppelt: den eigenen Genuß und Roswithas Vertrauen. Sie sagte: „Die ganzen Ferien waren verpatzt. Noch vor Weihnachten war da ein Photograph, dem überhaupt nichts auch nur halbwegs gepaßt hat: die vierte Kerze auf dem Adventkranz haben wir mindestens zwanzigmal anzünden müssen. Immer dieselbe herzbewegende Story: ältestes von fünf Kindern, der Vater erblindet von der Fabriksarbeit, Mütterchen auch unter Tränen noch lächelnd — zum Kotzen! Am Stephanitag dann der Verlagsmensch, ,Sie werden das Buch', sagte er wörtlich, ,schon wenige Tage nach der Schlußfeier fertig gedruckt haben', vorgestellt hat er sich als Diplom-Politologe. Aus Hamburg!“ Sie sagt das wie: aus dem Urwald! „Viel Haare?“
„Mehr Haare als Köpfchen. Schwärmt partout von den Italienern, bis ich ihm sage: ,es sind Tiroler', aber das hat er nicht gelten lassen, der lausige Herr Diplom-Politologe.“ Roswitha war — wie der Leser vielleicht schon bemerkt hat — keineswegs dumm, ja geradezu klug, sie hatte mit Auszeichnung maturiert, und nur mit der Aufklärung hatte es damals gehapert, daher dann das Kind (und daher dann die Heirat). Ihr Grimm also galt nicht den Sportlern direkt, sondern mehr deren Ausbeutern; weitaus den grol-lendsten hegte sie deshalb, verständlicherweise, gegen die Interpreten und Analytiker des Geschäftes als sportliche Spannung, Dramatik, Ästhetik. „Wie abgrundtief häßlich allein schon die Kleidung ist“, sagte der Doktor; milder gestimmt fuhr sie fort: „Dann der Mann von Völkl. Die draußen würden ihn ja übernehmen, aber das stinkt dann doch gar zu arg, findest du nicht?“
„Non olet, dum omnis olet“, sagte der Doktor in seinem Latein.
„Dum omnia olent“, korrigierte sie ihn.
„Aber ,omnis' geht auch.“
„Wieso ,omnis'?“ Im Lateinischen war sie acht Jahre lang einsame Spitze gewesen.
„Es stinkt nicht, wenn jeder stinkt“, sagte der Doktor. „Klassisch, geradezu dichterisch wäre natürlich: ,omnia dum olent'. Übrigens hat er sie eben so in der Hand wie sie ihn. Er kann sie erpressen, geradezu.“
„Freilich. Das bringt aber nichts. Denn das Geld ist schon weg. Dabei ist noch nicht einmal alles vom Rohbau bezahlt.“
„Wieviel braucht ihr?“
„Der Trottel hat einen Wechsel gegeben.“ Sie genehmigte sich einen Schnaps aus der Hausbar unter dem Herrgottswinkel. „Aber auch Schranz war ein Feigling: erst auspacken wollen, doch dann nur sich feiern, sich triefend bemitleiden lassen.“
„Aber er ist aus dem Wasser.“
„Wie lange? Ewig geht das beim Toni nicht weiter.“
„Schranz war in Sapporo dreiunddreißig.“
„Du weißt: ich nehme von dir kein Geld.“ Der Doktor, sie wußte das, unterstützte nicht nur seine Schwestern in Israel und in Persien, sondern spendete auch für die „Demokratische Kurden-Partei“, für die „Kurdistan Review“, für Informationsbüros in Paris und in Düsseldorf; selber lebte er eher spartanisch (zwei Zimmer, VW). Er sagte: „Ich verdanke ja schließlich mein Geld auch dem Toni. Ohne Spitzensport kein Massensport, ohne Massensport keine Beinbrüche, oder grad nur für die Professoren, ' Mohammed RJsa Schah Pehiewi kommt bestimmt-nicht zu mir in die Ordination.“
„Mir ist nicht nach Blödeln.“
„Ich blödle nicht, sondern ich kalkuliere. Ich hab' die Statistiken und die Prognosen studiert. Rossignol, zum Beispiel, rechnet für heuer mit 7 Prozent, und wenn die Franzosen Medaillen machen, sogar mit rund 10 Prozent Umsatzplus. Noch optimistischer sind die Deutschen, natürlich; und schlechthin phantastisch sind die globalen Schätzungen: mindestens 1000 Prozent in zehn Jahren. Auf die fünf kommenden Jahre umgeschlagen, gibt das den Durchschnitt von 340 Prozent mehr Skifahrer. Also werden um 340 Prozent mehr zu uns kommen, also wird es um 340 Prozent mehr Beinbrüche geben. Aber die einfache Hochrechnung stimmt nicht, man muß da noch andere Faktoren mit ins Kalkül ziehen: einmal, daß viel mehr Prestige-Fahrer kommen werden — macht also, sagen wir, weitere 170 Prozent —; und zum anderen, daß im Gedränge ja zweifellos noch mehr Verluste als heute beklagt werden müssen, allein schon durch Kollisionen — also noch einmal 170 Prozent —; und das gibt dann insgesamt 680 Prozent. Oder ganz konkret: Auf einen heutigen Beinbruch kommen dann, schon in fünf Jahren, annähernd sieben — wie soll ich das eigentlich noch verkraften?“
„Wenn dann der Toni arbeitslos ist, dann komm' ich dir helfen — gegen Prozente von den Prozenten.“
„Du müßtest dich jetzt schon ausbilden lassen, jetzt kriegst du dafür ja sogar noch bezahlt.“
„Du bist dumm ...“
„Nein, ich schwöre: Ich will dich nicht heiraten! Aber als Assistentin, im weißen Kittel: das fände ich praktisch in jeder Hinsicht.“ Inzwischen lief übers Fernsehen grade die Abfahrt in Wengen, „zweitbeste Zwischenzeit, Toni bleibt mit den Stök-ken drinnen, er geht jetzt aufs Ganze, er hasardiert, er steht jetzt zu viel auf den Kanten“, die Stimme gellte, ist „weggerutscht mit dem rechten, pardon, mit dem linken Ski, hat sich noch einmal erfangen“, von Hektik abrupt ins Lethargische kippend, „gestürzt, gestürzt, gestürzt.“ Und: „Sqhade, schade, nach dieser Zwischenzeit!“ Fuad Barsani seufzt nach innen, aber Roswitha platzt heraus: „Das Pillen-Fressen hat ihn kaputt gemacht!“ Der Doktor sagte nur melancholisch: „Psy-cho-Training ist noch viel schlimmer.“ Sie höhnte: „Und das nennt sich Sport!“ Er sagte: „Wenn alle gedopt sind, ist Doping nicht unehrenhaft.“
„Darum nur geht's noch, wer besser gedopt ist!“
„Nicht, wer den bessern Trainer hat, sondern den besseren Arzt?“ Sie fachte: „Den besten hab' ich!“ Sie hatte seit Wochen schon kaum mehr gelacht, hatte vorerst auch weiterhin nichts zu lachen, denn aus Rundfunk und Fernsehen schallten nur kaum noch verschleierte Hiobsbotschaften: Zwölfter in Schladming, und alte Meniskus-Verletzung wieder akut, und Sturz in Cortina, dann allerdings immerhin Vierter beim Hahnenkamm-Rennen, dann endlich Siege in Slalom und Riesentorlauf, „Riesentorlauf ist immer noch seine Domäne“, schrieben die Zeitungen, wieder begeistert. Aber dann Kitzbühel: eine Blamage nur: eine Sekunde Rückstand bereits in der Zwischenzeit, und dann der Sturz in der Kurve vorm Ziel, „und damit ist fraglich“, weissagte der Reporter, „ob dieser Pechvogel auch bei der Olympiade die rot-weiß-roten Farben vertreten wird.“
„Schad' um die Farben“, meinte der Doktor, welcher als Ausländer noch erlitt, was der deutschen Sprache vom Sportjournalismus angetan wurde; während Roswitha nur hemmungslos weinte. Auch aus den Zeitungen kam ihr kaum Trost, man verstieg sich bereits auch zu Invek-tiven: „Flachland-Tiroler“ war schier noch das Mildeste, was man ihm an den noch brummenden Kopf warf. „In Kitz“, so klärte das „Tagblatt“ sein Publikum auf, „fährt er immer zu brav, zu verhalten, zu vorsichtig, um sich vor seinem heimischen Publikum ja keine Blöße zu geben“; und der „Expreß“ sekundierte diesmal: „Typisch kein Heimsieger“. „Brandl war nie ein perfekter Glisseur“, schrieb der „Morgen“'. Die „Nachrichten“ attestierten ihm, wenn auch ganz ohne ersichtlichen Anlaß, Mut zum Comeback sowie eine merkbar verfeinerte Kurven-und Umsteigtechnik. Eine Synthese von Patriotismus und Wissenschaft endlich entdeckte die „Rundschau“: „Was ist los mit Österreichs Wachs?“ Doch mitten hinein in die pessimistischen Diskussionen der Interessierten, auch unserer Liebenden also, platzte der kaum noch erträumte Triumph dann in Val d'Isere. Die Landsleute ausgefallen: erkrankt, beim Training verletzt, auf dem eisigen Kurs gestürzt oder hoffnungslos abgeschlagen, er mit der denkbar schlechtesten Startnummer — und dann der eindeutig klare Sieg nicht nur über Franzosen und Schweizer, auch über die ganz überraschend schnellen Kanadier, über die angeblich unschlagbar starke Elite von Italien. „Bravo, Toni, du bist der Größte!“ artikulierte der Fernseh-Repor-ter den Rülpser, der die Nation von dem Alpdruck erlöste. „Toni hat unsere Ehre gerettet! Toni ist gut für olympisches Gold!“
„Aber Silber war' besser“, sinnierte der Doktor. „Bronze wäre bloß etwas mehr als nichts: nur ein Trostpreis. Gold aber wäre zuviel.“
„Warum glaubst du?“
„Wenn er Gold macht, tritt er womöglich ab, um als Held in die Sportgeschichte, ins weiße Walhalla ein-zugehn, statt dann, ein paar Jahre später, wenn's endgültig aus ist, als nationaler Sündenbock sich verdrük-ken zu müssen; das reicht dann schon nicht einmal mehr für Sun Valley.“
„Die nehmen doch jetzt schon den letzten Dreck.“ „Er kann nach St. Pölten gehen,das Geschäft übernehmen; sonst aber nichts mehr. Bronze ist Sankt Pölten.“ Ihr schauderte bei dem Gedanken. St. Pölten hieß nicht nur: Sportartikel und Tankstelle, sondern auch: weit weg von Kitzbühel, weit weg von Fuad. Nach Sun Valley, nach Aspen, in die chilenischen Anden mitzugehen, würde sie einfach verweigern können, schon mit dem Hinweis auf ihr dann die Schule besuchendes Kind. Doch St. Pölten drohte und dräute konkret. Und sie sagte: „Ja, Silber. Silber ist Anerkennung und Ansporn zugleich. Mit Silber darf er noch bleiben und muß er noch bleiben.“
„Ja“, schloß der Doktor den Kriegsrat, „Gold wäre schlimm. Gold suggeriert ihm, etwas zu tun, was die Zeitungen .Abschied im Zenit' nennen.“ Aber im Riesentorlauf, der Disziplin also, wo ihm am ehesten noch eine Goldmedaille zu winken schien, langte es doch nur für Bronze: schon im obersten Drittel war er zu eckig gefahren, zu wenig auf Angriff, und selbst sein mit Recht so berühmter Schlittschuhschritt knapp vor dem Ziel hatte nicht mehr genügt, ihn mit Bestzeit ins Ziel zu tragen. Und Bronze hieß: St. Pölten. Roswitha trank Schnaps. Die „Nachrichten“ brüsteten sich: „Wie erwartet“. Der „Morgen“ schaltete zeitgerecht um: „Jetzt erst recht unsre Daumen für Toni drücken!“ Das „Tagblatt“, seriös, gab indes zu bedenken, daß Diskussionen gerade jetzt nicht am Platz seien: sie raubten ihm, Toni Brandl, die eben im Slalom nötige äußerste Konzentration, welche seine Stärke ja nie recht gewesen. „Mit Rücklage ohne seelisches Rückgrat ist da“, so schloß der Artikel, „gewiß nichts zu holen.“ Er machte, obwohl es ihn einmal fast aushob, doch immerhin Silber: Roswitha und Fuad atmeten ruhiger, während ganz Österreich atemlos keuchte: im Abfahrtslauf hatte er keine Chancen. „Er hat sich verausgabt“, meinte ein westdeutscher Kommentator, und eben das selbe hofften die Liebenden. „Wenn nur kein Eis ist“, bangte Roswitha. „Auf Eis fährt er meistens am besten“, sagte sie. „Einmal falsch atmen“, sagte der Doktor, „heißt schon: wir sind gerettet.“ Es war dann recht eisig, er atmete richtig, fiel unten zu Boden, doch schon als der Sieger, das Staatsvolk jubelte: grölend besoff es sich, quietschte und grunzte, spottete buchstäblich jeder Beschreibung. Und wie zwei vergilbte Blätter von Rosen im späten Herbst auf stürmisch gepeitschtem, hoch welligem Teiche, von nichts als der Adhäsion mehr beisammen gehalten, schaukelten, taumelten leblos Roswitha und Fuad auf den nun allüberall lauthals zitierten Wogen des * Beifalles und der Begeisterung, welche den Helden alsbald würden heimtragen und dann '— nun trank auch der Arzt einen Schnaps — nach Sun Valley schwemmen, ja gar nach St. Pölten. Mitten im Siegesrausch der Nation — auch die Schmach von Sapporo war getilgt — aber litten die zwei unter grausen Visionen, gewissermaßen wie im Delirium tremens, wiewohl doch gerade sie selber durchaus keine Säufer gewesen.
Im Ohr noch die Interviews vor der zappelnden, winkenden, sich schon verlaufenden Jubel-Kulisse, sahn sie sich eins von dem andern gerissen, tödlich geteilte Siam-Zwillinge
gleichsam; Roswitha sagte: „Das ist
zu viel, ich lasse mich scheiden.“ Dies Unerwartete alarmierte nun
freilich des Doktors zur Stunde nicht
hellwache Sinne, und er sagte: „Ich
weiß, was du tust.“
„In St. Pölten?“
„Nein, hier; und jetzt.“ Sie schaute noch immer verzweifelt dem Freund in das plötzlich erhellte Gesicht, bis auch ihres zu strahlen begann. „Ja, das werde ich.“
„Wirklich?“
„Ja, wirklich. Wir werden einander jetzt weniger sehen“ — sie legte behutsam die Hand in die seine —, „vielleicht ein paar Wochen lang sehr weniger.“ Beide wußten, daß Schweres vor ihnen lag, Schwerstes vor ihr, da sein Platz an ihrer — verständnisvoll ausgedrückt — Seite nun gar nicht mehr sicher war. „Ja, ich will kämpfen: auch in vier Jahren wird er noch starten.“ Und noch einmal: „Ja, ich werd' kämpfen. Und glaub mir, Geliebter: Ich kann das doch sehr viel besser als er.“