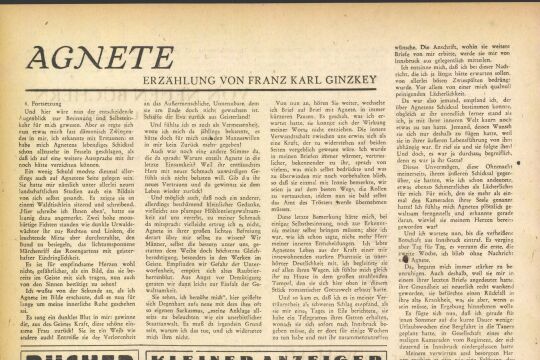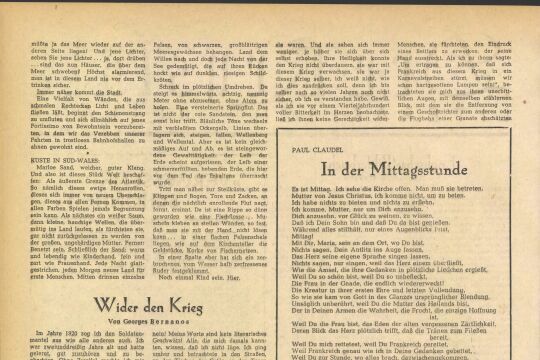Der Tod einer Tochter
Als die „Washington Post" den folgenden Artikel über ein 25jähriges Mädchen publizierte, die, nach ihren eigenen Worten, „glücklich" in einem „Hospiz" starb, wußten wenige Leser, was das Wort „Hospiz" bedeutete. Aber der Artikel wurde von vielen Zeitungen in den USA abgedruckt und die Autoren erhielten 10.000 Briefe, und Hunderte von verschiedenen Gruppen arbeiten seither laufend an der Errichtung von „Hospizen" in ihren Gemeinden. Das Hospiz ist für eine spezialisierte Art der Krankenfürsorge bestimmt, bei der es vor allem um die Bekämpfung von Schmerzen und anderen Symptomen tödlicher Krankheiten geht.
Als die „Washington Post" den folgenden Artikel über ein 25jähriges Mädchen publizierte, die, nach ihren eigenen Worten, „glücklich" in einem „Hospiz" starb, wußten wenige Leser, was das Wort „Hospiz" bedeutete. Aber der Artikel wurde von vielen Zeitungen in den USA abgedruckt und die Autoren erhielten 10.000 Briefe, und Hunderte von verschiedenen Gruppen arbeiten seither laufend an der Errichtung von „Hospizen" in ihren Gemeinden. Das Hospiz ist für eine spezialisierte Art der Krankenfürsorge bestimmt, bei der es vor allem um die Bekämpfung von Schmerzen und anderen Symptomen tödlicher Krankheiten geht.
Manchmal entwickeln sich die Dinge, vor denen man die größte Angst hat, ganz anders als man sie vorher gesehen hat. Unsere Tochter Jane war an einer besonders schmerzhaften Art von Krebs erkrankt und wir zitterten bei dem Gedanken an die unerträglichen Qualen, die ihr noch bevorstanden. Später stellte sich heraus, daß sie am tiefsten gelitten hatte, solange die Ärzte sich geweigert hatten, ihr zu sagen, wie groß ihre Uberlebenschancen seien. Als man ihr schließlich nach vielen Monaten der Ungewißheit sagte, daß ihr nicht mehr, sondern weniger Zeit blieb, weinte sie ein wenig, und lächelte dann durch ihre Tränen, mit einem kleinen Seufzer fast der Erleichterung.
„Nun, da ich es weiß", sagte sie, „möchte ich jeden Tag genießen, der mir noch bleibt. Ich will glücklich sein - und ich möchte, daß Ihr mir helft, glücklich zu sein." Langsam schleppte sie sich mit Hilfe eines Stockes durch den Garten - sie war aus dem Spital für ein Wochenende zwischen den Behandlungen zu uns nach Hause gekommen. Es sollte das letzte Mal sein, daß sie unter den Bäumen spazierenging, und sie sagte zu uns: „Jeder Tag ist nun ein Geschenk für mich."
Wir versprachen ihr, daß sie zu Hause sterben würde, aber zuerst mußte das Spital davon unterrichtet werden. Als sie sich anfangs geweigert hatten, ihr zu sagen, daß'sie sterben würde, hatten wir gemeint, wir würden vielleicht selber mit ihr reden, aber die Ärzte waren nicht damit einverstanden. „Man sagt einer Fünfundzwanzigjährigen nicht, daß F sie stirbt und verdirbt ihr damit die Zeit, die ihr noch bleibt", sagten sie. „Sie wissen ja nicht, ob sie noch Wochen, Monate oder Jahre leben wird. Wir haben immer wieder Remissionen erlebt... Wir wissen, wie man so etwas behandelt, wir kennen so viele ähnliche Fälle ..." Und als Janes Bruder uns dann aus Amerika mit Telefonanrufen bombardierte, daß er sicher sei, Jane würde die Wahrheit wissen wollen, konnten wir nur, von den Ärzten eingeschüchtert, erwidern, daß sie mehr davon verstünden. „Es ist ihr Leben", sagte Richard immer wieder. „Laßt sie entscheiden, was sie mit dem Leben machen will, das ihr noch bleibt."
Die Ärzte wollten sie wieder bestrahlen, verschrieben ihr eine weitere chemotherapeutische Behandlung, wollten ihr einen Gipskragen anlegen, um die Schmerzen in ihrem Hals zu lindern - all das bedeutete, daß sie im Spital bleiben müsse. Man hatte die Ärzte dazu erzogen, Menschenleben zu retten, und sie wollten um jeden Preis Janes Leben verlängern, obwohl sie wußten, daß ihre Chancen minimal waren. „Wir dürfen nicht aufgeben", sagte der junge Arzt immer wieder. „Sie ist zu jung, um zu sterben." Er, der schon so viele Mensehen hatte sterben sehen, hatte sich noch immer nicht daran gewöhnen können.
Die Wahrheit sagte ihr dann schließlich der praktische Arzt aus unserer Gemeinde, der Jane schon als Kind gekannt hatte. Und als man im Spital erfuhr, daß man es ihr gesagt hatte, wurde die Behandlung beschleunigt, damit sie nach Hause entlassen werden konnte.
Wir holten sie aus dem Krankenhaus in London zu uns nach Dairy Cottage in die stille englische Landschaft von Buckinghamshire, wo sie von ihrem Bett neben dem Fenster die Eichkätzchen im Garten beobachten konnte. Jane fühlte sich wohler als im Krankenhaus und wir hofften zuversichtlich, daß wir ihre Pflege mit Hilfe des Hausarztes und der „mobilen Krankenschwestern" bewältigen würden. Sie hatte sich gewünscht, zu Hause zu sterben, fürchtete nur, daß sie, wie sie sagte, „eine Belastung für uns sein würde". Als sie sah, wie sehr wir von dem „National Health Service" unterstützt wurden, war sie beruhigter.
Ihr Bruder war aus Amerika zurückgekommen. Wir bauten ein Vogelhaus vor ihrem Fenster auf. Immer mehr Vögel kamen und Jane rief voll Freude aus: „Ein Grünfink ... ein Spatz ..." Sie war guter Stimmung, vergaß die schrecklichen Monate im Spital und sagte uns, welche Freunde sie gerne sehen würde, um ihnen Lebewohl zu sagen - bis eines Tages ihre Krebserkrankung wieder neu aufflammte und immer schneller fortschritt. Die Schmerzen in ihrem Körper nahmen derart zu, daß sie es nicht mehr ertrug, berührt, geschweige denn gehoben oder gewaschen zu werden.
Jane wußte, daß es Hospize für Sterbende gab, die vor nicht allzulanger Zeit vom National Health Service eröffnet worden waren. Sie hatte ein- oder zweimal leises Interesse dafür bekundet, wenn sie sich Sorgen machte, daß sie „eine Belastung für uns sei". Aber wir hatten ihr versprochen, daß sie zu Hause sterben würde, wie konnten wir ihr jetzt sagen, daß sie in einem dieser Hospize vielleicht bessern daran sei?
Jane löste dieses Problem selber. Würden sie dort wirklich in der Lage sein, ihr die Schmerzen zu nehmen? Nur das interessierte sie noch, denn die Schmerzen wurden immer ärger -nicht nur von Tag zu Tag, sondern von Stunde zu Stunde. Als die Männer vom Rettungsdienst sie vorsichtig aus dem Haus trugen, sangen die Vögel, aber sie schien es nicht mehr zu bemerken.
Als Jane in das Einzelzimmer getragen wurde, das man im Hospiz für sie hergerichtet hatte, waren ihre Schmerzen, die schon zu Hause unerträglich gewesen waren, doppelt so stark geworden. Wie wird ein unerträglicher Schmerz noch unerträglicher? Wie die Ärzte im Hospiz uns später erklärten, kann die Angst vor zu erwartenden Schmerzen diese noch intensivieren. Trotz aller schmerzstillenden Mittel, die Jane vor und nach dem Transport in das Hospiz verabreicht worden waren, nahmen die Schmerzen zu. Die erste Eskalation der Schmerzen hatte die Angst vor noch mehr Schmerzen bewirkt.
Was dann geschah, war nicht ein Wunder, sondern die langsame und überlegte Anwendung von medizinischen Kenntnissen und liebevoller Fürsorge, mit der die Schwestern sich um diese neue Krebspatientin -und ihre Familie - bemühten. Der Arzt fragte Jane, was sie sich wünsche. Sie wollte einen von uns, ihren Vater oder ihre Mutter, um sich haben - immer, bis sie starb. Nichts leichter als das. Die Schwestern rollten ein zweites Bett in Janes Zimmer, und von da an war einer von uns immer bei ihr. Tag und Nacht. Und wenn wir einmal hinausgingen, um mit dem Arzt zu sprechen, kam eine Schwester, oder einmal, als die Schwestern gerade keine Zeit hatten, der Portier, um ihre Hand zu halten und mit ihr zu reden. Sie fragten, ob wir uns abwechseln wollten oder lieber beide im Hospiz wohnen wollten. Wir bekamen ein Doppelzimmer. Es war genauso wichtig, def Familie zu helfen wie dem Patienten, erklärten sie uns. Jane würde sich viel besser eingewöhnen, wenn sie wüßte, daß wir glücklich seien.
Glücklich? Wie kann man dieses Wort unter solchen Umständen verwenden? Und doch benützte Jane selber dieses Wort immer wieder, nachdem man ihre Schmerzen zu lindern verstanden hatte. Sie benützte es, um ihre Stimmung zu beschreiben - und drang in mich, diese Stimmung mit ihr zu teilen. Ich gab vor, dies auch wirklich zu tun, natürlich - was hätte ich nicht getan, um sie glücklich zu machen? Wenn sie glücklich war, so war ich es auch -oder behauptete zumindest es zu sein, denn das Wort bedeutete mir nichts. Jane blickte mich nachdenklich mit leisem Lächeln an. „Dad, Du sagst es nur. Das nützt nichts. Es gibt nur eine Methode, damit Du es auch akzeptierst - eine dialektische Diskussion."
Und wir begannen - ihr zuliebe -eine dialektische Diskussion. Wir hatten noch nie zuvor über meine Einstellung zum Tod gesprochen. Jetzt sagte mir Jane, worüber ich mir selber nie im klaren gewesen war: Ich hätte Angst vor dem Sterben, meinte
Jane, und solange ich für mich Angst hätte, würde ich auch für sie Angst haben. Sie jedoch könne die freudige Hinnahme ihres Todes nur so lange empfinden, als ich diese Stimmung mit ihr teilte. Sie könne glücklich sein, wenn sie auch uns glücklich machen könne, meinte sie. Wenn sie uns das hinterlassen könne, sagte sie, wenn sie uns zeigen könnte, daß es möglich sei, in Frieden und mit Würde zu sterben, wenn unsere Zeit gekommen sei - das zurückzulassen, sagte sie, wäre wunderbar, es wäre das größte Geschenk, das sie uns machen könnte. Und indem wir dieses Geschenk annähmen, gäben wir es ihr zurück und würden ihr das Sterben leicht machen. Und so geschah es.
Unter all ihren Freunden war nur eine, die sich nicht mit dem Gedanken abfinden konnte, daß Jane sterben müsse. („Laßt sie nicht allein nach Hause fahren", sagte Jane, nachdem die Freundin gekommen war, um sich für immer zu verabschieden, „sie ist zu traurig.") Uns anderen gab Jane etwas, das uns immer bleiben wird und das wir an andere weitergeben werden, wie sie es von uns erbeten hat. Wir mußten ihr versprechen, daß wir darüber schreiben würden. Vielleicht würde das die Idee des Hospizes in England und sagte sie.
Ein junges Mädchen in Janes Alter, das im Londoner Spital geblieben war, nachdem Jane es verlassen hatte, starb elend und unter Qualen, von Schmerzen gepeinigt und in Verzweiflung; man sagte ihr nicht, daß sie sterben müsse, obwohl sie dies ohne Zweifel ahnte und fürchtete.
Im Hospiz hatten die Ärzte sorgfältig die verschiedenen Quellen von Janes Schmerzen studiert und differenziert behandelt. Sie warteten nicht ab, bis die Wirkung der Mittel nach zwei Stunden wieder nachließ, sondern sorgten dafür, daß die Medikamente verabreicht wurden, bevor der Schmerz eine Chance hatte, Jane wieder zu überfallen.
Wahrscheinlich war Jane nie vollkommen schmerzfrei, aber die Schmerzen waren erträglich geworden. Sie konnte sich an Musik freuen. Eines Morgens spielte ich eine Mozart-Kassette, als sie aufwachte. Sie öffnete langsam die Augen, hörte ein paar Minuten mit offensichtlicher Freude zu und blickte mich an. Woran mag sie denken, dachte ich bei mir, wenn sie Mozart zuhört - daß sie all diese Schönheit zurücklassen muß - um im Nichts zu versinken? Daran dachte sie in keiner Weise. „Wie schön du es für mich machst, zu sterben", sagte sie langsam.
Sie führte lange Gespräche mit dem Arzt und den Schwestern. Jeder hatte Zeit für sie, für sie und alle anderen Patienten, die gerne reden wollten. Das war ein Teil der Behandlung. „Ich kann nicht Doktor soundso zu Ihnen sagen", meinte Jane nach ein paar Tagen. „Nennen Sie mich Robert", antwortete er sehr sachlich.
„Wie wird es sein, zu sterben?" fragte sie bei einer anderen Gelegenheit, und bevor wir Zeit hatten, uns irgendeine passende Antwort auszudenken, sagte die Schwester, die gerade in Janes Zimmer getreten war: „Sie werden wahrscheinlich einfach einschlafen, Jane, und gar nichts spüren." Die Schwester wußte im Gegensatz zu uns, daß Jane in Wahrheit gefragt hatte, ob es wie ein großer, aufflammender Schmerz sein würde, wie ein wilder Krampf, ob sie empfinden würde, daß ihr Körper zerbräche, ihre Organe zerrissen. Jane schloß kurz ihre Augen, um in sich aufzunehmen, was die Schwester ihr gesagt hatte, und öffnete sie dann wieder mit einem Ausdruck, der erkennen ließ, daß sie glaubte, was man ihr gesagt hatte. Und dies gab ihr einen Frieden, wie sie ihn seit Beginn ihrer Krankheit nicht gekannt hatte. Das spielte eine andere bedeutende Rolle im Hospiz. Im Krankenhaus war Jane nie sicher gewesen, daß man ihr die Wahrheit sagte. Im Hospiz wußte sie, daß man sie nie belügen würde. Und das kann, wenn man stirbt, wichtiger sein als irgendeine medizinische Behandlung.
Wenn wir uns fragen, wodurch es geschehen konnte, daß Jane immer wieder sagte, sie sei glücklich, zu 'sterben, fällt uns keine wirkliche Antwort ein. Die einzig befriedigende Antwort bestünde aus hundert kleinen Geschehnissen im Hospiz während ihrer letzten Tage. Zum Beispiel: Als sie sagte „Ich würde gerne ein Stück Samt angreifen, bevor ich sterbe", brachte man ihr ein Stück Samt. Sie berührte es, und eine Schwester legte es ihr dann auf ihre bloße Schulter, wo es blieb - für immer.
Die entspannte und ungezwungene Atmosphäre in dem Hospiz, die mehr an das Leben in einer Familie als in einer Anstalt erinnert, trägt viel dazu bei, dem Patienten und seiner Familie das Leben zu erleichtern. Es gibt kein eiliges Klappern von Füßen auf harten Fußböden, kein Gefühl - wie in den Krankenhäusern -, daß jetzt jemand viel wichtigerer, viel kränkerer an der Reihe ist. Der Arzt kommt nicht mit großem Gefolge, sondern gewöhnlich allein, er spricht leise, er hat keine Eile.
Die beste Erklärung für das, was in einem Hospiz geschieht, stammt vielleicht von Robert, dem Arzt. Die Be-handlungsweise, sagte ■ er, beruhe darauf, die Krankheitssymptome zu erleichtern, den Patienten seelisch zu unterstützen und ehrlich mit ihm zu sein.
Während ihrer langen Krankheit muß Jane oft daran gedacht haben, wie furchtbar der letzte völlige Zusammenbruch sein würde, doch nun, da es geschah, war es gar nicht furchtbar - und dafür war allein das Hospiz verantwortlich. Es seien die glücklichsten Tage ihres Lebens, sagte sie, denn es gäbe nichts Wichtigeres im Leben, als geboren zu werden und zu sterben. Bei der Geburt, sagte sie, wußte ich gar nichts, und alles um mich hier ist gut und nicht böse. Das ist eine schöne Art zu sterben.
Sie war acht Tage im Hospiz. Als ihr Bewußtsein schwand und ihr Atem immer flacher wurde, betteten die Schwestern sie immer noch alle paar Stunden um, damit sie kein Unbehagen empfände. Wir saßen beide an ihrer Seite, jeder hielt eine ihrer Hände, als Jane aufhörte zu atmen, leicht, leise, in tiefem Schlaf, so wie die Schwester es ihr versprochen hatte. Wir saßen noch eine Weilen und küßten ihre Lippen und strichen über das Stück roten Samtes. Als wir das Hospiz verließen, wußteh wir, daß wir eines Tages anderen Menschen erzählen würden, wie Jane gestorben war, in der Hoffnung, daß es auch ihnen helfen würde.
Jane starb am 25. Juni um fünf Uhr früh. Ihre Krankheit hatte im Februar begonnen.
„Ich brauche keinen Gegenstand, der mich an Jane erinnert", sagte eine ihrer Freundinnen. „Jane lehrte mich Brot zu backen. Immer wenn ich Brot backe, denke ich an Jane." Bevor sie starb, sprachen wir darüber, wie Menschen in der Erinnerung derer, die sie beeinflußt haben, durch all das, was sie getan haben, weiterleben. So würde sie weiterleben, hoffte Jane. So wird sie weiterleben.