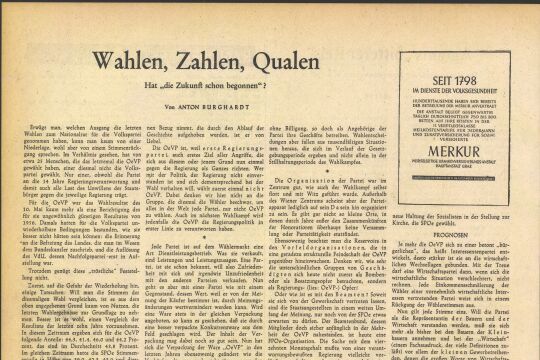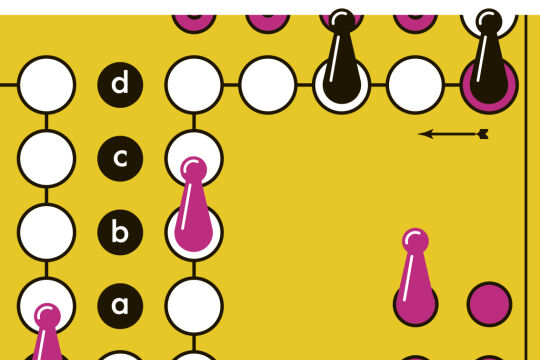Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Der Ton strebt einen? Tiefpunkt zu“
Unsere derzeitige politische Situation kann am besten mit dem Adjektiv „manichäisch" gekennzeichnet werden. So wie bei den Manichäern der Dualismus Licht—Finsternis im Vordergrund stand, so ist es auch heute zwischen den beiden großen politischen Lagern unseres Landes: Man igelt sich immer mehr in Mißtrauen und Feindseligkeit ein, die Schwarzweißzeichnung dominiert, es scheint, als ob wegen des dauernden gegenseitigen Verteufeins der Faden des Gespräches immer dünner würde. Jene, die sich in der Stille bemühen, die Brücken nicht ganz abzubrechen, werden systematisch denunziert.
Mit der Reideologisierung der politischen Gruppen wächst auch die Radikalisierung, in der Volkspartei wie bei den Sozialisten. Immer häufiger hört man die Worte, man müsse es „den anderen zeigen", man müsse „dreinhauen". Überall sind Jungtürken am Werk, arollend im Unteroder Hintergrund, von maßlosem Ehrgeiz (und meist ebensoviel Realitätsferne) getrieben. Bei der ÖVP: Hinter dicken Brillengläsern blicken einem düster mal-kontente Intellektuelle aus politischen Magazinen entgegen, die meinen, den Stein der Weisen für die Regeneration ihrer Partei gefunden zu haben, in Wahrheit aber vergrößern sie nur das ohnehin schon bestehende Chaos. Bei ihren fconspi-rativen Bestrebungen kommt ihnen zugute, daß sich die Partei noch längst nicht gefangen hat, daß maßgebende Männer den Verlust von Machtpositionen einfach nicht verwinden können, daß die schöpferische Idee nach wie vor fehlt. Bei den Sozialisten ist es nicht viel anders: Dort hat es der Bundeskanzler schwer, die nachdrängenden Radikalen und ideologisch Verkrusteten im Zaum zu halten, weiß er doch, daß das von ihm mühsam aufgebaute liberale Image seiner Partei durch deren Aktivität nur zerstört werden kann. Schon die nächsten Monate können nicht nur neue Konstellationen, sondern auch Überraschungen bringen. Nun ist ein Wahlkampf angelaufen, der längst nicht mehr nur um die Person des Staatsoberhauptes geht, sondern der auch kräftig mit parteipolitischem Gezänk aufgeladen wurde. Er wird das Seine dazu beitragen, die Kluft zwischen den Parteien noch breiter und tiefer werden zu lassen. Leidtragend dabei ist das Land, denn der Probleme, die, wenn schon nicht in gemeinsamer Regierungsverantwortung, so doch wenigstens auf einer Gesprächsbasis der Fairneß, der gegenseitigen Achtung und der Übereinstimmung in den staatspolitischen Grundsatzfragen angepackt werden müßten, gibt es nicht wenige. Das ist die Stunde der Liberalen. Es wird gebeten, diesen Begriff vom Schutt der Vergangenheit zu reinigen. Reminiszenzen an antiklerikale und kapitalistische Züge des Liberalismus sind in diesem Zusammenhang ebenso deplaciert wie die modische Interpretation des Begriffes als „l inks-liberal". Liberal — das soll nichts anderes heißen als tolerant, bereit zum Gespräch mit dem anderen (bitte, nicht immer vom „Gegner" sprechen!), aber ohne Verzicht auf eine eigene Meinung und unter Wahrung der Selbstachtung, einfach aus der Überzeugung, daß es in der Stille wirkende Kräfte der Verständigung geben muß. Die schrecklichen Vereinfacher — mit Viktor Frankl sollte man besser von „schrecklichen Verallgemeinem" sprechen — sorgen schon dafür, daß „der andere" grundsätzlich schon deswegen verteufelt wird, weil er einer anderen Partei angehört. Der Ton zwischen den großen politischen Gruppen strebt einem neuen Tiefpunkt zu. Gewiß, auch in anderen Phasen der Zweiten Republik ist es nicht nur nobel zugegangen, aber bei aller Schärfe hatte man doch Gewißheit, daß die Männer in der Führung der großen Parteien durch ein gemeinsames Schicksal und durch ein gemeinsames Verantwortungsgefühl verbunden waren. Insbesondere, daß sie aus dem Todeskampf der Ersten Republik gelernt hatten. Dieser Kitt fehlt heute immer mehr, drängen doch die eiskalten Manager der Macht nach vorne, die im Grunde wie Versatzstücke im Theater zwischen „links" und „rechts" austauschbar sind, nur nach Publicity und dem besten TV-Auftritt schielend. Manches erinnert heutzutage schon wieder fatal an die zwanziger und die dreißiger Jahre. Der eine oder andere forsche junge Reformer wird ersucht, mehr in zeitgeschichtlichen Werken zu blättern als in soziologischen Bestsellern. Den Sozial- und Wirtsdiaftspartnern und ihren Organisationen kommt jetzt eine neue, schwere Verantwortung zu. Sie können es sich leisten, nicht im Schlepptau der Parteien zu segeln und freimütig ihre Meinung zu äußern. Bei ihnen sind die wahren Realisten der Politik, sie missen besser, wo die Probleme liegen und daß man sie nur gemeinsam lösen kann. Besser jedenfalls, als viele ambitionierte Intellektuelle (hüben wie drüben), die sich jung und progressiv gebärden, in Wirklichkeit aber Reaktionäre in des Wortes schlimmster Bedeutung sind. Allem maliziösen Gerede vom „Kammerstaat" Osterreich zum Trotz: Auf die Sozialpartner, ihren Common sense und ihr Verantwortungsgefühl kann weniger denn je verzichtet werden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!