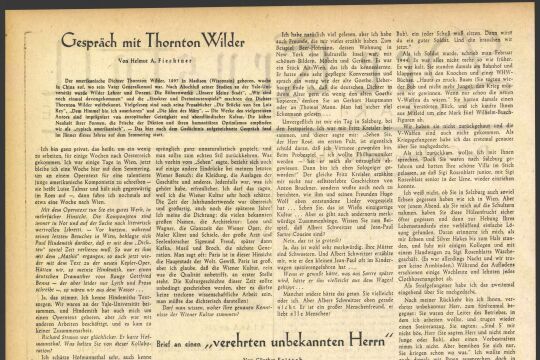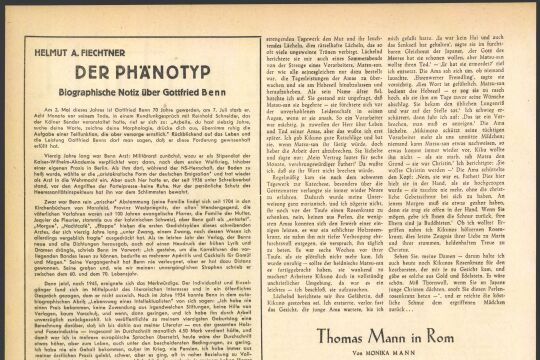„Dichter sein ist kein Beruf...“
Es ist nicht nur schmerzlich, sondern auch schwierig, nur wenige Tage nach dem Tod eines Menschen einen „Nachruf“, eine „Würdigung“ zu schreiben, für einen Mann, den man durch fast drei Jahrzehnte gekannt, mit dem man unzählige Gespräche geführt, dessen Werk man hochschätzte, dessen menschliche Eigenheiten man mit anmüsierter Teilnahme in Kauf nahm — und mit dem man auch noch beruflich zu tun hatte. — Der Zeitpunkt für die Veröffentlichung einer oft mühsamen, aber immer amüsanten und originellen Korrespondenz ist noch nicht gekommen. Lernens Briefe wirkten meist spontan, waren meist Ausdruck irgendeines Ärgers, zugleich aber so wohlformuliert, daß man den Eindruck bekam, er habe sie einfach zu Abreaktionszwecken verfaßt.
Es ist nicht nur schmerzlich, sondern auch schwierig, nur wenige Tage nach dem Tod eines Menschen einen „Nachruf“, eine „Würdigung“ zu schreiben, für einen Mann, den man durch fast drei Jahrzehnte gekannt, mit dem man unzählige Gespräche geführt, dessen Werk man hochschätzte, dessen menschliche Eigenheiten man mit anmüsierter Teilnahme in Kauf nahm — und mit dem man auch noch beruflich zu tun hatte. — Der Zeitpunkt für die Veröffentlichung einer oft mühsamen, aber immer amüsanten und originellen Korrespondenz ist noch nicht gekommen. Lernens Briefe wirkten meist spontan, waren meist Ausdruck irgendeines Ärgers, zugleich aber so wohlformuliert, daß man den Eindruck bekam, er habe sie einfach zu Abreaktionszwecken verfaßt.
So mögen, denn hier an Stelle eines wohlüberlegten Nachrufes, einer gründlicher. Würdigung, wie sie sein schriftstellerisches Werk verdient, einige ganz persönliche Erinnerungen stehen, Streiflichter sozusagen, zumal artläßlich von Lernets 70. Geburtstag der Zsolnay-Verlag eine Festschrift herausgegeben hat, in der Carl Zuckmayer, Friedrich Torberg, Siegfried Melchinger, György Sebe-styen und W. E. Süsskind Werk und Persönlichkeit Lernet-Holenias zu beschreiben versucht haben, i Hier stehen auch schon alle die Stichworte, unter .denen Lernet und sein Werk „firmieren“: der Lordsiegelbewahrer, der Grandseigneur unter den Dichtem seiner Generation, der große Konservative, besonders was sein Verhältnis zur Sprache betrifft, der brillante Erzähler mit der leichten Fader, dessen zehn Druckseiten umfassendes Werkverzeichnis von klassischen Versen über den satirischen Roman und die Boule-vardkomödie alle Gattungen umfaßt, der aber doch wohl eigentlich als großer Erzähler, besonders von Novellen, Bestand haben wird, der Mann, der äußerlich den Typus eines Kavallerieoffiziers repräsentierte und der vielleicht besser ins 13, oder 15. Jahrhundert gepaßt hätte als in unsere Zeit. Dies alles und noch viel mehr wind man in den nächsten Tagen und Wochen über ihn zu lesen und zu hören bekommen.
Nachdem ich seine hohe, unübersehbare Gestalt schon da und dort gesichtet hatte, ohne ihm vorgestellt zu werden, begann meine persönliche Beziehung zu Lernet im Frühjahr 1948. — Unmittelbar nach dem Kriegsende ging ich daran, einen schon seit rund zehn Jahren ins Auge gefaßten Plan zu realisieren, nämlich die Zeugnisse über die menschliche Person Hugo \'on Hofmannsthals zu sammeln und herauszugeben. Über die Werke des Dichters gab es nämlich schon damals eine recht umfängliche Literatur, und zwar nicht nur in deutscher
Sprache. Aber wer und wie war Hofmannsthal als Mensch? Das interessierte mich brennend, denn die Klischees von dem „Ästheten“, dem frühreifen Narziss, dem nur nach Vorlagen arbeitenden Geschmäckler und stilistischen Chamäleon schienen mir unglaubwürdig, ja abstrus. Ich wollte also wissen, wie er als Person war, um dann dadurch vielleicht eine neue Sicht auf das Werk zu eröffnen.
Zunächst begann ich, den Freundeskreis Hofmannsthals zu rekonstruieren — mittels einer ins Uferlose anzuwachsen drohenden Korrespondenz. 1948 konnte dann die auf über 350 Druckseiten angeschwollene Sammlung 'unter dem Titel: „Hugo von Hofmannsthal. Der Dichter im Spiegel seiner Freunde“ erscheinen, war bald vergriffen und ist in veränderter, erweiterter Form 1963 im Berner Francke-Verlag in 2. Auflage erschienen.
Als einer der letzten, die Hof-mannsthal noch gekannt haben dürften, wurde mir Lernet-Hoienia genannt, und awar von der großen Tänzerin Grete Wiesenthal. Ich schrieb ihm dm Februar 1948 und erhielt nach wenigen Tagen einen mit 1. März datierten Brief, vier kleine handgeschriebene, wie gestochen wirkende Seiten mit nicht einer einzigen Korrektur, in welchem Lernet genau begründete, warum er seine nur recht flüchtigen Erinnerungen an Hofmannsthal nicht schreiben könne. Aber es stand soviel Kluges, wir mir schien, geradezu Hellsichtiges (wenn auch für meinen Geschmack allzuviel Kritisches) in dem Brief, daß ich den Dichter bat, diesen Brief, statt eines direkten Zeugnisses, in das von mir geplante und nunmehr fast abgeschlossene Buch über Hofmannstlhal aufnehmen zu.; dürfen. Postwendend stimmte Lernet zu, und ich war sehr froh, dieses f ornwollendete Dokument, das ja auch über seinen Autor etwas aussagt, der Öffentlichkeit übergeben zu dürfen. Der Anfang des Briefes lautet:
Lernet führte dann weiter aus, daß sich, seiner Meinung nach, bei Hofmannsthal das „vollkommene dichterische Mysterium“ gleich im Frühwerk ausgesprochen habe ( eine Wertung, die von der zeitgenössischen Hofmannsthal-Forschfang keineswegs geteilt wird). Dies gilt besonders für die „Reitergeschichte“ und das „Märchen der 672. Nacht“. Mit dem „Brief des Lord Chandos“, fährt Lernet dann fort, „erklärt er dann selbst noch, auf unerhört große Art, 'das Erlöschen des eigenen Orakels. Nach Abfassung jenes Briefes jedenfalls war der delphische Endspalt in seinem Wesen so gut wie verschlossen und der Wipfel der Eiche von Dodona verstummt“. Spä-heißt es dann noch: „Hofmanns-thal war, selbst in den 30 Jahren seiner Erstarrung, viel größer, als wir ihn vermuten, und wir sind noch viel kleiner, als man meint.“ Und zum Schluß:
„Ich habe ihn zwei oder drei Male besucht, und wir sind einander dann noch einige Male begegnet. Aber ich vermöchte kaum einen wichtigen Ausspruch von ihm zu berichten. Er war sehr liebenswürdig, und wir beschäftigten uns damit, die gesellschaftlichen Formen unserer Welt auszufüllen — vielleicht aus Scheu, von den Tiefen der Welt zu reden, die damals schon aufgerissen waren und die uns zu verschlingen drohten ... Einmal erwies er mir die Ehre von der ,Spannweite' meiner Begabung zu reden. Das dritte Mal tat er den Begriff des ,Erzählers' mit einer Handbewegung ab ... Zu wenig, um meine Erinnerungen an ihn den Erinnerungen an die Größe eines Werkes an die Seite zu setzen! — In Ergebenheit Ihr
Danach sah ich Lernet ab und zu. Vor allem bei den Sitzungen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen dies PEN-Clubs, dessen Präsident er von 1968 bis 1972 war. Damals trat er nicht nur als Vorsitzender ab, sondern auch aus dem PEN aus: als Protest gegen die Verleihung des Nobel-Preises an Heinrich Boll (wofür oder wogegen wir Armen ja wirklich nichts konnten!). Nun hat man Alexander Lernet-Hoienia kurz vor seinem Tod zum Ehrenpräsidenten des PEN gemacht. Hoffentlich hat es ihn gefreut. Denn was ihn freuen oder in Zorn versetzen würde, war schwer vorauszusehen. Er hatte eine ganze Reihe recht merkwürdiger Phobien, gegen Kleines und Großes, gegen die Grazer Autorengruppe ebenso wie gegen das Haus Habsburg. Das war, um diese Absurdität entsprechend au kennzeichnen, wie eine Achillesferse, die sich über den ganzen Körper auadehnte...
So angenehm und ausführlich unsere Gespräche waren — über Gott und die Welt, über all das Unsinnige, das passierte, was der oder jener, vorzüglich Politiker und Beamte, da oder dort wieder angestellt hatten—: meinen Beruf ignorierte er jahrelang Und ich meinerseits wagte nicht recht, ihn zur Mitarbeit an der FURCHE aufzufordern. Aus irgendwelchen Gründen hielt ich ihn für einen Presse-Leser; später schrieb er dann ziemlich häufig im alten FORUM Friedrich Torbergs. Auch wußte ich, daß er keine Gedichte mehr schrieb, und seine Erzählungen waren für unsere literarischen Blätter viel zu lang. — Da kam ich eines Tages auf den Gedanken — da ich wußte, wie amüsant und schöpferisch er in seinem Grant sein konnte —, ihn aufzufordern, doch ab und zu eine Glosse für DIE FURCHE zu schreiben. Ich verlockte ihn mit dem Titel: „Der allwöchentliche Ärger“
und stellte ihm selbstverständlich, die Wahl der jeweiligen Themen frei. Er konnte schreiben, worüber er wollte. Längere Zeit verging. Da, eines Tages, kam die erste Glosse, nach Form und Inhalt bestens geglückt, selbstverständlich.
Wir druckten sie, und bald kam eine zweite. Dann eine Pause. Dann eine, die uns absolut nicht ins Konzept paßte (ich glaube, sie war sehr polemisch gegen die „blöden Fußgänger“ und die - Poflizei gerichtet), dann wieder lange Zeit nichts. Es war eine Berg- und Talbahn und wohl die die schwierigste Korrespondenz, die ich je mit einem unserer Mitarbeiter führte. Denn nun las er DIE FURCHE — regelmäßig und sehr genau. Bs gab viel Tadel über einzelne Beiträge, gelegentlich auch ein Lob, aber wiederholt sagte er mir, daß er unsere Zeitung für die einzig lesenswerte und lesbare hielt. Mit der „Presse“ hatte er einmal einen Konflikt, ich weiß nicht mehr, weshalb, und die übrigen Tageszeitungen ignorierte er, soviel ich weiß, oder er pickte sich nur ab und zu einen Nonsens heraus.
An eine auf den ersten Blick recht merkwürdige Beziehung Lernet-Holenias sei erinnert: an die zu dem wohl bedeutendsten Lyriker deutscher Sprache in den Jahrzehnten zwischen den beiden Kriegjen, Gottfried Benn. Diese Beziehung, die man, wenn nicht Freundschaft, so doch wohl als Kameradschaft bezeichnen könnte, ist durch zwei Briefe bezeugt, die im Jahr 1952 von der „Neuen Zeitung München“ abgedruckt wurden, und die der Limes-Verlag, ider das gesamte Werk Benns betreut, 1953 als schmale Broschüre herausgab und auch in spätere Brief-
publikationen Benns aufnahm. Die beiden Briefe, der eine sechs, der andere neun Druckseiten umfassend, gehen auf eine Begegnung zurück, welche die beiden Dichter während des 2. Weltkrieges, um 1942, hatten: beide in Uniform, Benn in der eines Oberarztes, Lernet in der eines Kavallerieoffiziers. Zehn Jahre später traf man sich in Brügge und in Knokke-Le Zoute, wo Benn eine vielbeachtete Rade, in französischer Sprache, über „Probleme der Lyrik“ gehalten hat. Er verteidigt darin seinen Standpunkt: Der Dichter sei einsam, ganz auf sich gestellt, weder Land noch Volk noch Mitwelt ginge ihn etwas an. Er schreibe nur für sich selbst. — Darauf forderte Lernet ihn in einem offenen Brief auf, aus diesem Kreis herauszutreten und sich der „Nation“, und der „Menschheit“, im edelsten Sinn des Wortes, nicht zu verschließen. „Mögen Ihnen diese Begriffe auch noch so verdächtig sein. Sie entziehen sich Ihnen so wenig, wie Sie sich Gott zu entziehen vermögen. Sie geben ja zu, von ihm eingesponnen zu sein.“ — Auf die Aufforderung, zum Glauben zurückzukehren, antwortet«! Benn, religiöser Glaube sei ein Geschenk, man könne ihn nicht „beziehen“. Und den Brief eines Jesuitenpaters zitierend, schreibt Benn: „Niemand ist ohne Gott, das ist menschenunmöglich, nur Narren halten sich für autoch-thon und selbstbestimmend.“ Es ging also auch Benn um mehr als nur um Literatur, um Dichtung. Dichter zu sein, so schrieb und bekannte Lernet, genüge ihm nicht, zumindest war ihm/ diese Apostrophierung peinlich. Und hiefür konnte er sich auch auf Lord Byron berufen, wie man es neulich in einem vom Fernseihen gezeigten Archivfilm hören und seihen konnte...