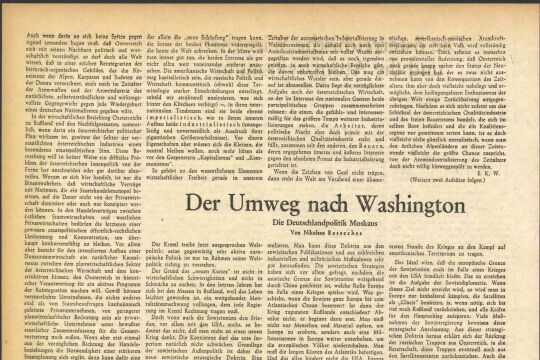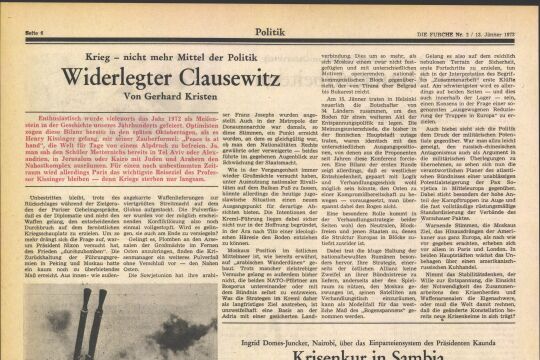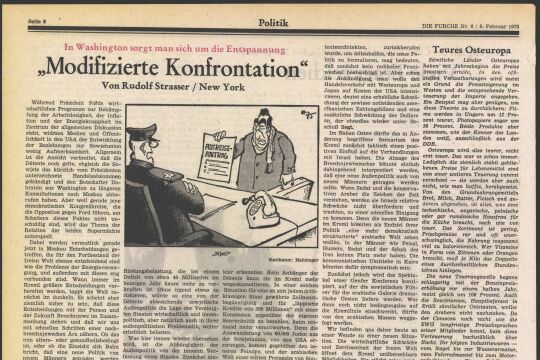Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die atlantische Malaise
Was erklärt die gegenwärtige Malaise in den europäisch-amerikanischen Beziehungen? Wir zanken uns über die Entspannungspolitik und die richtige Haltung gegenüber der Sowjetunion. Mit Müh' und Not haben wir einen vierjährigen Disput über die NATO-Nachrüstung hinter uns gebracht und einen „Krieg" über die europäisch-sibirische Erdgas-Pipeline verhindert. Und nach wie vor streiten wir uns über wirtschaftliche Angelegenheiten: hohe Zinssätze, hoher Dollarkurs, Protektionismus ...
•
Seit Jimmy Carter 1977 amerikanischer Präsident wurde, ist es geradezu zur Mode geworden,über die Persönlichkeiten im Weißen Haus herzuziehen. Carter verwirrte auch viele Amerikaner, für die Europäer aber war er eine Quelle unaufhörlicher Frustrationen, vor allem die Windungen der amerikanischen Außenpolitik in den Jahren 1977 bis 1980 ...
Nach Jimmy Carter kam Ronald Reagan und der setzte die ideologischen Akzente genau entgegengesetzt zu Carters Politik der ersten drei Amtsjahre. Mit dem von der Reagan-Administration offerierten Unilateralismus aber konnten sich die Europäer noch weniger abfinden. Und genauso schlecht nahmen sie die Rhetorik der Reagan-Administration um 1981 auf, die — um mit Sam Huntington zu sprechen — eher „abstrakte Streitsucht" als eine klar durchdachte Strategie reflektierte.
Politik in Washington, wie sie insbesondere auch von der Reagan-Regierung gemacht wird, entwickelt sich nicht harmonisch nach Grundsätzen reiner Staatsvernunft, sondern vielmehr in einem höchst fragmentarischen, in sich konkurrierenden System. Politische Entscheidungen sind eher das Resultat der ständigen Schlachten innerhalb der Bürokratie als den Geboten einer „Großen Strategie" folgend. Kein Wunder dann, daß die Europäer, die viel eher an hierarchische Prozeduren gewohnt sind, sich mit dem amerikanischen Regierungssystem sehr schwer tun. •
Als die Amerikaner zwischen 1968 und 1974 einen politischen Kurs der Entspannung und Rüstungskontrolle mit der Sowjetunion verfolgten, befürchteten die Europäer den Beginn eines „Kondominiums", wobei europäische Interessen auf dem Altar der Supermacht-Komplizenschaft geopfert würden. Als die USA ab 1979 die Richtung änderten, an die Wiederherstellung des nuklearen und konventionellen Gleichgewichtes herangingen und eher Konfrontation als Ausgleich mit der Sowjetunion suchten, reagierten die Europäer mit völlig entgegengesetzten Ängsten: Jetzt regten sie sich über die Gefahren eines solchen Kurses für die Entspannungspolitik auf, beklagten die zunehmende Drohung eines Atomkriegs und fürchteten in Konflikte hineingezogen zu werden, die sie nichts angingen...
Ähnlich ist die Dynamik auf wirtschaftlichem Gebiet: Jahrelang beschwerten sich die Europäer über die niedrigen Zinsraten und die Währungspolitik der USA, weil die Welt mit billigen Dollars überflutet und amerikanischen Produkten so „unfaire" Export-Vorteile eingeräumt wurden. 1981 hörte man völlig andere Klagen: Jetzt war es auf einmal der deflationistische Kurs, der die Gesundung der Weltwirtschaft gefährdete...
Neben den Problemen von Stil und Struktur scheint es eine beinahe permanente Interessen-Kollision innerhalb der atlantischen Partnerschaft zu geben. Diese Kollision hat historische Wurzeln, die in die Siebzigerjahre, das Jahrzehnt der Entspannung, zurückreichen.
Hier sei zuerst eine amerikanische Klage über Westeuropa zitiert, die ganz gut die Grundstimmung in den USA wiedergibt. 1982 schrieb Walter Laquer: „Was können die Amerikaner tun, um jene zufriedenzustellen, die Aquädistanz zu den Großmächten wünschen, die Verteidigung — aber nicht zu viel davon — erbitten, die sich mehr als vor den Ereignissen in Polen vor den amerikanischen Sanktionen fürchten, sich mehr vor amerikanischen als vor sowjetischen Raketen ängstigen, die Alliierte und Vermittler zugleich sein möchten." Auf dem Weg zur Entspannung mußte etwas passiert sein...
Für die Europäer hat die Entspannungspolitik „funktioniert", für die USA nicht. Mit nur wenigen Banden gegenseitiger Abhängigkeit von der Sowjetunion, hatten die Vereinigten Staaten durch den Ausbruch des „Zweiten Kalten Krieges" wenig zu verlieren. Nicht so die Europäer, die eine Anzahl von Vorteilen aus der Entspannungspolitik gezogen hatten.
Keine Welle gegenseitiger Zuneigung kann indessen die unverrückbaren Macht-Unterschiede verändern und keine atmosphärische Verbesserung kann die geographische Kluft überwinden, die Europa von den USA trennt. Die USA sind eine globale Macht mit einer globalen Berufung und daher betrachtet Washington die Welt von strategischen Gesichtspunkten aus, die im wesentlichen von der fortdauernden Rivalität mit der Sowjetunion bestimmt werden.
Westeuropa auf der anderen Seite — bedeutungslos wie eindrucksvoll seine wirtschaftlichen und demographischen Ressourcen auch sein mögen — ist eine Ansammlung von Klein- und Mittelmächten mit beschränkten Mitteln und daher auch beschränkten Visionen und Interessen.
Amerikas Interesse gilt dem globalen Machtgleichgewicht; Europas wesentlichste Sorge ist es, die Vereinigten Staaten in die Verteidigung des Halbkontinents einzubinden, die engen politischen und wirtschaftlichen Verbindungen zur Sowjetunion aber dennoch zu erhalten.
•
Europa will eine vorteilhafte Kombination von Isolierung und Einmischung in die amerikanischen Angelegenheiten. Die USA, sich gerade jetzt dem stetigen Niedergang seiner Macht widersetzend, fordern aber mehr, und nicht weniger von ihren Verbündeten. Klar, daß weder der eine noch der andere Wunschtraum Wirklichkeit werden kann, und darin liegt die Ursache der transatlantischen Schwierigkeiten...
Wenn Europa und die USA nicht einen Sinn für Gleichgewicht und Mäßigung entwickeln, wenn sie den Versuchungen von Neutralismus und Unilateralismus nicht widerstehen, dann wird die wohl günstigste Allianz der Geschichte nicht weiter gedeihen können.
Der Autor war vormals Redakteur des Hamburger Wochenblattes „Die Zeit" und unterrichtet jetzt an der „Johns Hopkins School f or Advanced International Studies" (SAIS) in Washington D. C. Ubersetzung aus dem Englischen: Burkhard Bischof.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!