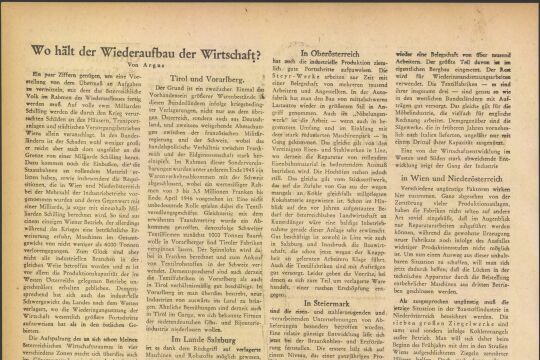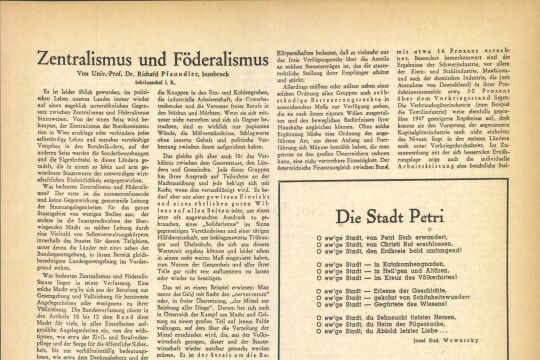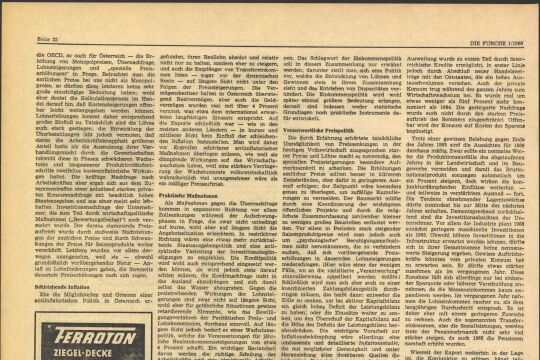Die Chemie sucht neue Aufstiegsrouten
Die Petrochemie steckt international in einer dramatischen Krise. Ihre Margen fielen innerhalb von drei Jahren auf ein Zwanzigstel. Alle Versuche, diesen Preisverfall aufzuhalten, waren bisher vergeblich.
Die Petrochemie steckt international in einer dramatischen Krise. Ihre Margen fielen innerhalb von drei Jahren auf ein Zwanzigstel. Alle Versuche, diesen Preisverfall aufzuhalten, waren bisher vergeblich.
Von den Problemen der Petrochemie weiß auch die ÖMV ein Lied in Moll zu singen, denn ihre petroche-mische Produktion hat 1992 mit einem Verlust von mehr als einer halben Milliarde Schilling den Erdölkonzern tief in die roten Zahlen gedrückt.
Doch die Misere der Petrochemie ist nur die Spitze eines Eisberges. Weltweit wird ganz allgemein die chemische Industrie seit Beginn der neunziger Jahre vom Krisenfieber geschüttelt. Nach vielen erfolgreichen Jahren vor ernste Ertragsprobleme gestellt, sucht die Chemiewirtschaft jetzt neue Routen zum Aufstieg.
Das gegenwärtige Konjunkturtief hat die schwierige Lage dieser Branche nicht allein verursacht, sie aber besonders deutlich gemacht. Wer Vormaterialien für die Autoherstel-ler, für die Papierindustrie, für die Textilproduktion, für die Stahlindustrie liefert, verzeichnet erhebliche Absatzrückgänge. Fast alle großen Chemiekonzerne mußten im vorigen Jahr beträchtliche Einbußen hinnehmen, die Deutschen, die Franzosen, Du Pont in Amerika, die britische ICI. Nur die Schweizer waren besser dran. Erhebliche Überkapazitäten auf vielen Gebieten und gewaltiger Preisdruck auf breiter Front spielen da mit.
Massenwaren unter Druck
Doch die Chemiewirtschaft ist eine Branche der Vielfalt. Chemikalien verschiedenster Art für die Industrie gehören ebenso dazu wie Artikel für die Körperpflege, Kunststoffe, pharmazeutische Produkte, die Agrarche-mie, Kunstfasern, Lacke und vieles mehr. Besonders die chemischen Massenwaren sind unter Druck geraten, wegen weltweiter Überproduktion und weil der Wissensvorsprung der alteingeführten Produzenten gegenüber den Neulingen, die mit viel niedrigeren Lohnkosten arbeiten, nicht mehr so groß ist wie früher.
Kunststoffe stoßen vermehrt auf den Widerstand im Konsumentenlager, werden aber nach wie vor gebraucht, vor allem für die technische Anwendung. Chemiefasern werden zu Spezialbekleidung, in der Autoindustrie und zu Zigarettenfiltern verarbeitet. Verhältnismäßig gut stehen noch die Hersteller pharmazeutischer Präparate da, aber auch hier zeigen sich Flammenzeichen am Horizont.
Angesichts der in allen Industriestaaten registrierten Talfahrt haben sich die meisten chemischen Konzerne zu umfassender Strukturbereinigung entschlossen. Sie wollen immer weniger Universalproduzenten sein, wollen sich vielmehr auf Produktbereiche konzentrieren, in denen sie stark sind, in großem Maße auf Spezialer-zeugnisse, wo sie den auf intensiver Forschung und Marktkenntnis gegründeten Vorsprung wahren und ausbauen können. Deshalb wurden gerade in letzter Zeit unzählige Kooperationen, Allianzen und Joint-ventures eingegangen, innerhalb Europas, aber in großem Maße auch zwischen europäischen und amerikanischen oder japanischen Partnern.
Hoechst in Frankfurt zum Beispiel hat eine solche Zusammenarbeit für Chemiefasern, für Fotoresists (die in der Mikroelektronik gebraucht werden), für Autolacke, für Kunststoffgranulate, um nur einige Beispiele zu nennen, vorgenommen oder eingeleitet. In gleicher Weise bauen andere Unternehmen ihre Kerngeschäftsfelder aus, in Deutschland, in Frankreich, den Niederlanden und - geradezu mustergültig, wie Fachleute beto-in Großbritannen nien.
Die ÖMV führt derzeit Gespräche über eine Zusammenarbeit bei petro-chemischen Programmen mit der deutschen Hüls AG; man hofft, nach dem Sommer soweit zu sein. Ein Manager der deutschen Shell-Chemie sagte vor kurzem: „Wenn die Branche ihre Strukturmisere nicht ent-schlossen beseitigt, droht ihr in Deutschland ein ähnliches Schicksal wie der Werftenindustrie und den Stahlkochern” - nämlich der Sturz in die Existenzkrise.
Dieser Prozeß der Umgestaltung und Erneuerung soll Kosteneinsparungen und damit größere Leistungsfähigkeit in den entscheidenden Produktbereichen bringen. Er zwingt aber auch zum Personalabbau. Die von vergleichsweise hohen Arbeitskosten und den Währungsabwertungen wichtiger Märkte besonders belastete deutsche Chemieindustrie wird, so schätzt man, noch etwa 20.000 Arbeitnehmer, das sind zwei bis drei Prozent ihres derzeitigen Beschäftigtenstandes, abbauen müssen.
Dieser Entwicklung wird sich die chemische Industrie in Österreich nicht entziehen können, zumal sie im internationalen Vergleich eine außerordentlich niedrige Produktivität und eine sehr hohe Lohnquote hat, wie aus einer Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts der WU Wien hervorgeht. Noch vorfünf Jahren hatte der Chemiesektor eine Spitzenposition in der österreichischen Industrie inne, seither ist er aber (etwa in der Umsatzrentabilität oder in der Eigenkapitalausstattung) unter den Industriedurchschnitt gefallen.
Hohe Umweltkosten
Noch stärker als die Arbeitskosten wirkt sich aber die Umweltfrage für die Chemieindustrie wichtiger Länder, auch Österreichs, aus. Von den Investitionsaufwendungen entfällt in unseren Breiten rund ein Viertel auf Umweltkosten, wodurch manche Investitionsvorhaben kaum mehr rentabel sind. Unter dem Druck der öffentlichen Meinung und der Gesetzgeber hat die chemische Industrie in den vergangenen Jahren gewaltige Verbesserungen vorgenommen. Die volle Abkehr von den FCKW (Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe, vor allem in der Kühlmittelindustrie) ist fast erreicht, die österreichische Papierindustrie stellt sich zügig von der Chlorbleiche auf andere, umweltverträgliche Bleichmethoden um, das Recycling von Kunststoffen (etwa Getränkeflaschen) ist weithin in vollem Gang. Das verringert freilich die Wettbewerbskraft gegenüber femöstlichen oder auch osteuropäischen Konkurrenten, die derlei Umweltauflagen so gut wie gar nicht kennen.
In Österreich haben einige gesetzliche Maßnahmen der letzten Zeit die Umweltbelastung durch chemische Betriebe erheblich vermindert. Geringere Emissionen von Schadstoffen in die Luft und weit besser gereinigte Abwässer werden nachgewiesen. Darüber hinaus ist die österreichische Chemie seit Beginn dieses Jahres in der internationalen Aktion „Respon-sible Care” tätig, die freiwillige, über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehende Maßnahmen der Betriebe im Interesse von Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz fördert und öffentlich aufzeigt. Im Durchschnitt der letzten drei Jahre wurden gut drei Prozent des Produktionswertes für Umweltmaßnahmen aufgewendet.
Allerdings erweisen sich manche Vorschriften (zum Beispiel für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln) als ärgerliche Hindernisse, zumal sie oft über die in der EG oder speziell in Deutschland geltenden Normen hinausgehen. Das unerfreuliche Ergebnis ist, daß Investitionen unterlassen und manche Produktionen ins Ausland, vor allem nach Osten, verlagert werden.
International sieht selbst die Pharmaindustrie, bislang eine Stütze der Chemiebranche, Probleme auf sich zukommen, denn in vielen Ländern lassen Einsparungen der öffentlichen Zuschüsse im Gesundheitswesen zumindest einen Trend zur Zulassung billigerer statt wirksamerer Präparate erwarten. Das vermindert die verfügbaren Mittel für die in dieser Sparte besonders aufwendige Forschung.
Für die österreichische pharmazeutische Industrie, die trotz guter Einzelleistungen nicht die Leistungskraft vergleichbarer ausländischer Unternehmen erbringt, wie das Industriewissenschaftliche Institut feststellt, kann eine solche Entwicklung überaus problematisch werden, denn schon bisher beträgt bei uns dieser Forschungsaufwand nur drei Prozent des Umsatzes, während er im europäischen Durchschnitt bei sieben bis zehn Prozent liegt. In einigen Fällen erfolgreicher Forschungsarbeit, nicht nur in der Pharmasparte, wird es darauf ankommen, auch mehr Produktion (und damit Wertschöpfung) in Österreich anzusiedeln.
Das angekündigte Gesetz über die Gentechnologie in Österreich kann die Forschung freilich zusätzlich erschweren. Der Entwurf gab offenbar einer von geringer Sachkenntnis getragenen, aber stark gefühlsbelade-nen öffentlichen Meinung nach, auf Kosten der großen Bedeutung, die gentechnisch hergestellte Medikamente gegen bisher unheilbare Krankheiten wie Mucoviszidose, Zwergenwachstum und nicht zuletzt Aids haben können. Fachleute erwarten immerhin, daß ihren Einwänden weitgehend Rechnung getragen werden wird, und daß nach dem Sommer eine tragbare Fassung in den Ministerrat kommen wird.
Umstrittene Gentechnologie
Die aus politischem Kalkül entstandenen Bedenken gegen die Gentech-nologie, deren problematische Aspekte (Genmanipulation und so weiter) in der europäischen Wissenschaft voll erkannt und respektiert werden, sind auch in Deutschland wirksam. In Hessen kann eine aufgrund von Zusagen errichtete Fabrik zur gentechnischen Herstellung von Humaninsulin seit Jahresfrist nicht in Betrieb gehen, weil der Widerstand dagegen die Behörden lähmt; so wird indessen ein auf gleicher Basis erzeugtes Präparat aus Frankreich importiert. Die Baseler pharmazeutische Industrie denkt daran, wenn auch in der Schweiz die Behinderungen anhalten, ihre gentechnische Fertigung in das benachbarte Elsaß zu verlegen.
Somit steht die chemische Industrie Europas nach den Aussagen von Fachleuten vor der größten Herausforderung seit zehn Jahren. Auch bei uns in Österreich wird man sich dieser Problematik stellen müssen, von Seiten der Unternehmen, aber auch der Behörden. Andernfalls droht die Forderung nach Erhaltung und Stärkung des Industriestandortes sogar bei der Chemie, dieser nach wie vor zukunftsreichen Sparte, ins Leere zu gehen.