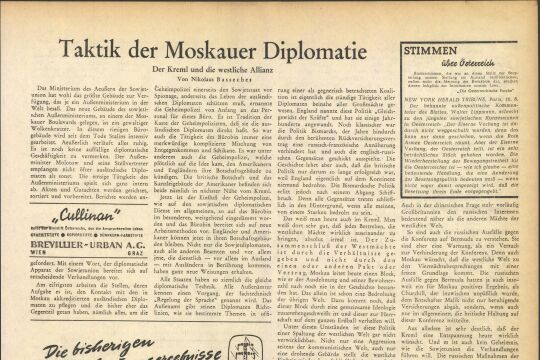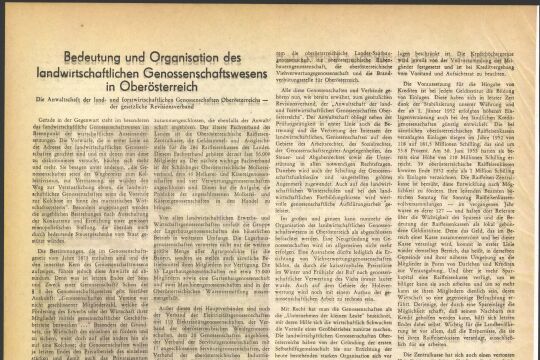Millionen Menschen haben (zum Glück) nie Roulett gespielt, werden es (hoffentlich) nie tun, würden es freilich ganz gern einmal selbst versuchen, geben dies aber nicht einmal sich selbst gegenüber zu. Deshalb wird vom Roulett oft mit einem Unterton von Empörung gesprochen. Doch so gefährlich das Roulett mikroökonomisch (sprich: für einen leidenschaftlichen Spieler) auch werden kann — makroökonomisch (sprich: für die öffentliche Hand) hat es nur positive Seiten. Vor allem bringt es viel Geld. Zweitens sind es nicht gerade die Schillinge der Ärmsten, die der harte Rechen des Croupiers vereinnahmt, und so mancher Tausender, den er mit dem leisen Klicken eines kleinen Plastikplättchens auf Metall zu sich zieht, wurde vielleicht dem Staat bei der Abfassung der Steuererklärung vorenthalten. Abschöpfung über den Steuerbescheid vermindert dabei den Leistungsdrang, Abschöpfung über das Roulett tut das nicht — im Kasino schenken die Leute ihr Geld freiwillig her. Obwohl (oder weil?) Österreichs Spielkasinos einer privaten Aktiengesellschaft gehören, sind sie die rationellste Geldeinhebungsmaschine des Fiskus. Er bekommt gut 90 Prozent aller in Österreichs Kasinos verlorenen Beträge.
Trotzdem bleibt für die österreichische Spielbanken AG genug übrig, um eine Rekorddividende auszuschütten — 17 Prozent im Jahr 1969, mehr als bei Veitscher Magnesit oder Brau AG. In Anbetracht des kleinen Aktienkapitals von 18 Millionen (Anlagevermögen: 30 Millionen) sehen die absoluten Gewinnzahlen viel harmloser aus: Rund drei Millionen Schilling 1969.
Die österreichische Spielbanken AG ist Nachfolgerin einer anderen, in Kanada registrierten AG, deren Konzession Ende 1967 ablief und aus verschiedenen Gründen nicht erneuert wurde. Die Aktien der neu konzessionierten AG werden vom österreichischen Verkehrsbüro, vom Bankhaus Schellhammer und Schattera sowie etwa zehn privaten Aktionären gehalten.
Der Mann, der für die Leitung der österreichischen Spielkasinos verantwortlich ist, sieht in dieser Tätigkeit eine Managementaufgabe, die sich von der Führung eines Großhotels, einer Restaurantkette oder einer Fabrik nur durch die speziellen Branchenprobleme, nicht aber im Grundsätzlichen unterscheidet. Er heißt Dr. Leo Wallner, ist 36 Jahre alt und hatte nie zuvor ein Kasino betreten, als die Aufgabe an ihn herantrat, den Spielbetrieb innerhalb weniger Wochen auf eine neue Basis zu stellen — vor allem in neue Räumlichkeiten zu verlegen.
Ein bedeutendes Problem war die Beschaffung neuer Spielmaschinen, die Lieferung dieser Geräte, die in sehr kleinen Stückzahlen — und praktisch nur von zwei Fabriken in Frankreich — hergestellt werden, dauert normalerweise mehrere Monate. Bis Ende 1967 wurde in Österreich, wie in vielen anderen, auch renommierten Kasinos, auf abgenützten Roulettmaschinen aus der Zwischenkriegszeit gespielt. Darin, und nicht etwa im „todsicheren System“, liegt das Geheimnis der großen Erfolgsspieler. Auch der legendäre deutsche Millionengewinner Dr. Jarecki ergründete bei seinen langwierigen Beobachtungen, die jeder Gewinnserie vorangingen, keineswegs neue Wahrscheinlichkeitsgesetze, sondern lediglich die Unexaktheiten alter Kreisel.
Manche europäische Kasinos verhängen daher über allzu erfolgreiche Spieler ein Eintrittsverbot. Das ist billiger als neue Kessel. In Österreich wird man — immer in aller Diskretion — nicht hinausgebeten, wenn man zuviel gewinnt, sondern wenn man zuviel verliert. Die Geschäftspolitik der Österreichischen Spielbanken AG beruht auf zwei Grundmaximen. Erstens auf der Vermeidung jeden Skandals. Wer zu oft erscheint, wird höflich ersucht, seine Einkommensverhältnisse offenzulegen. Auch wer fünf- oder zehntausend Schilling auf einmal verliert, wird zunächst diskret beobachtet. Aber die Mehrzahl der Kasinobesucher fällt niemals auf. Es gibt in Österreich — um nur eine Gruppe zu nennen — hunderte alleinstehende Witwen mit mittlerer Rente und kleinerem Vermögen, die so spielen, wie man, alter Faustregel zufolge, eigentlich trinken sollte: mäßig, aber regelmäßig. Meist kommen sie nicht so sehr um des Spielens als um des Rahmens willen. Wo kann eine alleinstehende Frau um 10 Uhr abends hingehen, ohne schief angesehen zu werden? Ins Kasino kann sie jedenfalls gehen.
Seit der Übernahme des Spielbetriebes durch die neue Gesellschaft gab es keine durch das Roulett vernichtete Existenz, jede einzelne Zeitungsmeldung, in der es hieß, dieser oder jener Betrüger habe seine gesamte Beute im Kasino verspielte, wurde widerlegt.
Dr. Leo Wallner sorgte für die Bereinigung einer grotesken gesetzlichen Unklarheit. Bis 1967 waren die gesamten Umsätze der österreichischen Spielbanken theoretisch umsatzsteuerpflichtig, allerdings wurde auf die Einhebung der Umsatzsteuer sozusagen „vergessen“ — sie hätte den sofortigen Tod dieser Melkkuh zur Folge gehabt. Denn die — theoretisch auf jeden Einsatz entfallende — Umsatzsteuer hätte den Vorteil der Bank, der genau 2 Prozent ausmacht, in ein katastrophales Manko verwandelt.
Wallners Grundmaxime Nummer zwei beruht auf der Erkenntnis, daß das Roulett ein gegenüber psychologischen Störfaktoren überaus anfäl-
liges „Produkt“ mit einem regenerationsbedürftigen Image ist. Roulett unterliegt einer so gründlichen moralischen Verteufelung, daß das große Gedächtnis, genannt Lexikon, sogar die Tatsache verdrängt, daß das Roulett in seiner heutigen Form von zwei der bedeutendsten abendländischen Geister, Pascal und Leibniz, entwickelt wurde. Sie wollten den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit auf die Spur kommen und fanden, wie man heute sagen würde, einen perfekten „Zufallsgenerator“, gegen den auch das Elektronengehirn nicht gewinnen kann.
Was ist das Roulett, wenn man es wirtschaftswissenschaftlich zu definieren sucht? Eine Dienstleistung von vollendeter ökonomischer Nutzlosigkeit für den einzelnen, konsumiert um eines psychologischen, gesellschaftlichen, ästhetischen Zusatznutzens willen, der hier — vom Konsumenten oft unerkannt — zum Haupt-, weil einzigen Nutzen wird. Der eine Spieler kauft die Hoffnung, der andere den Nervenkitzel, der dritte den Genuß, Geld zum Fenster hinauszuwerfen, aber immer heißt Roulettspielen gegen ein Gesetz kämpfen, das um so eherner wirkt, je länger man sich ihm entgegenstellt, das aber dem Spieler, wie die Maus der Katze, immer wieder eine Chance zu geben scheint. Roulettspielen heißt auch: Anrennen gegen das Absurde, das Unvermeidliche, etwa im Sinne eines Camus. Roulettspiel kann Rebellion gegen die Wirklichkeit sein, Roulettspiel kann in extremis Offenlegung der Charaktere provozieren — Könige schimpfen am Spieltisch wie die Kutscher.
Pascal und Leibniz konnten nicht ahnen, daß sie mit ihrer Maschine zur experimentellen Überprüfung der Wahrscheinlichkeitsrechnung nebenbei auf einem freilich winzigen Sektor der Volkswirtschaft die eleganteste Lösung eines Hauptproblems der modernen Industriegesellschaft vorwegnahmen: Das Roulett ist ein Produktionsapparat, der niemals zu viel produzieren kann — weil er nichts produziert. Roulett repräsentiert den Kreislauf des Geldes als Leerlauf ohne Konsum — mit eingebautem Unverteilungseffekt zugunsten der Bank.
Da 90 Prozent dessen, was die Bank gewinnt, in Österreich der öffentlichen Hand zufließen, müssen hinter der Verteufelung des Roulett ebenso komplizierte psychologische Vorgänge stehen wie hinter dem Spiel selbst. Sonst wäre es unmöglich, daß die mikroökonomisch ebenso unsinnige, makroökonomisch aber viel weniger effiziente und angesichts ihres Umverteilungseffekts zuungunsten der wirtschaftlich eher Schwachen viel unsozialere Klassenlotterie soviel mehr Toleranz findet als die Kasinos. Beide Apparate produzie-, ren Umverteilung ohne realen Konsum. Die Kasinos zahlen 98 Prozent aller im Roulett gesetzten Beträge als Gewinne wieder aus. Von dem, was hängenbleibt, flössen 1971 grob geschätzt 110 Millionen dem Bund zu, rund 20 Millionen den Standortgemeinden, 10 Prozent den Ländern. Mit rund 14 Millionen, die der Spielbanken AG blieben, wurde nicht nur der Spielbankbetrieb finanziert — darin sind auch die Dividenden für die Aktionäre enthalten, die von diesen wiederum mit schätzungsweise 50 Prozent versteuert werden. Den 42 Millionen Schilling, die dem österreichischen Glücksspielmonopol als Rohgewinn der Klassenlotterie (vor Abzug der kaum zu ermittelnden staatlichen Verwaltungskosten) 1969 verblieben, stehen 51 Millionen Schilling Provisionen für die Losverkaufsstellen gegenüber.
Um die großartige Melkkuh Kasino, die selber so wenig frißt, gesundzuerhalten, wurde von der österreichischen Spielbanken AG erstmals ein Marketingziel formuliert, das man am ehesten auf die Formel „Entteufelung des Roulett“ verknappen kann. Das heißt nicht, daß der Nervenkitzel verringert oder das Risiko abgeschafft werden soll. Der Kessel, die Kugel, der Rechen, das grüne Tuch, die gedämpften Stimmen, das Risiko, der Nervenkitzel, der Jahrmarkt der Eitelkeiten, die Möglichkeit, 50.000 Schilling auf eine Chance zu setzen (an einem einzigen Tisch im Sommer in Velden) — das alles bleibt. Was sich wandelt, ist das Drumherum. Abgesehen von einigen Verbesserungen für den Spieler (zum Beispiel Quick Table für Eilige, markierte Jetons für große Spieler), geht es vor allem um den Rahmen, der einen Kasinobesuch auch abgesehen vom Spiel — nicht zuletzt für Begleitpersonen — interessant machen soll. Gesellschaftliche Veranstaltungen, dann und wann eine Kunstausstellung oder ein Preisausschreiben, vor allem aber exzellentes Service und lokales Flair an Stelle einer falsch verstandenen, sterilen „Internationalität“ sollen helfen, das unausgesprochene, unbewußt wirksame Tabu, das die ganze Ambivalenz in der Einstellung der Gesellschaft zum Roulett spiegelt, abzubauen. In dieses Konzept fügen sich die goldenen Tausender-Jetons, die im Gegensatz zu anderen Goldmünzen jederzeit ohne Wertverlust (und sogar an verschiedenen Bankschaltern) in einen papierenen Tausender zurückgetauscht werden können und infolge limitierter Auflagen gar Sammlerwert bekommen könnten, ebenso wie der Ankauf von Südtiroler Bauernstuben zur Ausstattung des neuen Kasinos in Seefeld.
Denn was beim Abbau der Tabuierung keinesfalls auf der Strecke bleiben darf, das ist die Exklusivität. Sie muß gehütet und gepflegt werden, denn eine der wichtigsten Zielgruppen für das neue Kasino- Marketing ist der zahlungskräftige, anspruchsvolle, auf Exklusivität bedachte Österreichbesucher, dessen spezifischen, statusgeprägten Wünschen außer ein paar Luxusrestaurants herzlich wenig geboten wird. Er soll natürlich spielen und wird natürlich spielen — da ein Spielkasino kein Restaurant sein will, verschafft ihm die Atmosphäre so nebenbei die Entschuldigung, die er für einen Kasinobesuch braucht, sich selber oder seiner Begleitung gegenüber.
Das neue Kasino-Management konnte den Ausländeranteil unter den Gästen in drei Jahren von 38 auf 46 Prozent steigern. Daß ihm die Entwicklung eines echten Überlebensrezeptes gelungen ist, beweist der Besucherzustrom nach Seefeld, dem ein Besucherrückgang in Garmisch gegenübersteht. Österreichs Kasinos stechen von den bayrischen, die vom Staat direkt betrieben werden, vorteilhaft ab. Während die bayrischen Kasinos bei Umsatzsteigerungen von 2 Prozent pro Jahr stagnieren und die übrigen deutschen sowie die europäischen Kasinos durchschnitllch ein Plus von 5 bis 6 Prozent pro Jahr vermelden, verzeichnet die österreichische Spielbanken AG seit 1969 Umsatzzunahmen von jährlich 35 (in Seefeld 40) Prozent.
Wer zu zweit kommt, aber allein spielen will, setzt seine Dame einstweilen zum „Black Jack“, worunter man das alte „21“ oder „17 + 4“ versteht. Daß die österreichische Spielbanken AG dieses Spiel — neben dem Bakkarat — forciert, beweist die Stimmigkeit im Detail, die jedes erfolgreiche Marketing-Konzept haben muß. Denn Bakkarat jagt Angst ein. Der Bakkarat-Spieler spielt gegen seine Partner und bleibt auf der Strecke, wenn er weniger Geld verspielen kann (oder will) als sie. Beim Black Jack spielt man gegen die Bank. Wer 60 Schilling setzt, ist gegenüber Mitspielern, die mit Tausendern herumwerfen können, nicht benachteiligt.
Und sieht nicht, wieviel der Begleiter am Roulett-Tisch einstweilen verspielt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.