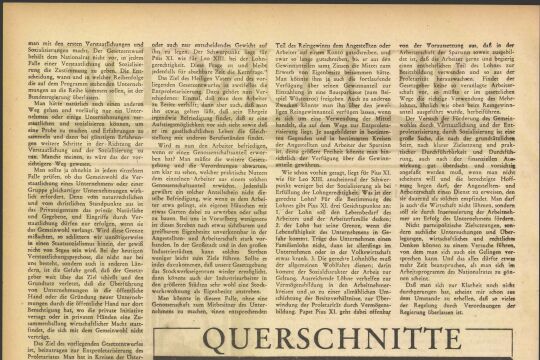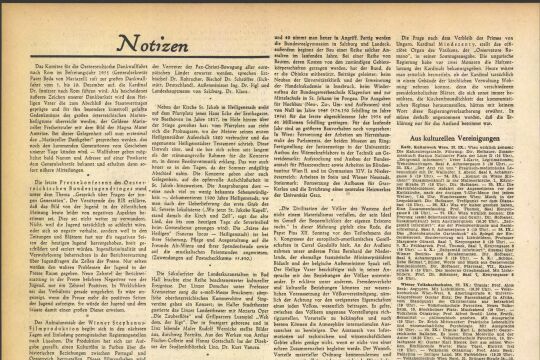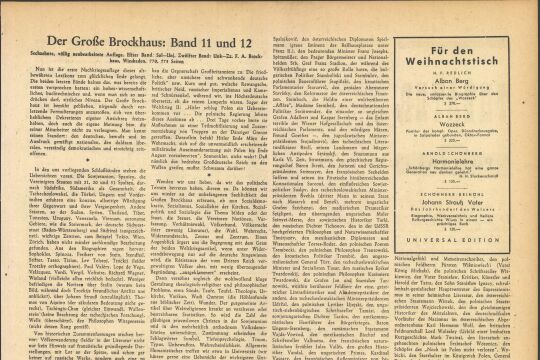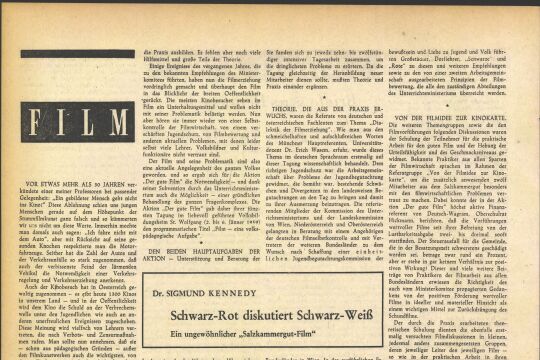Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Erfahrungen mit dem „unerwünschten Erbe"
Würden Sie gerne in Dachau, Buchenwald, Mauthausen, Theresienstadt oder gar in Auschwitz leben? Kaum, wenn es sich vermeiden läßt. Mit Nürnberg oder Berchtesgaden hätten Sie aber möglicherweise weniger Probleme.
Würden Sie gerne in Dachau, Buchenwald, Mauthausen, Theresienstadt oder gar in Auschwitz leben? Kaum, wenn es sich vermeiden läßt. Mit Nürnberg oder Berchtesgaden hätten Sie aber möglicherweise weniger Probleme.
Daß die Befangenheit gegenüber Städten, wo die Nationalsozialisten zur Tat schritten, geringer ist als gegenüber jenen Orten, wo sie ihre Opfer in Konzentrationslagern ermordeten, war nur eine der (psychologisch erklärbaren) Absurditäten, die bei den „ 1. Braunauer Zeitgeschichtstagen" deutlich wurden.
Auf Initiative des Innsbrucker Politologen Andreas Maislinger hatte der Braunauer Bürgermeister Gerhard Skiba die Zeitgeschichtstage ermöglicht. Dazu waren aus sechzehn dieser belasteten Orte in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Tschecho-Slo-wakei und Polen Politiker und/oder Historiker zusammengekommen, um zwei Tage lang ihre Erfahrungen über das „unerwünschte Erbe" auszutauschen und einen Ausweg aus dem Dilemma zu suchen, mit dem auch die Bewohner dieser Orte leben müssen. Wer würde denn außer die Gedenkstätten zu besuchen, auch die Sehenswürdigkeiten von Auschwitz oder Dachau bewundern oder in Braunau außer dem Geburtshaus Adolf Hitlers auch die liebevoll restaurierte Altstadt besichtigen?
Ganz abgesehen von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in die deutsche und österreichische Firmen mit belasteten Ortsnamen bei ihren internationalen Geschäftsverbindungen geraten, während etwa der Tourismus um den Obersalzberg zu einer wirtschaftlichen Hochblüte geführt hat.
Was tun? Wo ist die Grenze zwischen Tourismus und Gedenken, zwischen Vermarktung und Verharmlosung, zwischen Zurückhaltung und Verdrängung? Verschweigen, was vielen Bewohnern und den meisten Politikern am angenehmsten wäre, ist unmöglich, weil die „Störenfriede" -neben den Engagierten in den Orten selbst - vor allem von außen, insbesondere aus dem Ausland kommen. Also Flucht nach vorne - aber wie?
Am Beispiel Braunau wurden Lösungsmöglichkeiten diskutiert, zunächst auf der Tagung selbst und dann in einer öffentlichen Veranstaltung mit den Einwohnern der Stadt. Vor dem Geburtshaus Hitlers steht ein Gedenkstein: „Für Frieden, Freiheit und Demokratie. Nie wieder Faschismus. Millionen Tote mahnen", ohne Erwägung des Namens Adolf Hitlers.
Eine Tafel am Haus selbst wurde durch die Eigentümerin des Hauses verhindert, im Haus werden seit einigen Jahren Behinderten betreut, daher ist es nicht öffentlich zugänglich. Trotz zahlreicher Vorschläge für Veränderungen, Weiterentwicklung oder Umwidmung kam man schließlich zu dem Schluß, die jetzige Lö-
sung wäre die beste.
Selbst am vergleichsweise harmlosen Beispiel des Hitlerschen Geburtshauses wurde die Kluft zwischen den Vorstellungen von Historikern, Betreuern von Gedenkstätten beziehungsweise engagierten Gruppen und dem Pragmatismus der Politiker deutlich. Möglicherweise hat der Gedankenaustausch Ansätze einer Verständigung gebracht, die auf beiden Seiten nötig wäre.
Nicht nur die Politiker sollten sich von ihrer Angst um die Wählergunst weniger blockieren lassen, auch die Aufklärer sollten zur Einsicht gelangen, daß ihre oft dogmatischen Forderungen nicht nur an der Realität der Politiker, sondern auch an der Bevölkerung vorbeigehen. Was gesellschaftlich durch Jahrzehnte versäumt wurde, ist durch Frontstellung nicht nachzuholen.
Der Erfahrungsaustausch brachte viele interessante Details, nicht nur an Fakten, auch an Atmosphäre. So berichtete etwa der Museumsdirektor von Auschwitz, daß die alten Auschwitzer stolz darauf sind, daß keine Polen an der Errichtung des Lagers beteiligt waren und daß sie KZ-Häftlingen geholfen haben; erst die später zugezogenen Bewohner klagen, daß Besucher von Auschwitz die Sehenswürdigkeiten ihrer Stadt nicht wahrnehmen. Und er berichtet weiter, daß die polnische Übersetzung von „Mein Kampf derzeit sehr erfolgreich ist. Der Bürgermeister von Wunsiedel - der Ort in Bayern ist erst durch die Grabstätte von Rudolf Hess zu seinem „unerwünschten Erbe" gekommen-brachte seine Hilflosigkeit zum Ausdruck, mit dieser neuen Belastung zurandezukommen.
Sich der Vergangenheit stellen
In Kürze noch einige wichtige Eindrücke. Eindrucksvoll die Sachlichkeit der deutschen Referenten aus Buchenwald, Dachau, Nürnberg und Offenhausen, in der nicht nur Realismus zum Ausdruck kam, sondern auch die Einsicht, sich dem „unerwünschten Erbe" stellen zu müssen. Peinlich waren manche Themen, die von österreichischen Kommunalpolitikern angeschnitten wurden. Oder ist es wirklich wichtig, ob die Gemeinde Mauthausen prominente Besucher des ehemaligen Konzentrationslagers bewirten muß?
Unangenehm fiel auch auf, daß sich der Vertreter von Zipf, in dem ein Nebenlager von Mauthausen lag, jede einzelne Information richtiggehend aus der Nase ziehen ließ. Überhaupt zeichneten sich die österreichischen Politiker - im Gegensatz zu ihren deutschen, tschechischen und polnischen Kollegen - durch Larmoyanz aus. Sie gipfelte in der Klage das Mauthausener Vizebürgermeisters, die Bevölkerung von Mauthausen wäre am Konzentrationslager ebenso unbeteiligt gewesen wie die Polen in Auschwitz. Wissen sie wirklich nicht, was sie sagen?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!