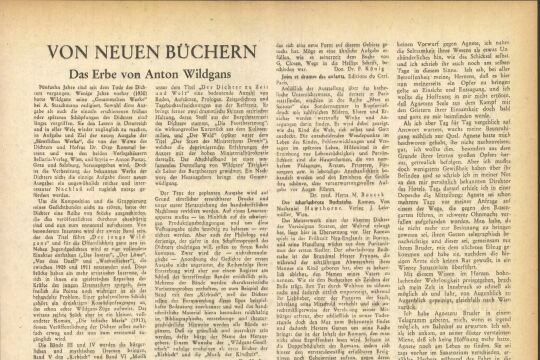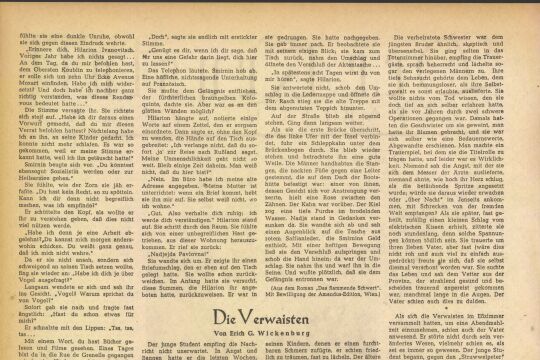Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Fixigkeit Peter Handkes
Der bereits erhobene Einwand gegen Peter Handkes neues Buch, „Wunschloses Unglück“, es sei zutiefst geschmacklos, eine Familientragödie so prompt und clever zu Literatur (und damit im Falle Hand-ke: zu Geld) zu machen, sowie umgekehrt die hingerissene Behauptung, die auch schon aufgestellt wurde, es sei nicht nur sein bestes, es sei sein ergreifendstes Werk bisher, können sich beide von dem Komplex Muatterl-mein-Muatterl nicht freimachen, bleiben also, in durchaus begreiflicher Weise, menschliche und außerliterarische Reaktion, ohne fachkritische Relevanz. Faktisch: Im November 1971 beging die Mutter des Autors in ihrem Kärntner Heimatort Selbstmord, wohl im Zusammenhang mit einer totalen Nervenzerrüttung, und zehn Monate später lag die Beschreibung ihres Unglücks und seine Psychogenese in Buchform vor, Erstauflage 25.000 Exemplare. Nicht ganz sieben Wochen nach ihrer Tat schritt der Sohn zu seiner Tat, sagte sich (und uns): „Ich möchte mich an die Arbeit machen“, und hatte das Manuskript binnen zwei Monaten („geschrieben Jänner/Februar 1972“) druckfertig gemacht.
Was Peter Handke mit diesem als „Erzählung“ bezeichneten Buch zustande bringen wollte, ist die „strukturell“ orientierte Beschreibung eines typischen Falles, und zwar kraft intimster Kenntnis desselben, weil es eben der dem Autor nächstliegende und nächststehende dieser Art war. Die ganze fatale Konstellation erschien diesem Publizisten, vielleicht schon längst,' einfach publikationsreif, und als die Mutter ihr „Wunschloses Unglück“ zu Ende gelitten hatte, war es soweit, auch für ihn: Jetzt wußte er genau Bescheid, nicht nur über die Ursachen, sondern auch die letalen Möglichkeiten als Folge. Handke stellt den im Grunde vom Anfang an aussichtslosen' Aufbau dieses Frauenlebens dar und den notwendig heillosen Abbau bis zur tödlichen Einsicht der Aussichtslosigkeit, und das in einem sozialen Stadium, Ironie des Schicksals, da endlich (für sie freilich zu spät) die lebenslange ökonomische Bedrängung gewichen war. Was sie zurückließ, war jedoch nicht Wohlstand, das schien nur so, es war die grausame Muße für die Erkenntnis, das schöne Leben auf nichts als traurige Weise verspielt zu haben:
Da war die erste und auch letzte Liebe zu einer aus kriegsbedingtem Anlaß schön uniformierten „Sparkassenexistenz“, im Zivil leider verheiratet (mit dem Erzähler als unehelich empfangenem Andenken) und infolgedessen, damit das Kind einen Namen hat, der kurz vor ihrer Entbindung geheiratete Unteroffizier, der ihr zuwider war und „der sie schon lange verehrte“, er hatte nämlich „mit seinen Kameraden darauf gewettet, daß er sie bekommen würde beziehungsweise daß sie ihn nehmen würde“. Hierauf weitere Kinder, etliche Abtreibungen und nicht enden wollende Notlagen, denn der ungeliebte Mann war und blieb Trinker, schließlich erkrankte er an Tuberkulose, und zwei Wochen vor seiner Rückkehr von einem längeren Kuraufenthalt schrieb sie die Ab-schied.^briefe, besorgte sich die vielen Tabletten und machte Schluß, einundfünfzigjährig. Der plötzliche Komfort mit Waschmaschine, Mixer, Kühlschrank und Gebrauchtwagen und auch die verordnete Reise ans Meer (alles vom jäh prominent gewordenen Sohn, jenem Andenken, beigesteuert) konnten nichts mehr helfen; im Gegenteil, all das gab ihr vielleicht den Rest.
„Auf einmal hatte ich in meiner ohnmächtigen Wut das Bedürfnis, etwas über meine Mutter zu schreiben.“ Klar, daß sich der Autor schonungslos in die Analyse einbezieht. Denn Schonung wäre eine private Haltung, und die wird, ja mit dem Entschluß zur Veröffentlichung aufgegeben. Übrigens, sich etwas von der Seele schreiben zu wollen, wäre Romantik: „Es stimmt nicht, daß mir das Schreiben genützt hat.“ Manchmal-sei er „all der Offenheit und Ehrlichkeit überdrüssig gewesen“ und habe gewünscht, „bald wieder etwas zu schreiben, wobei ich auch ein bißchen lügen und mich verstellen könnte, zum Beispiel ein Theaterstück“. Die vergebliche Roßkur an sich selbst ist als Therapie für andere gedacht, was den vor der Fernsehkamera geäußerten Wunsch nach einer großen Auflage durchaus einschließt.
WUNSCHLOSES UNGLÜCK: Von Peter Handke. Residenz-Verlag, Salzburg 1972. 100 Seiten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!