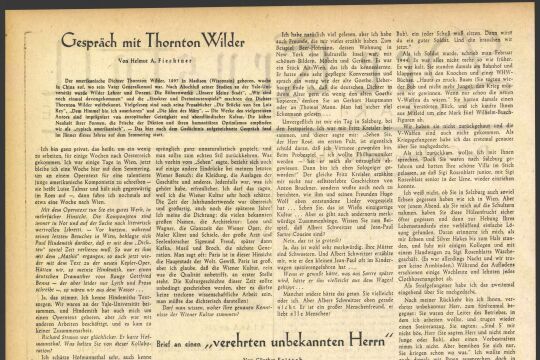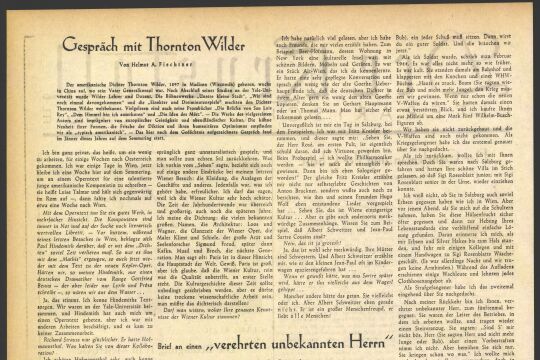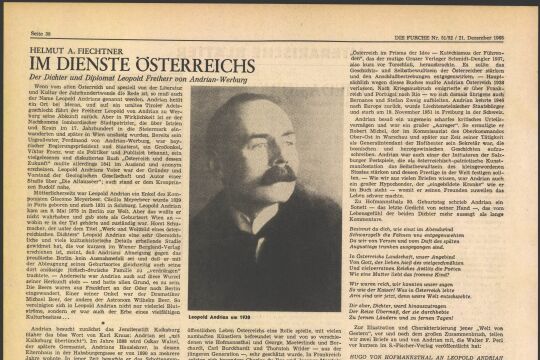Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Frau Doktor
Seit mehreren Tagen und Nächten beschäftigt mich — ohne ersichtlichen Anlaß — die Erinnerung an eine früh Dahingegangene — wenngleich nicht Frühvollendete — an eine Hochbegabte, Unvollendete, eine „Ringende“, wie man damals sagte. An die expressionistische Wiener Dichterin und Romanautorin Maria Lazar, deren um 1923 erschienener Erstlingsroman „Die Vergiftung“ beträchtliches Aufsehen erregte. Eigentlich war es — lange vor Ödön von Horvath — ein Roman seines Genres. Ein böser, giftiger Roman, der die „gemütliche“ Gesellschaft so richtig genüßlich und selbstpeinigend zugleich entlarvte, zerfleischte. Die anderen, die — wie Sartre Jahrzehnte später sagte — die Hölle sind. Zugleich aber natürlich auch sich selbst. Das eigene Herz.
Es war mehr ein Zufall, daß diese Starke, Unerbittliche den Sohn jenes großen Unerbittlichen heiratete, den Sohn Gustav Strindbergs. Daß sie diesen bitter verpflichtenden Namen trug. Nicht sehr lange trug. Sie ging nach der Heirat in sein Vaterland, soll unglücklich „geworden“ sein — sie war es von Anbeginn — und ist früh gestorben. Den zweiten Weltkrieg, die Rassenvernichtung, hat sie nicht mehr erdulden müssen. Der Religion nach war Maria Lazar katholisch, was sie jedoch nicht vor Verfolgung bewahrt hätte. Auch nicht, daß ihre angesehene Familie im Schottenhof ansässig war, noch daß ihr Bruder Erwin einen guten Namen als Nervenarzt hatte.
Sie war klein, schmächtig, mit dunkelbraunem, glattem Haar, einem tiefliegenden Blick unter starken Brauen, brünettem Teint. Eines Tages, es war in der untersten Klasse der „Gymnasialkurse“ von Frau Dr. Eugenie (Genia) Schwarzwald, in der Wallnerstraße, Wien I, stand sie mitten in der Deutschstunde auf, als wir gerade Gedichte aufsagen durften — in der Mehrzahl Goethe, C. F. Meyer, Keller und Wildgans — und trug auswendig Hofmannsthals „Tod des Tizian“ vor, von dem damals noch keine von uns kleinen Mädchen etwas wußte, obgleich die Verse schon vor mehr als 20 Jahren geschrieben, aber noch nicht lange im Buchhandel erhältlich waren.
Ich weiß nicht, ob sie je in einem anderen Rahmen einen stärkeren — einen ebenso starken — Eindruck hinterlassen haben wie in unserer Klasse und vor allem bei der Schreiberin dieser Zeilen, der sie zu jener frühen Zeit eine neue Welt dichterischen Ausdrucks offenbarten. Das war nicht eine Verzauberung durch den Reim und die fast litaneiartige Wiederkehr des Refrains wie bei Rilke, dessen „Cornett“ und „Das Stundenbuch“ wir schon kannten — das war nicht nur Musik, sondern auch Bildhaftigkeit einer Sprache von höchster Intensität.
Aber Maria hatte uns noch andere Überraschungen zu bringen.
Hier muß von der Schwarzwald-Schule die Rede sein, von der Schöpferin und Direktorin jener für die damals noch rein private höhere Mädchenbildung tonangebenden, .richtungsweisenden Mädchenmittelschule.
Genia Schwarzwald, geborene Nußbaum, stammte aus dem östli-lichen Randgebiet der Monarchie, aus der Bukowina, wo das gebildete Bürgertum, zumal das jüdische, geradezu leidenschaftlich der deutschen Sprache und Kultur anhing. Zu einer
Zeit, als in Österreich wie in Deutschland den Frauen das Studium an den Hochschulen noch nicht erlaubt war, ging sie mit ihrem jungen Gatten — dem späteren Sektionschef im Finanzministerium Doktor Julius Schwarzwald — nach Zürich und studierte dort Germanistik. (Ihre Vorliebe für Schweizer Autoren, vor allem für Gottfried Keller, hat sie ihren Schülerinnen stets einzuimpfen versucht.) Auch war sie eine der ersten Frauen Wiens, die — noch vor 1914 — kurzes Haar und lose Kleidung ohne steifes Korsett trug. Sie war impulsiv, enthusiastisch, hatte unorthodoxe pädagogische Ideen, die viel von den damals entstehenden „Freien Schulgemeinden“ vorwegnahmen. Daß die Praxis nicht immer ganz dem Ideal entsprach — wer könnte es ihr verübeln? Waren doch die älteren Mitglieder ihres ausgezeichneten vielköpfigen „Lehrkörpers“' eher konservativ und ohne ihre mitreißende Vitalität. Dafür hatten manche von ihnen Vorzüge, die ihr fehlten: stille Gelassenheit, vornehme Zurückhaltung, weises So-sein ohne viel Worte und Gesten.
So entstanden in der Schule zwei beinahe feindliche Lager. Genia wurde geliebt, ja vergöttert — aber auch abgelehnt, ja gehaßt. Ich zweifle, ob sie je das Ausmaß dieser Parteinahme gekannt hat. Die sie, meist aus Unverstand, mißachteten, vergötterten dafür eine andere Lehrerin, die der Inbegriff der „Lady“ für diese Backfische war.- Es kam zu wirklichen Gehässigkeiten zwischen diesen beiden Lagern, eine Schulaufführung scheiterte am Boykott der einen Gruppe durch die andere.
Ich hatte mit zwei anderen Mädchen meiner Klasse ein von mir verfaßtes kleines Festspiel in Versen einstudiert, das unverdient großen Erfolg bei dem nicht nur aus Schülern und Lehrern bestehenden Publikum errang. Ich wurde beglückwünscht, umarmt, mit Lobsprüchen überhäuft. Und dann trat Maria auf, dunkel gekleidet (im Gegensatz zu uns anderen, die helle duftige Festkleider trugen) und sprach Verse, von denen wir nichts geahnt hatten. Selbstgedichtete vollendete Verse, Terzinen von großer Innerlichkeit, in denen sich ihre grenzenlose echte Liebe zur „Frau Doktor“ (wie Genia allgemein genannt wurde) ausdrückte, deren frohes, extravertiertes Wesen dieses scheue, introvertierte kleine Mädchen doppelt ansprach und beglückte. Sicher erfaßte Maria diese schöpferische Frau, die auch im ersten Weltkrieg Unzähligen geholfen hat, viel besser und tiefer, als wir andern, die wir uns oft an Oberflächlichem stießen und sie verkannten. Ich habe mir Marias Verse über Jahrzehnte gemerkt...
Arme Maria, die ein schweres Schicksal früh dahinraffte, ärmere Genia Schwarzwald, die, mehr als sechzigjährig, verwitwet und schwerkrank, ihre Heimatstadt (denn das war Wien ihr geworden), die einen Kreis erlesener Menschen und Künstler — darunter Kokoschka, Loos, Wellesz u. v. a. — um sich geschart hatte, die ihr Lebenswerk im Stich lassen und nun, nicht mehr hoffnungsfroh wie einst, in die Schweiz auswandern mußte, wo sie nach kurzer Zeit elend und arm ihrer Krankheit erlag. Nur noch wenige ihrer Schülerinnen, ihrer Freunde, leben noch in unserer Mitte und noch geringer ist die Zahl derer, die ihr Andenken lebend bewahren.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!