
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die freie Kunst im Kirchenraum
Wer jetzt die Sixtinische Kapelle besucht, wird Zeuge eines einmaligen geschichtlichen Vorgangs. 1980 haben die Restaurierungsarbeiten der Decke begonnen. Die Lunetten sind bereits gereinigt; die Farben treten in ihrer ursprünglichen Leuchtkraft hervor. Der Besucher kann sie mit den noch in dämmriges Halbdunkel gehüllten Deckenfresken vergleichen, deren Restaurierung sich bis 1988 hinziehen wird.
Der Anblick der Originalfarben war zuvor nur wenigen vergönnt; Professor Mancinelli, der Leiter der Restaurierungsarbeiten, ist der Uberzeugung, daß die Fres-
ken bereits wenige Jahrzehnte nach ihrer Entstehung durch Weihrauchwolken und Kerzenruß geschwärzt waren.
Die Restaurierung lenkt unseren Blick auf die Entstehung dieses Riesenwerkes. Es war nur möglich, weil der schöpferische Funke zwischen zwei außergewöhnlichen Menschen übergesprungen ist: zwischen Papst Julius II. und Michelangelo. Beide waren jähzornig und unbeugsam, beide wurden von den Zeitgenossen als „terribile" angesprochen. „Terribile" heißt zunächst gewalttätig, fürchterlich, angsterregend, meint aber mehr: unter der Gewalt des „Dämons" stehend, des schöpferischen Dämons, der Genialität verleiht.
Das Zusammenwirken der beiden gestaltete sich daher schwierig. Dazu kam, daß Michelangelo zwar als Bildhauer berühmt war, aber nicht als Maler. Trotz der Intrigen der Künstlerkollegen, etwa eines Bramante, blieb der Papst beim Auftrag an Michelangelo. Dieser nahm die Herausforderung an.
Das Bildprogramm stand für den Papst seit langer Zeit fest: er wollte während der Messe die ' Apostel — sozusagen als Teilnehmer — vor sich sehen. Doch das
war Michelangelo zu wenig. Während schon der Verputz an der Decke aufgetragen wurde und Staub und Lärm die Kapelle erfüllten, wagte er es, dem Papst zu sagen: „Das mit den Aposteln wird eine armselige Sache werden." Der Papst, mit der sicheren Witterung für die Genialität Michelangelos, entgegnete rasch: „Mach, was du willst!"
Das war natürlich kein Freibrief für Michelangelo, die gesamte Ikonologie selbständig zu entwickeln. Doch aus seiner Zusammenarbeit mit den vatikanischen Theologen entstand dann das gewaltige Programm, das die gesamte Schöpfungsgeschichte umfaßt. Wie Michelangelo das in . den folgenden vier Jahren verwirklichte, war allein seine Sache: noch nie war Gott so gewaltig, als Verkörperung des Schöpferischen, dargestellt worden. Flankiert werden die Szenen von den „Ignudi", herkulischen nackten Jünglingen, und von den groß gesehenen Gestalten der Propheten und Sibyllen. Als das Werk 1512, nach vierjähriger Arbeit, fertiggestellt war, äußerte sich der Papst „sehr zufrieden" darüber. Michelangelo, der Melancholiker, war es nicht. In einem seiner Gedichte heißt es: „Wer ist vollendet, saget, Wer in der Kunst, im Leben Vor seiner letzten Stunde?"
Auch Anwalt des Eros
Doch auch manche Nachfolger des Papstes hatten Schwierigkeiten mit dem Werk. Vertreter der Reformpartei spürten mit sicherem Instinkt, daß Michelangelo -wie die gesamte abendländische Kunst nach ihm — auch Anwalt des Eros war. Papst Hadrian VI., ein sittenstrenger Holländer, zeigte sich schon wenige Jahre danach empört darüber, daß er die Messe „in einer Badstube", einer „stufa d'ignudi", zelebrieren sollte. Ähnlich erging es später dem „Jüngsten Gericht" Michelange-
los in derselben Kapelle, das auf Grund der Beschlüsse des Trien-ter Konzils von Daniele da Volter-ra, einem seiner Schüler, an gewissen Stellen übermalt werden mußte, was ihm den Spottnamen eines „Hosenlatzmalers" („bra-chettone") eintrug.
Ein mühsamer Prozeß
Seither geht es nicht mehr ohne Konflikte im Verhältnis zwischen Kunst und Kirche, Künstler und kirchlichem Auftraggeber. In dieser Situation gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder man begnügt sich in den Kirchen mit harmlosen Werken zweitrangiger Künstler, die dem Text des alten Kirchenliedes entsprechen: „Was unsre Ruhe störet, gestatte nicht, o Herr!" Oder aber man begibt sich in die Konfliktzone, wagt es, bedeutende Künstler einzuladen, die nicht nur mit einem Kopfnik-ken auf die Wünsche des Auftraggebers antworten, und vertraut darauf, daß der schöpferische Funke überspringt.
Auch heute noch ist der Auftraggeber als schöpferische Persönlichkeit unersetzlich. Uberall, wo in Österreich nach 1945 Außergewöhnliches im kirchlichen Bereich verwirklicht wurde, stand ein Auftraggeber dahinter, der sich voll einsetzte. Es sei an den Pfarrer von Salzburg-Parsch erinnert, der mit der Arbeitsgruppe 4 den ersten wichtigen Kirchenbau nach dem Krieg realisierte, und dazu als Künstler Kokoschka, Wotruba und Mikl einlud, oder an Pfarrer Zauner, der gegen mancherlei Schwierigkeiten durchsetzen konnte, daß Rudolf Schwarz den Auftrag für Linz-St. Theresia erhielt, schließlich Margarethe Ottiiiinger, der der Bau der Wotruba-Kirche in Wien zu verdanken ist.
Natürlich leben wir nicht mehr im Zeitalter des Absolutismus. Wir müssen mit Gremien leben, können aber dafür sorgen, daß darin Menschen mit hohem Quali-
tätsbewußtsein das Sagen haben. Wir können auch nicht die Gemeinde überfahren: sie muß einbezogen, muß überzeugt werden. Nur dann ist die Chance gegeben, daß das Werk angenommen wird, wie das etwa im Fall der Glasfenster von Markus Prachensky in der Franziskanerkirche in Enns geschehen ist, wo der Künstler — dem in einem Wettbewerb der erste Preis zuerkannt worden war — ohne alle gestalterischen Auflagen den Auftrag erhalten hatte, Fenster zum Sonnengesang des hl. Franziskus zu schaffen.
Der Prozeß ist mühsam, doch gibt es dazu heute keine Alternative. Dabei sind Theologen wichtig, die Augen im Kopf haben und Gesprächspartner des Künstlers sein können. Darum müssen
schon die jungen Theologen mit der modernen Kunst konfrontiert werden, weshalb jetzt etwa an der Katholisch-Theologischen Hochschule Linz ein „Institut für Kunst und Kirchenbau" gegründet wurde. Das ist sicher nicht nur die Nebenaufgabe einer theologischen Fakultät, sondern der - gewiß bescheidene—Beitrag, den sie hier zu leisten vermag.
Wir werden trotzdem damit rechnen müssen, daß weiterhin Hauptwerke der religiösen Kunst, wie etwa der Leben-Jesu-Altar von Emil Nolde, in Museen landen, weil die Augen der Christen „gehalten" sind. Abfinden können wir uns damit nicht. Oder mit den Worten von Otto Mauer: „Christentum muß doch etwas Kreatives sein."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!























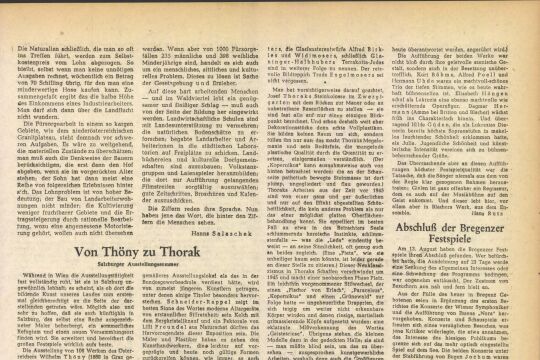






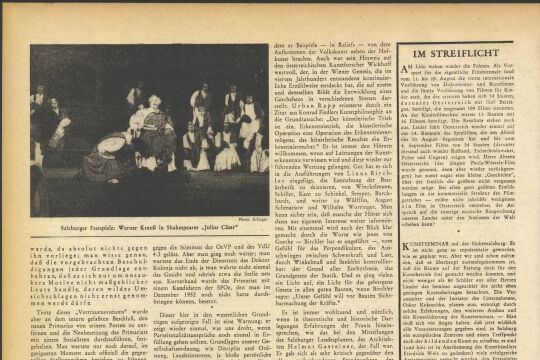


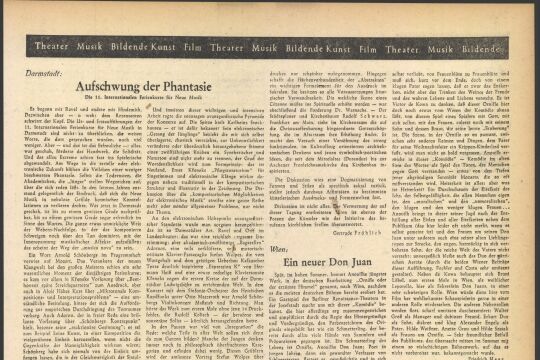

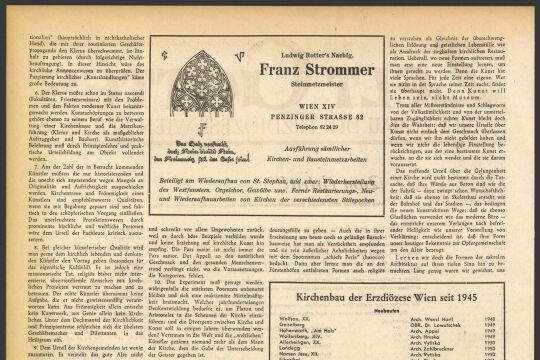





























































.png)