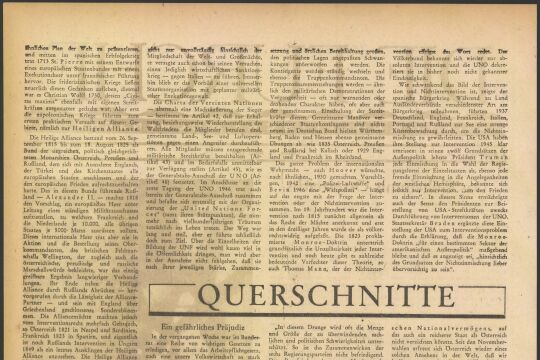Die Heimkehr des Beatniks
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn wurde in der jüngstvergangenen Zeit für viele Menschen Trost und Verheißung. Einer „vaterlosen Gesellschaft“ zeigt es das Imago eines Vaters, dessen Liebe und dessen Autorität den längeren Atem hat; und das Elend des Sohnes, der sich zu seinem Glück im Unglück dieser Tatsache erinnert, der heimkehrt, um Vergebung bittet und diese nicht nur erlangt, sondern festlich geschmückt in die alte Hausgemeinschaft aufgenommen wird. Lukas erzählt in seinem Evangelium dieses Gleichnis in Zusammenhang mit dem vom verlorenen Schafe; und in beiden Gleichnissen erleben die, die in der Herde oder im geordneten Hausstand verbleiben, ihre Pleite. Sie sind gering geschätzt in der Stunde der Heimkehr und der Heimholung des Verlorenen; und sie empfinden darüber Schmerz und Verbitterung und haben das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn läßt eine letzte Frage offen: Wie werden Bruder und Bruder, Vater und Söhne Zusammenleben; dann, wenn die Freude der Wiederkehr und der erste Schmerz der Enttäuschung vorbei sein werden; wenn in der altertümlichen Hauswirtschaft die Fragen auftauchen, die man jetzt die psychologischen und die sozialen Probleme der sozialen Gruppe nennt? Der eine hat seinen Ertragsanteil schon vertan; dem anderen wird er erst nach des Vaters Tod zustehen; der eine ist ein Nichtsnutz in den Augen der Knechte und Mägde; der andere ist verläßlich, efficient. Über diese Probleme schweigt Lukas; sein Problem ist kein soziologisches und kein wirtschaftliches, sondern eines, das den Sinn des Lebens betrifft.
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn wurde in der jüngstvergangenen Zeit für viele Menschen Trost und Verheißung. Einer „vaterlosen Gesellschaft“ zeigt es das Imago eines Vaters, dessen Liebe und dessen Autorität den längeren Atem hat; und das Elend des Sohnes, der sich zu seinem Glück im Unglück dieser Tatsache erinnert, der heimkehrt, um Vergebung bittet und diese nicht nur erlangt, sondern festlich geschmückt in die alte Hausgemeinschaft aufgenommen wird. Lukas erzählt in seinem Evangelium dieses Gleichnis in Zusammenhang mit dem vom verlorenen Schafe; und in beiden Gleichnissen erleben die, die in der Herde oder im geordneten Hausstand verbleiben, ihre Pleite. Sie sind gering geschätzt in der Stunde der Heimkehr und der Heimholung des Verlorenen; und sie empfinden darüber Schmerz und Verbitterung und haben das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn läßt eine letzte Frage offen: Wie werden Bruder und Bruder, Vater und Söhne Zusammenleben; dann, wenn die Freude der Wiederkehr und der erste Schmerz der Enttäuschung vorbei sein werden; wenn in der altertümlichen Hauswirtschaft die Fragen auftauchen, die man jetzt die psychologischen und die sozialen Probleme der sozialen Gruppe nennt? Der eine hat seinen Ertragsanteil schon vertan; dem anderen wird er erst nach des Vaters Tod zustehen; der eine ist ein Nichtsnutz in den Augen der Knechte und Mägde; der andere ist verläßlich, efficient. Über diese Probleme schweigt Lukas; sein Problem ist kein soziologisches und kein wirtschaftliches, sondern eines, das den Sinn des Lebens betrifft.
Am 21. Oktober 1969 starb Jack Kerouac, dessen Roman aus 196G, „Satori in Paris“, jetzt in deutscher Übersetzung erschienen ist. Kerouac hat sein Leben als „Tramp“ verbracht. Tramp hieß ursprünglich im Amerikanischen soviel wie Vagabund, Strolch, dann allgemein: ein unstet Herumziehender. In Büchern, die Weltbestseller der sechziger Jahre wurden, hat Kerouac dieses Leben beschrieben. Er schrieb nicht seine Biographie, er schrieb einer Jugend das Manifest, die daran war, mit einem unersättlichen Durst nach Freiheit aus der Konsumgesellschaft des Nachkriegsamerika auszuzie- hen; sich den Zwängen dieser Gesellschaft zu entziehen. Im Jahrzehnt des Rationalismus, im Zeitalter der Kybernetik, schuf er einen Mythos. Für ihn war das ehrsame Leben nicht das glückselige Leben, das errechenbare Wirtschafts-,, Wunder“ nicht die beste, sondern die schlechteste Welt. Er inszenierte nach den Motiven der „beat generation“: Freiheit, Tempo, Jazz, Sex, Rauschgift, ein anderes Schauspiel des Lebens.
Die Neunmalklugen durften damit rechnen, daß auch dieses Außersich- sein nicht von Dauer sein würde. Dann, wenn all das verrückte Zeug vertan sein würde; dann würden sie dem großen Verführer, seinen üblen Einflüssen, die Verführten wieder entwinden: Die Sexbesessenen werden verehelicht. Die Rauschgiftsüchtigen entwöhnt. Die Musikalität der Jazzfanatiker auf andere Rhythmen eingeschliffen. Die Temposünder gebremst. Die Freiheit gereinigt. In einer Stunde wie dieser hat die Reaktion für die Revolutionäre immer schon das andere, das geborgene Leben bereit. Nur wenige enden vor dem Sandhaufen, über den man sie schießt.
Spätherbst der Revolution
In seinem Roman „Der letzte Student“ beschreibt der österreichische Dichter Rudolf Bartsch das Schicksal der Wiener Studenten in der Revolution von 1848. Ihren Auszug zur umjubelten Maiparade: Im schwarzen Samtrock, Hose in noblem Grau, das „deutsche Schwert“ an der Seite, den Schlapphut mit wippenden Straußfedem, das dreifarbene Band um die Brust. Am meisten um jubelt: die Musensöhne des „Künstler- Corps“, die Hörer der Akademie, angeführt von Kunsthändlern, die in dem Geruch stehen, Mäzene zu sein, Hofschauspielem, die der heroischen Stunde das Pathos liefern, Ingenieuren, die es eine Zeitlang weniger mit der Statik halten wollen. Und überall: Frauen, Mädchen, die winken und begeistert begeistern.
Fünf Monate nachher: ein trüber Oktober. Eine Sache, die politisch vertan, militärisch verloren, alles in allem so strapaziös geworden ist, daß den Wienern einfach die Strapaz zu fad wird. Im letzten Gefecht stehen neben den verzweifelten Mobilgarden der Vorstädte die Kompanien der Legion. Die Kampfstärke, besonders die des „Künstler-Corps“, ist schwach. Und so komplettiert man den Stand: mit Stuckateuren und
Vergoldern, Schildermalern und Tapezierern, Moritatenbildermalem und -händlern, Schrrüerkomödianten, Polieren und mit dem letzten Aufgebot derer, denen immer die verzweifelte Situation die Erlösung aus ihrer Verzweiflung bringt. In dieser Situation sieht der Held des Romans seinen „verlorenen Vater“ wieder: einen Schmierenkomödianten, der seinem Eheweib durchging; dem die Mutter beim Sohn das Imago des großen Künstlers wahrte; und der in der Katastrophe noch einmal auftaucht und das Pathos aus dem Rausch produziert. Es ist die Tragödie des Sohnes, der in der Krise keinen Vater und kein Heimgehrecht hat; der das Heil im Untergang der Welt, die ihn umgibt, sucht.
Es gibt ein Namensverzeichnis der 1848/1849 im Belagerungszustand, der der Revolution folgte, verurteilten Personen. Vor dem Sandhaufen fielen: Keine Wiener, sondern Gemeine aus den Infanterieregimentern, die übergelaufen waren zur Revolution; Robert Blum aus Leipzig, Alfred Julius Becher aus Manchester, Hermann Jellinek, Doctor der Philosophie, aus Mähren; Schneidergesellen aus Böhmen und Kroatien; und die „Zuag’rast’n“, auf deren Totenzettel steht: Zuletzt wohnhaft in Wien, Fünfhaus oder Alsergrund, deren Namen das Vielvölkerreich im Totenreich vertreten mußten.
Dieser Spätherbst nach der Revolution, das war die Situation der Monarchie an der Wegegabelung. Was nachher kam, das war eine Reaktion, die zum Schluß nur noch eine Variante entließ: die nationale und die soziale Revolution.
Geschichte wiederholt sich nicht, lehrte Friedrich Heer seine Leser. Sie wiederholt sich. Sie hat nicht so viele Motive und Modelle bei der Hand, um bei jedem Szenenwechsel mit einem neuen Fundus einen besseren Regieeinfall auf die Bühne zu bringen. Es ist immer wieder dieselbe Szene an der Wegegabelung: Die Revolution verkrümelt sich für eine Weile über einen Weg, der scheinbar ins Nichts führt; die Reaktion offeriert ihre bezwingende Aktualität: Nichts ist erfolgreicher in der Politik als der Erfolg. Die verlorenen Söhne fangen an, den Vater zu suchen.
In dem Roman Kerouacs, von dem hier die Rede sein soll, treibt den Autor kurz vor seinem Tode ein scheinbarer Spleen nach Frankreich. Er will in den Pariser Archiven und Bibliotheken und in der Bretagne die Vorfahren seines alten frankokanadischen Namens suchen. Die Buchbesprechung redet von einer Odyssee; aber es will nicht der Ehegemahl heim zur Gemahlin; es sucht der Sohn den Vater: Die Neue Welt den alten Kontinent; der Sohn aus dem melting pot die definierte Reihe der Ahnen; der Verlorene das große Mahl am gedeckten Tisch derer, die immer daheim bleiben.
Die Leser der Evangelienbücher werden in diesem Buch mit 116 Seiten, geschrieben im Ausdruck eines delirium tremens, vergebens die ergreifende Szene des In-die-Arme- Sinkens und des sich Wiederfindens suchen. Wahrscheinlich geschah aber auch das Ereignis des Gleichnisses des Lukas überhaupt nicht so, wie es 1850 Jahre nach seiner Erzählung die Nazarener des 19. Jahrhunderts, besonders Josef von Führich, in sauberen, zur Massenvervielfältigung bestimmten Graphiken bebilderten. Denn: der Sinn dieses
Gleichnisses hat nichts mit der agrarischen Hausordnung des Altertums zu tun. Es garantiert keine abgesicherte Existenzmöglichkeit des Heimgekehrten. Es sagt darüber überhaupt nichts. Es reflektiert auf eine suchende und (ein eventueller jugendlicher Leser möge es mir verzeihen) auf die erbarmende Gottesliebe.
Es passiert et was
Kerouac scheitert auf seiner Reise in die Vergangenheit. In den Bibliotheken und Archiven findet er nichts; und er erreicht niemals bei Tag die Landschaft der Heimkehr in die Bretagne. Sein äußeres Dasein in den Tagen der sogenannten Odyssee unterscheidet sich in nichts von dem, was er in früheren Büchern mit Bildern voll wüster Ausgelassenheit beschreibt. Suff und Huren, ein exzentrisches Kunsterlebnis in einer alten Kirche und der Umgang mit Menschen in der Dämmerung ihres Daseins. Unversehens nur erlebt er die „Erleuchtung“, das, was er mit dem japanischen Wort, später Nachhall des Vergrabenseins in die Zen-Philosophie, Satori nennt: plötzliche Erleuchtung, Geistesblitz; es „passiert etwas“ nach jenen unzähligen Happenings auf dem Zug ins Irrationale des Beat- Zeitalters.
Auf der letzten Strecke diesseits des Ozeans, auf der Taxifahrt zum Flughafen Orly, erlebt der Prophet der Beat-Generation für einen Augenblick die Pein des endgültigen Abschiednehmens, das Bewußtsein: „Ich bin gewesen.“ Das Buch schließt mit dem Satz: „Wenn Gott sagt ,Ich Bin Gelebt’, werden wir vergessen haben, was es mit all dem Abschiednehmen auf sich hat.“
Das aber geschieht nach jener Nacht, in der er, ohne Gepäck, das er verloren hat, nicht im Flugzeug, sondern im Nachtzug von Paris nach Brest fährt. Neben ihm ein Priester. Und hier, zum Schluß, das Bekenntnis des Beatniks angesichts des Priesters (wörtlich zitiert):
„Ich bin auch katholisch.“
Er (der Priester) nickt.
Er (der Priester) ist so ein kleiner Kerl, man könnte ihn mit einem religiösen Ausruf wie etwa „O Se- gneur!“ (Oh Herr!) glatt wegputzen.
(Der Beatnik): „Jesus wurde gekreuzigt, weil Er an Stelle von Geld und Macht nur die Versicherung mitbrachte, daß das Leben von Gott geschaffen wurde, und daß es Gott dem Vater gehört, und Er, der Vater, wird uns nach dem Tod in den Himmel heben, wo niemand Geld und Macht braucht, denn das kommt erst nach allem Staub und Rost. Wir, die wir die Wunder Jesu nicht gesehen haben, wie die Juden und die Römer und die Handvoll Griechen und die anderen von Nil und Euphrat, wir müssen nur weiterhin die Versicherung akzeptieren, die uns in der Heiligen Schrift des Neuen Testaments überliefert worden ist. Es ist genauso, als würden wir, sobald wir jemanden sehen, sagen: ,Er ist es nicht, Er ist es nicht!“ ohne zu wissen, wer Er ist, und nur der Sohn kennt den Vater. Daher der Glaube, und die Kirche, die den Glauben verteidigte, so gut sie es konnte.“
Kein Beifall vom Priester, aber ein seitlicher Blick von unten herauf, ganz kurz, wie der Blick eines Bei-/ fäll Spendenden, Gott sei Dank. (Ende des wörtlichen Zitates.)
Verfall ohne Wiederkehr
Aber das mit dem Beifall, das sich übersteigernde Pathos, das gehörte schon zu der anderen Heimkehr. Zu Verfall ohne Widerkehr. Zum Tramp, der nach Hause, nach Florida will, damit er da ist, wenn der Briefträger die neueste Nummer der „Comics“ hereinschmeißt. Der Blick des Priesters von unten herauf war nicht das Satori des Tramps. Jedenfalls kam es nicht am Schluß dieser würdevollen Rede; es widerfuhr dem Sohn im Taxi, als sich der Glaube an das göttliche Ich Bin Gelebt dem Wissenden eröffnet, in dem die Gewißheit wächst: Ge wesen, Verwesen.
Aber — lesen wir es besser noch einmal bei Lukas nach, wie das war; mit dem Vater und mit dem Sohn. Dann werden wir die vielen Kerouacs verstehen, die es verständlich machen können, wie es geschieht auf der Heimkehr. Immer wieder. So lange Gott lebt. Ewig.
SATORI IN PARIS. Von Jack Kerouac. dtv, München 1971, 116 Seiten, Preis 22.50 S.