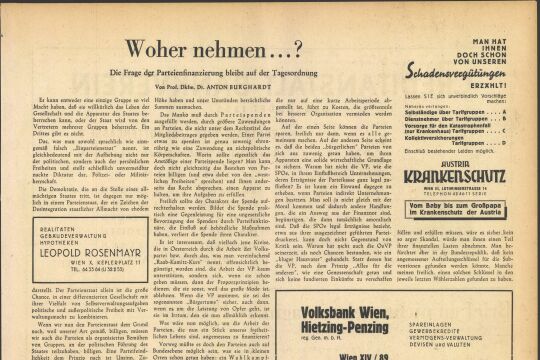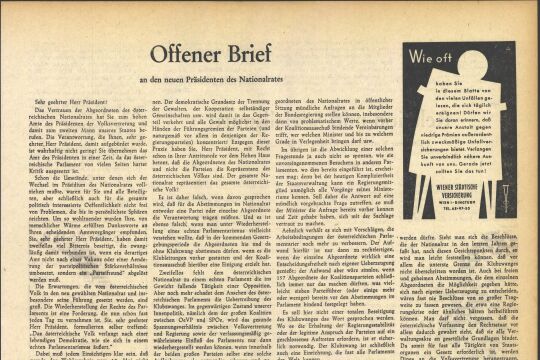Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die letzte Volks wähl?
Die beiden Kandidaten stehen fest. Dr. Kirchschläger wird von der SPÖ präsentiert, was niemanden, der sich aufs Beobachten versteht, überrascht. Dr. Lugger, nicht Dr. Withalm, wird von der ÖVP aufgeboten, was sogar für versierte Beobachter eine saftige Überraschung war. Fest steht auch, daß am 23. Juni der neue Bundespräsident aus direkter Volkswahl hervorgehen wird, wie es die Verfassung vorschreibt. Aber diese Vorschrift ist nicht unbestritten. Abseits von der Wahlkampagne gedeihen Überlegungen, diese Volkswahl späterhin abzuschaffen.
Die beiden Kandidaten stehen fest. Dr. Kirchschläger wird von der SPÖ präsentiert, was niemanden, der sich aufs Beobachten versteht, überrascht. Dr. Lugger, nicht Dr. Withalm, wird von der ÖVP aufgeboten, was sogar für versierte Beobachter eine saftige Überraschung war. Fest steht auch, daß am 23. Juni der neue Bundespräsident aus direkter Volkswahl hervorgehen wird, wie es die Verfassung vorschreibt. Aber diese Vorschrift ist nicht unbestritten. Abseits von der Wahlkampagne gedeihen Überlegungen, diese Volkswahl späterhin abzuschaffen.
Diese Erwägungen, deren Verwirklichung eine grundlegende Verfassungsänderung voraussetzen würde, werden nicht an einigen wenigen, unbedeutenden Punkten angestellt, sie ziehen sich quer durch die Gesellschaft und quer durch die Parteien. Jetzt, aus gegebenen Anlaß, dringen sie auch an die Öffentlichkeit, sozusagen als ein „Vorschlag für die Zeit danach“. Was ist es nun, was in manchen Augen gegen die Volkswahl spricht?
Wie so häufig, wird, wenn auch nicht an erster, so doch an gravierender Stelle solcher Gespräche, die „Kostenfrage“ ins Treffen geführt. Der teure Wahlkampf, der durch hohen propagindistischen Aufwand sowohl die Parteien als auch deren jeweilige Geldquellen stark in Anspruch nimmt.
Aber vor diesem harten Kern werden noch ganz andere Kriterien angeführt, wie etwa:
• Ein womöglich heftiger Wahlkampf beschädige das Image des späteren Bundespräsidenten „für alle Österreicher“;
• infolge der notwendigerweise das Persönlichkeitsbild verzerrenden Propaganda sei es dem Wähler kaum zuzumuten, aus den angebotenen Kandidaten auch den am besten geeigneten Mann herauszufinden;
• Tatsächlich sei es nur den traditionellen Großparteien möglich, einen Kandidaten mit realen Erfolgschancen aufzustellen und schließlich
• sei es in „fast allen vergleichbaren Staaten“ üblich, den Staats- oder Bundespräsidenten vom Parlament (oder den beiden Kammern) wählen zu lassen.
Wenn man einmal davon absieht, daß direkte Wahlen ein demokratischer Akt sind, den man wegen etwaiger „Kostenpunkte“ nicht beliebig verändern darf und daß die unerquicklichen und teuren „Showeffekte“ auch durch Übereinkünfte, ja, sogar durch Gesetz erfolgreich beschnitten werden können, tritt immer mehr hervor, daß der seinerzeitige Verfassungsgeber sehr viele gute Gründe gehabt haben muß, eine direkte Volkswahl (mit Wahlpflicht) zu konstituieren.
Der österreichische Bundespräsident ist sehr viel mehr als bloß ein Staatsnotar. Seine Rechte und Pflichten sind, sowohl was deren Anzahl als auch, was deren Bedeutung anbelangt, weitaus größer als die vieler anderer demokratischer Staatsoberhäupter oder Präsidenten. Während „die Parteien“ in unserer Verfassung keine besondere Rolle spielen, sondern als ein sinnfälliger Ausdruck der Meinungs-, Versammlungs-, Koalitions- und Wahl-„Freiheit“ zutage treten, ist der Bundespräsident a priori Garant und Repräsentant von Staat und Verfassung und als solcher wurde er bewußt über alle Parteiungen gestellt. Indem er aus direkter Volkswahl hervorgeht, wird ein unmittelbarer und nicht schadlos aufzuhebender Zusammenhang zwischen Staat und Verfassung, Garant und Repräsentant und dem „eigentlichen Souverän“, „dem Volk“ schlechthin, hergestellt.
Sofern dieser hoheitsvolle Akt für irgend jemanden noch von mehr als nur symbolischer Bedeutung ist, wird ein so denkender Staatsbürger „heftige Wahlkämpfe“, das Persönlichkeitsbild „verzerrende Propaganda“ und die faktische Kraft der normalerweise den oder die Kandidaten hervorbringenden Parteien, wenn auch mitunter mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, dies aber nicht diverser Entartungen wegen — die ja keine zwingende Folge der Verfassung, sondern vielmehr des Verhaltens der Menschen sind — preisgeben wollen.
Wir erleben gegenwärtig eine Phase bürgerlicher Gesinnung, die immer lauter und häufiger nach „direkter Demokratie“ verlangt. Volksbefragungen ^Volksbegehren, ^Bür-gerinitiativen sind nicht nur im Schwange, sie finden mehr und mehr Eingang in Gemeinde- und Landesverfassungen, wobei es sehr viele Anlaßfälle gibt, von denen sich behaupten ließe, daß sie für den, wie es so schön heißt: „maßgerechten Durchschnittsmenschen“, der nun entscheiden soll, durchaus nicht „einsichtig genug“ sind. Aber das muß man in Kauf nehmen. Wenn dem so ist — und es ist so! —, dann wäre die Abschaffung der „Volkswahl“ ein „Souveränitätsentzug“, der mit der klar auszumachenden Entscheidungsfreudigkeit des Bürgers schlecht zu vereinbaren wäre.
Der Vorschlag, den Wahlvorgang in die Bundesversammlung zu verlegen, wo „Politiker, die es wissen müssen“, sitzen und entweder einen gemeinsamen Kandidaten aushandeln oder auf Grund der Verhältnismäßigkeit wählen (wobei wohl auch mehrere Kandidaten gegeneinander stünden), hat wenig für sich. Vor allem ist daran nicht auszumachen, warum eine solche Entscheidung hinsichtlich ihres Ausganges einer Volkswahl an Qualität überlegen wäre. Ganz im Gegenteil: als nächstes Argument wäre mit Sicherheit der Vorwurf der „Packelei“ zu erwarten und in der Tat, wenn alles reibungslos verlaufen sollte, dann entweder, weil es „gut paktiert“ worden ist (mit dem Vorgang nichts zu tun habende „Kapitulationen“, die schließlich das hohe Amt selbst beträfen, mit eingeschlossen) oder weil sich eine Gruppe mit so erdrückender Mehrheit fände, die ihren Willen — losgelöst vom Volkswillen — allein durchsetzen könnte. Dabei sollte man nicht aus dem Auge verlieren, welche unerhört wichtige Rolle gelegentlich ganz kleinen, vielleicht sogar radikalen Fraktionen bei dieser „Königsmacherei“ zufiele!
Das Argument, „die Politiker wissen es besser als der Wähler“, müßte dazu führen, daß das auch auf viele andere, analoge Anlässe abfärbt. Sehr rasch hätten 'wir einen dann auch verfassungsrechtlich untermauerten Zustand des „demokratischen Zentralismus“, der unseren politischen Denk- und Verhaltensweisen exkat zuwiderliefe.
Daß eine in die Parlamente verlegte Wahl des Staatsoberhauptes der „Normalzustand“ unserer Umwelt sei, trifft überhaupt nicht zu. Nur dort ist dies der Fall, wo — wie in der Bundesrepublik Deutschland oder in Italien — dem Staatsoberhaupt fast ausschließlich nur rein respräsentative und staatsnotarielle Rechte und Pflichten zugemessen wurden; oder wo dieses Staatsoberhaupt in der Person eines Monarchen in Erscheinung tritt, was natürlich auf einer von der unseren grundverschiedenen Konstitution beruht und daher zum Vergleich nicht herangezogen werden kann. Hier walten ja auch noch Restbestände erblicher Souveränität, über die man verschiedener Auffassung sein kann, die aber bei uns nicht mehr vorhanden sind und auch, was immer man dafür oder dagegen einwenden würde, keineswegs „vor der Türe stehen“.
Es gehörte bisher zum durchaus erwarteten „Wohlverhalten“ aller Bundespräsidenten, von ihren Rechten — über deren Ausmaß und Wirkung in der Öffentlichkeit leider recht wenig bekannt ist! — äußerst sparsamen Gebrauch zu machen. Darin mag man auch einen Akt politischer Weisheit der jeweils Gewählten erkennen. Aber eben deshalb konnte auch die Ansicht entstehen und sich allmählich verbreiten, es sei mit den politischen Vollmachten des Staatsoberhauptes „nicht weit her“ und man könne sich die direkte Volkswahl, bei der es — ausgenommen den Partei- und Pres'tigepoliti-kern — um „nichts gehe“, im Grunde „ersparen“. Und schon wird in aller Öffentlichkeit gefragt, ob es „überhaupt einen Sinn habe, Kandidaten aufzustellen“ und in der gedanklichen Verlängerung, ob es nicht „viel besser wäre, den ohnedies bloß feierlichen, sonst aber eher bedeutungslosen Akt“ in die parlamentarische Szenerie zu verlegen. Was — nicht zuletzt! — auch noch zur Folge hätte, daß der Staatsbürger bei jeder Nationalratswahl gewissermaßen auch den nächsten Bundespräsidenten mitwählte, das heißt über dieses Amt auf Grund von Kriterien „Vorentscheidungen“ träfe, die damit kaum etwas gemein haben dürften.
Am Ende stünde tatsächlich ein „Parteienstaat“ vor uns, wie ihn die Verfassung wohlweislich nicht im Auge hatte. Da gäbe es, möchte man sagen, eine ganze Menge anderes zu tun, als ausgerechnet die Wahl des Staatsoberhauptes dem Volke aus der Hand zu nehmen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!