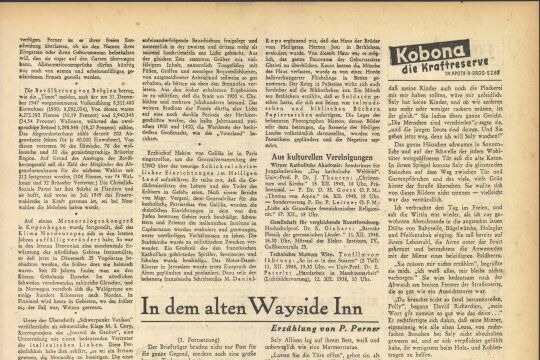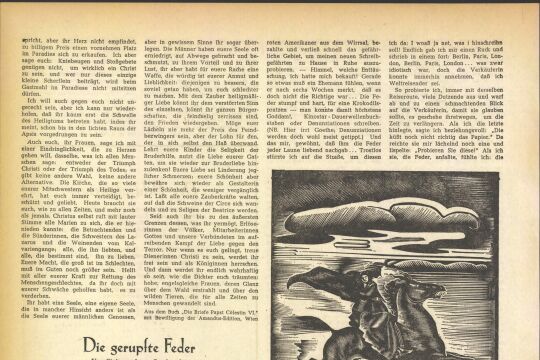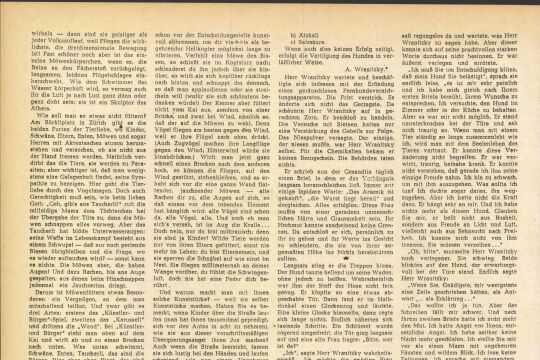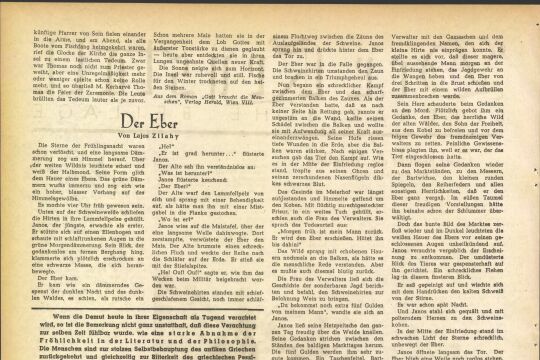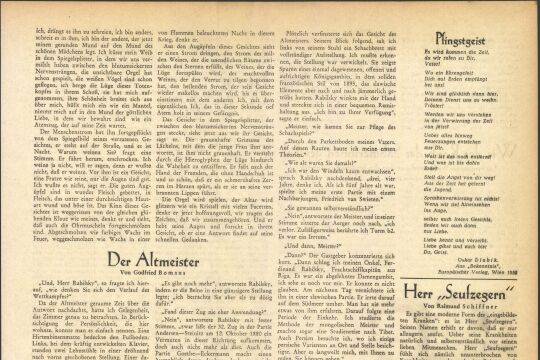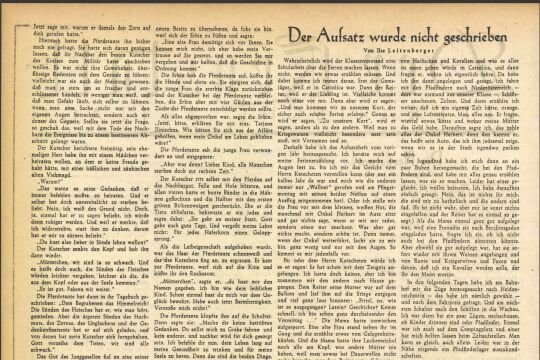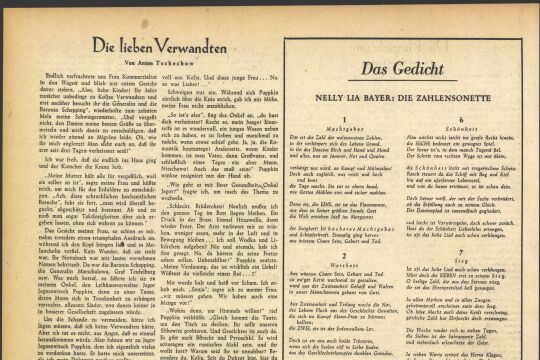So fünf Kilometer vor Prassen, auf offener, schattenloser Landstraße, setzte plötzlich der Motor aus. Michael Taubmann war weder abergläubisch noch technisch gebildet, argwöhnte daher keinen Wink des Schicksals und dachte auch nicht an den Verteilerkontakt. Seine Hände waren noch schwarz und ölig von dem Reifenwechsel an der Autobahnabfahrt, und am liebsten hätte er den Karren, der ohnehin erst zu einem Drittel abgezahlt war, hier am Straßenrand vergessen, mitsamt der dicken Aktentasche aus genarbtem Kunstleder und allem, was darin steckte. Und zugleich alles, was ihm die quicken Herren in den letzten Wochen eingebleut hatten.
Obwohl die Herren einen solchen Fall nicht in Betracht gezogen hatten, fiel Michael nun der Pannendienst ein. Die Nummer mußte in dem Mäppchen mit den Fahrzeugpapieren zu finden sein, im Seitenfach der dicken Aktentasche. Fragte sich nur, wo ein Telephon aufzutreiben war.
Leitungsmasten begleiteten die Straße, und von den Drähten, die sie trugen, zweigte ein Paar nach rechts ab zu einem kleinen Haus,
dem einzigen in Sichtweite mit seinen paar Büschen und Obstbäumen wie auf einer Insel in einem Meer von Weizen und Zuk-kerrüben. Michael nahm die Tasche, sperrte den Wagen ab und ging, um sein Glück zu versuchen.
Es war ein häßliches, rührendes Häuschen, mit viel Liebe und zuwenig Geld gebaut, und natürlich sah man ihm an, daß kein Telephon es mit der großen Welt verband. Es gab ein blankes Messingschild mit der schnörkeligen Aufschrift DEISENHEIMER, aber keine Klingel. Das war auch nicht notwendig, denn drinnen hatte man Michaels Kommen, wie der prompte Erfolg seines Klopfens erwies, schon beobachtet. Frau Deisenheimer hatte ein Geschirrtuch in die linke Ellenbeuge geklemmt, und ihre Hände waren feucht und gerötet.
Nicht daß sie Michael eine derselben gereicht hätte.
„Wir brauchen nichts", sagte sie und versperrte mit ihrer kleinen, rundlichen Figur die Schwelle.
„Ah, d-das freut mich", erwiderte Michael, der an diese Form der Begrüßung noch nicht gewöhnt war. „Aber ich, bitte, täte etwas brauchen."
„So? Was denn?" erkundigte sich Frau Deisenheimer, ohne ihren mißtrauischen Blick von Michaels dicker Aktentasche zu lassen.
„Ein Telephon, bitte", brachte Michael schüchtern hervor.
„Leider", verneinte Frau Deisenheimer, „Telephon haben wir nicht." Und als sie die Enttäuschung auf Michaels Gesicht bemerkte, fügte sie hinzu: „Zu was täten Sie denn ein Telephon brauchen?"
Auf das hin beschrieb ihr Michael sein Mißgeschick mit dem Wagen.
„Telephon haben sie drüben in Reiding, im Wirtshaus", sagte Frau Deisenheimer und deutete in die Richtung, aus der Michael gekommen war. Dann faßte sie Michael scharf ins Auge und rief: „Papa!"
„Ja, Mama?" kam die Antwort aus den Büschen, und dann tauchte ein zerbeulter Strohhut auf und darunter ein kleiner, rundlicher Mann, der Frau Deisenheimer ähnlich wie ein Zwillingsbruder, mit einem unordentlichen Schnurrbart als unterscheidendem Geschlechtsmerkmal.
„Grüß Gott, Herr -", sagte Michael.
„Deisenheimer", ergänzte der Mann. „Was gibt's denn? Wir brauchen nichts."
„Nein, Papa", beruhigte ihn Frau Deisenheimer. „Aber dem Herrn sein Auto steht da unten
auf der Straße, und jetzt sollt' er zum Wachlowski hinüber, daß er die Pannenhilfe anruft. Und weil es heute gar so heiß ist, als daß man zu Fuß gehen möchte, hab' ich mir gedacht, daß du ihm vielleicht dein Rad borgst."
Also holte Herr Deisenheimer sein schweres Fahrrad aus dem Schuppen und Michael aus der Tasche den Mitgliedsausweis, auf dem die Nummer der Pannenhilfe stand, und dann schwang sich Michael auf den knarrenden Sattel und strampelte ab nach Reiding, wo der Gastwirt Wachlowski ein Telephon hatte. Darauf strampelte er zurück zu Herrn und Frau Deisenheimer.
Nach dem sanften, aber deshalb nicht minder mühsamen Anstieg nach Reiding genoß Michael jetzt allerdings hemmungslos das Gefälle und jenes Gefühl der gegenwärtigen Freiheit, wie man es nnur im Sattel eines Fahrrads erfährt, auf den Flügeln des Windes, der einem um die Ohren singt. Michael dachte an Sphärenmusik, denn von Musik verstand er mehr als unsereiner. Das „Grüß Gott! Da bin ich!" mit dem Michael das Gatter aufstieß, klang ehrlich und gut gelaunt.
Na, wie war's?" erkundigte sich Herr Deisenheimer. „Ein braves Rad", lobte Michael und übergab es seinem Herrn. „Aber auf die Pannenhilfe muß ich drei, vier Stunden warten."
„Vom Salat war' noch was übrig", meinte Frau Deisenheimer. „Und ein paar Nudeln auch — nicht wahr, Papa?"
Herr Deisenheimer nickte. „Ein Bier dazu werden Sie sicher nicht ablehnen, Herr —"
„Taubmann", ergänzte Michael. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel: Ich bin ein Vertreter."
„Jeder tut, was er kann", verzieh ihm Herr Deisenheimer.
„Für einen Vertreter hätte ich Sie nicht gehalten", behauptete Frau Deisenheimer. „Was vertreten Sie denn?"
„Waschmaschinen", gestand Michael beschämt.
„Oh", nahm Frau Deisenheimer unverbindlich zur Kenntnis. „Also da werden wir zum Kaffee hinübergehen..."
Drüben war alles genauso zu erwarten gewesen, vom Ma-schinknüpfer über die Garnitur bis zu dem Original-Ölgemälde mit dem daherstampfenden Wildpferdrudel, möglicherweise ein Abschiedsgeschenk von Herrn Deisenheimers Bürokollegen, auch das gute Porzellan von der Großmutter und die Erinnerungsstücke in der Vitrine, eine silberne Taschenuhr und einige Glastiere aus Murano. Und selbstverständlich der Fernsehapparat. Demselben jedoch als Untersatz oder Postament diente, exotisch, schwarz und monströs, wie ein kubistischer Tapir, der einen kleinen Maharadscha trägt: ein Stutzflügel.
„Bitte, nehmen Sie Platz, Herr Taubmann", forderte ihn Frau Deisenheimer auf und stellte das Tablett mit dem Mokkazubehör auf der falschen Onyxplatte ab.
„Ach", seufzte Michael, der immer nur auf gemieteten Instrumenten geübt hatte. „Sie haben einen Flügel!"
„Ja", bestätigte Frau Deisenheimer verlegen und stolz.
„Nimmt viel Platz weg", brummte Herr Deisenheimer. „Aber meine Frau hängt dran." „Spielen Sie?" fragte Michael. „Früher einmal habe ich gesungen", verneinte Frau Deisenhei-
mer. „Ich war bei der ersten Stimme im Chor von Sankt Florian auf der Wieden, bevor sie's abgerissen haben. Und an die neue Kirche liabe ich mich nicht mehr gewöhnen können. Sie haben offen gesagt, daß das etwas für die Jungen sein soll. Die sind dann auch nicht hineingegangen, aber wir Alten haben es trotzdem verstanden, wie's gemeint war ... Nein: Klavier gespielt habe ich nie. Das ist, wenn Sie wollen, ein Andenken an eine Tante von mir, einen sehr lieben Menschen. Die war Lehrerin und hochmusikalisch. Im dritten Bezirk hat sie gewohnt, und nach ihrer Pensionierung ist sie hinaus nach Hietzing gezogen. Dort hat sie dann nicht mehi spielen dürfen, wegen der Nachbarn, weil das so ein Neubau war mit lauter Eigentumswohnungen. Aber das Klavier hat sie nicht hergeben wollen, das hätte sie nicht übers Herz gebracht —"
Frau Deisenheimer saß da wie die Köhlersfrau in einem ungeschriebenen Märchen, die einem hereingewehten Strauchritter eröffnet, daß sie eigentlich eine Prinzessin sei, verwunschen, enterbt, aus ihrem Land vertrieben oder sonst ins Unglück geraten, und Herr Deisenheimer, der ihr so ähnlich sah, rührte gesenkten Blicks in seinem Kaffee, weil er versäumt hatte, sich als Prinz zu erweisen, sondern eben ein Köhler war, und diese Ähnlichkeit, die ihn mit ihr verband, nur eine Laune der Natur und ein Irrtum.
„Früher, wie wir das Fernsehen noch nicht gehabt haben, ist eine Beethovenbüste drauf-gestanden", erzählte Frau Deisenheimer. Früher war auch sie noch mehr einer Prinzessin als Herrn Deisenheimer ähnlich gewesen. „Aber mein Mann hat ihn nie leiden können, weil er ihm zu grantig dreingeschaut hat, der Beethoven."
„Geh, Mama", wehrte sich Herr Deisenheimer. „Wahr ist nur, daß wir
das Zimmer erst richtig benützen, seit der Fernseher statt dem Beethoven auf dem Klavier steht."
„Darf ich es vielleicht einmal ausprobieren?" bat Michael.
„Oh, Sie können...?" rief Frau Deisenheimer.
„Ich habe ziemlich lange gelernt", untertrieb Michael.
„Aber es ist sicher sehr verstimmt", warnte ihn Frau Deisenheimer.
„Macht nichts", absolvierte Michael sie von der Sünde mangelnder Obsorge. „Mein Lehrer hat immer gesagt, ein guter Pianist muß auch auf schlechten Klavieren so spielen können, daß die Leute nicht davonlaufen."
„Und die Tasten werden nicht abgestaubt sein", bemühte sich Frau Deisenheimer, eine dumpf vorausgeahnte Katastrophe aufzuhalten.
„Wenn das alles ist", ging Michael darüber hinweg.
„Soll ich vielleicht den Fernseher ...?" erbot sich Herr Deisenheimer.
„Ja, das hört sich bestimmt besser an", gewährte ihm Michael.
Als Herr Deisenheimer den Fernsehapparat auf die Anrichte übersiedelt hatte, klappte Michael den Deckel zurück, der über den Tasten lag, und klimperte den Bestand durch. Frau Deisenheimers Vermutungen trafen zu: die Tasten waren staubig, die
Saiten verstimmt. Michaels Ohren sträubten sich, aber nach einem Blick auf die beiden Alten wußte er, daß er nun nicht mehr zurück konnte. Schon das schrille, aber immerhin geläufige Eilen durch verschiedene Tonleitern hatte Frau Deisenheimer in einen Zustand gieriger Verzückung entrückt, während Herrn Deisenheimers Mund unter dem unordentlichen Schnurrbart offenstand vor bassem Staunen über Michaels Fingerfertigkeit.
Das Potpourri, das Michael zum besten gab, war ein einigermaßen seltsames Gebräu aus beliebten und bekannten Kompositionen der Klassik und Romantik, wobei Michaels Ehrgeiz, wenigstens die ärgsten Mißtöne und Dissonanzen zu vermeiden, den manchmal sehr abrupten Ubergang von einem Stück zum nächsten bestimmte.
So überraschend das Erlebnis war, es reichte doch nicht tief genug, um die Kraft einer wahren Offenbarung zu entfalten und Michael dauerhaft zu verwandeln. Jedenfalls war, was bei Michael geschah, nicht zu vergleichen mit der Wirkung auf das Ehepaar Deisenheimer. Die beiden saßen wie gelähmt auf der Couchbank, und nur ihre Lider, die ab und zu heftig zwinkerten, unterschieden sie von irgendwelchen Wachsfiguren, während sich in ihrem Inneren einschneidende Konvulsionen ereigneten. Herr Deisenheimer begriff zum ersten Mal, daß seine Gattin den Flügel nicht nur als Beweisstück für ihre Herkunft aus Kreisen verteidigt hatte, deren fürwitzige Störung sie ihm täglich neu vergeben mußte, und natürlich auch nicht aus Pietät gegenüber der Tante, sondern wegen all dem Wunderbaren und Großartigen, das darin zumindest als Möglichkeit steckte.
Michael war der erste, der aus dem entrückten Zustand erwachte. Sein Blick fiel aus dem Fenster. „Ah, da ist er!" rief er. „Wer?" fragte Herr Deisenheimer.
„Der Wagen von der Pannenhilfe."
Und Michael enteilte.
Natürlich kam er wieder. Er war ein höflicher Mensch und wollte sich bedanken.
„Bitte, Herr Taubmann", begann Frau Deisenheimer. „Wir hätten noch etwas —" Dann versagte ihre Stimme.
„Es ist wegen einer Waschmaschine", setzte Herr Deisenheimer fort.
„Sie brauchen eine Waschmaschine?" erkundigte sich Michael verblüfft.
„Brauchen ist zuviel gesagt", meinte Herr Deisenheimer. „Aber wir haben gefunden, daß wir mit einer Waschmaschine doch mehr anfangen können als mit einem Klavier. In Prassen drüben haben sie ein Kulturhaus gebaut, und ich weiß, daß sie jetzt einen Flügel suchen. Wenn Sie mit mir zum Bürgermeister gehen... Glauben Sie, daß es für eine Waschmaschine reichen wird?"
„Ganz bestimmt", versicherte ■ Michael. „Da bleibt noch etwas übrig. Wenn Sie wollen, können wir auch über eine Tiefkühltruhe reden."
„Ich weiß nicht...", zweifelte Herr Deisenheimer. „Aber, Papa", half ihm Frau Deisenheimer. „Wo du dir schon immer eine Tiefkühltruhe gewünscht hast!"
Das war der erste Auftrag, den Michael heimbrachte, und wenn die Firma nicht eingegangen ist, vertritt er sie noch heute.