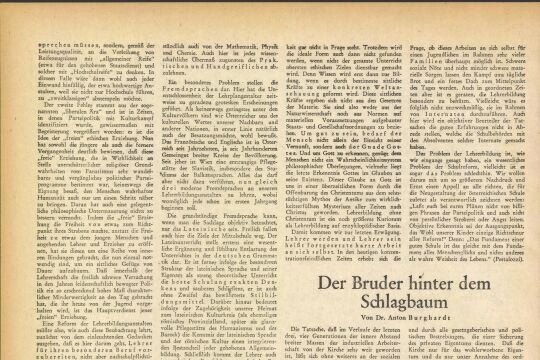Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Probleme des Gestern verstellen die Sicht
Folgt man der gesellschaftspolitischen Debatte der Gegenwart, so sind die sozialen Probleme von heute eine Extrapolation der sozialen Probleme von gestern, die im Kern Probleme des wirtschaftlichen Wohlergehens, der sozialen Sicherheit und der politischen Emanzipation der Industriearbeiterschaft waren. Deren Solidarität, Disziplin und Kampfbereitschaft haben trotz aller widrigen politischen Ereignisse in nur einem Jahrhundert dazu geführt, daß die Realeinkommen mächtiger als je in der Geschichte gestiegen sind, daß umfassende Systeme sozialer Sicherheit geschaffen wurden, die gegen wirtschaftliche Wechselfälle im großen wie im kleinen schützen.
Und trotz dieses durchschlagenden Erfolges werden gerade von diesen Organisationen politische Forderungen für die Zukunft erhoben, die eine direkte Fortsetzung
des bereits ein Jahrhundert währenden Bemühens sind, geradeso als ob sich die gesellschaftliche Situation allenfalls graduell geändert hatte.
Nun bedarf es freilich keiner tiefschürfenden Analyse, um zu sehen, daß die Sicherung der Arbeitsplätze ebenso wie die Sicherung einer ausreichenden Krankenversorung oder der Anpassung der Renten an den steigenden Lebensstandard der im Arbeitsleben stehenden Mitbürger nach einer Zeit scheinbarer Stabilität erneut und tiefgreifend gefährdet sind.
Anderseits zeigt aber auch ein nur flüchtiger Bück in die Massenmedien Beispiele für schreiende Armut inmitten des Überflusses und der relativen Sicherheit der breiten Massen ebenso wie Beispiele ge-nüßlichen (wenn auch nicht ungesetzlichen) Mißbrauches der Sozialfürsorge oder systemimmanenter Kumulation von Leistungen, die das Arbeitseinkommen übersteigen. Bei genauerer Analyse dieser Phänomene erkennt man, daß sie das Ergebnis einer linearen Fortschreibung früherer Initiativen darstellen, die nicht auf die gewandelten gesellschaftlichen Bedürfnisse der Gegenwart eingeht.
Dies hat auch zur Folge, daß die Maßnahmen zur Sanierung des Systems sozialer Sicherheit immer nur einen kurzen Aufschub bringen. Die Gefährdung der Versorgung mit Leistungen der Sozialversicherung schlägt sich zunächst in einem Finanzierungsdefizit nieder und wird demzufolge auch immer als Finanzierungsproblem behandelt. Siehe: Spitalsdiskussion.
Weil nun diejenigen, die Krankenhausleistungen in Anspruch nehmen, für diese selten direkt zahlen, sondern über Sozialversicherungsbeiträge oder Steuern bereits pauschaliert vorweg bezahlen, fehlt ein direkter Indikator für die Dringlichkeit des Bedarfs (dieser wird real und im Einzelfall vielmehr von Medizinern festgestellt, deren Einkommen unmittelbar an die Höhe des von ihnen festgestellten Bedarfs geknüpft ist). Der direkte Indikator, der in der Wahl einer ein bestimmtes Versorgungsprogramm vertretenden politischen Partei bestehen könnte, muß aber versagen, weil die Programme immer nur die zusätzliche Leistung für den Wähler anführen, nie aber den Verzicht, den die gleichen Wähler auf sich nehmen müssen.
Dieser Verzicht wird im politischen Wettbewerb zumeist absichtlich verschwiegen. Und schließlich zeitigt diese Entwicklung einen Umschlag von der Quantität in die Qualität: Aus einer aus dem Gedanken der Subsidiarität geborenen Entwicklung wird sukzessive durch ständige Expansion ein allumfassendes System der kollektiven Umverteilung und letztendlich der kollektiven Steuerung überhaupt.
Ein anderer Aspekt dieser schleichenden Umwertung zeigt sich an der Vollbeschäftigungspolitik. In der ersten Phase des Aufbaus der Systeme sozialer Sicherheit hatte man sich darauf beschränkt, nur das Einkommensrisiko einer Entlassung versicherungstechnisch abzudecken. Erst in den dreißiger und vierziger Jahren kam es zur propagierten Übernahme auch des Beschäftigungsrisikos durch die öffentliche Hand in der Form der Vollbeschäftigungspolitik.
Weitere Intensivierung kollektiver Regelungen und Interventionen in diesem Bereich hat daher zunehmend gesellschaftspolitische und abnehmend sozialpolitische Bedeutung. Dies gilt um so mehr, als gestiegener Wohlstand, verbesserte Ausbildung und umfassende Sozialsysteme für die meisten Menschen
unserer Gesellschaft und jedenfalls für die zahlenstarken Gruppen die Notwendigkeit weiterer gesellschaftlicher Solidarunterstützung überflüssig machen.
Die „neue“ Frage kann also nicht die Industriearbeiterschaft insgesamt oder ähnlich große und starke soziale Gruppen allgemein betreffen. Sie liegt ganz woanders: sie liegt bei den sozialen Randgruppen (z. B. den „Asozialen“), sie liegt bei den Menschen, die aus besonderen Bedingungen oder Lebensumständen die Anspruchskriterien für Sozialleistungen nicht erfüllen (z. B. bei den Berufsanfängern); sie liegt bei den Extremrisiken (z. B. jungen, elternlosen, an multipler Skerlose erkrankten Menschen, alten alleinstehenden Menschen, Contergan-Kindern) und bei den unverschuldet Leistungsunfähigen (z. B. Sonderschulabsolventen).
Die neue soziale Frage ist also eine uralte, die uns nur durch eine falsche Perspektive und liebe Gewohnheit ganz aus dem Blickfeld geraten ist: sie betriff den einzelnen und sein Einzelschicksal und nicht mehr ganze Gruppen und Klassen.
Wir aber treiben Politik für Gruppen und Klassen und nicht für einzelne. Das hat zwei Ursachen. Die erste liegt im Demokratieprinzip, das den Mehrheiten vor den Minderheiten das Sagen einräumt. Aber damit setzen sich nur die ökonomischen Ansprüche von zahlenstarken Wählergruppen oder Industriebereichen gesellschaftlich durch, während zahlenmäßig kleine Gruppen ebenso wie nicht-organisierbare einzelne wegen des Fehlens einer machtvollen Repräsentanz im politischen und. gesellschaftlichen Machtkampf hintan bleiben.
Ein zweiter Grund liegt in der Rechtsstaatlichkeit unserer Gesellschaftsodnung, die das Tätigwerden von Behörden an Gesetze mit möglichst engem (oder gar keinem) Ermessungsspielraum bindet. Diese sind notwendigerweise generell formuliert und treffen damit wiederum nur den häufig beobachtbaren Allgemeinfall, die Majorität, und nicht die Einzelfälle, die „durch die Maschen der Gesetze“ fallen.
Was wir also brauchen, ist eine Lobby der Minderheiten und Einzelfälle, die diese Aufgabe aus sozialer Verantwortung übernimmt, denn Macht aus Mehrheit kann sie definitionsgemäß daraus nicht gewinnen. Was wir brauchen, ist ein Einsehen der von der bisherigen Entwicklung begünstigten Großgruppen, daß sie von ihren erkämpften Privilegien etwas abzugeben haben für die Stiefkinder der Gesellschaft. Und was wir schließlich auch noch brauchen, ist eine soziale Gesetzgebung, die gestattet, auf den Einzelfall einzugehen, so daß diesem Gerechtigkeit widerfährt, ohne daß dadurch einer Beamtenwillkür Tür und Tor geöffnet wird.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!