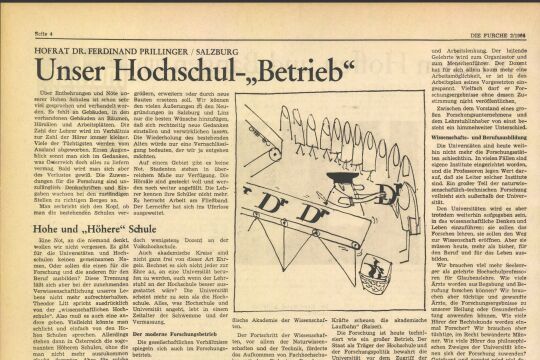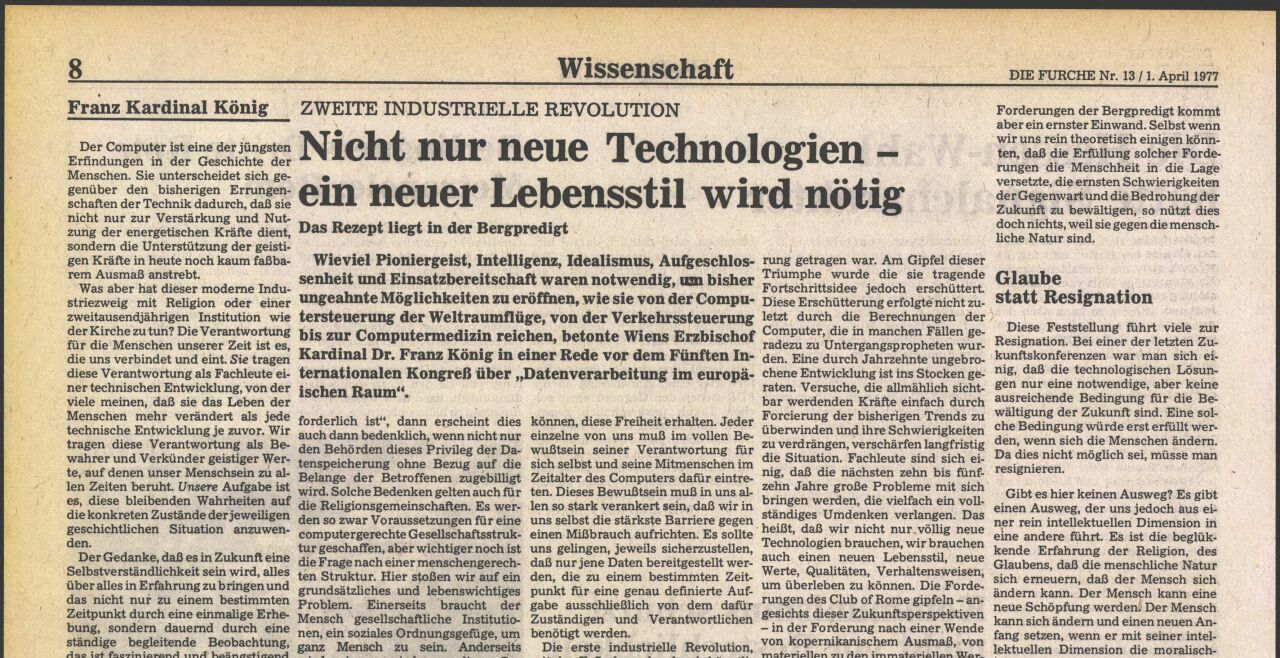
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Reform wurde von der Reform erschlagen
Werden wir in zehn Jahren zu viele Akademiker besitzen? Oder muß die Frage lauten: Werden die Hochschulabsolventen von morgen den Anforderungen genügen können, die «Wirtschaft und Gesellschaft an sie stellen müssen? Die Studienreform, die vor mehr als zehn Jahren eingeleitet wurde, sollte Vorsorgen, daß diese Frage mit Ja beantwortet werden könnte. Die Entwicklung seither hat leider nicht dazu beigetragen, dieses Ziel zu erreichen.
Die Reform von 1966, heute gerne kritisiert, war eine historische Tat. Trotz der damals bereits amtierenden ÖVP-Alleinregierung von Anfang an von einem ad personam einberufenen Beirat auf Konsens konzipiert - obwohl Hochschulgesetze nicht wie die Schulgesetze an eine Zweidrittelmehrheit gebunden sind -, konnte dieser Konsens auch seither über alle Regierungen hinweg erhalten werden. Die Vorwegnahme-der Studienreform vor der Strukturreform beseitigte etliche jener Steine des Anstoßes, die anderswo zur Explosion Anlaß gaben.
Was aber ist seither aus der Reform geworden? Warum bereitet sie nun erneut Unbehagen? Der Generalsekretär der österreichischen Rektorenkonferenz, Dr. Raoul Kneucker, skizzierte Gründe und Hintergründe kürzlich vor Wissenschaftern und Politikern.
Die Reform von 1966 sollte die Rechtssicherheit herstellen, den Studenten einen ordnungsgemäßen Ablauf ihres Studiums anbieten und eine Bilanz der Curricula ziehen. Gleichzeitig mit dem Allgemeinen Hochschulstudiengesetz, das die Grundsatzbestimmungen für alle Studien an den wissenschaftlichen Hochschulen festlegte, erschien auch das Studiengesetz für die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Seither haben fast alle Studienbereiche ihre speziellen Vorschriften erhalten, nur die evangelischen Theologen, die Juristen und die Kunststudenten stehen noch aus.
Was aber noch lange nicht komplett ist, sind die auf diesen Studiengesetzen aufbauenden Studienordnungen, Verordnungen des Wissenschaftsmi nisteriums, die gemeinsam mit den Studienkommissionen der Universitäten zu erarbeiten sind und die viel länger auf sich warten lassen als die Gesetze selbst, die den üblichen Weg gesetzlicher Festlegungen - Ministerial- entwurf, Begutachtungsverfahren, Regierungsentwurf, Parlamentsausschuß, Parlamentsplenum - gehen müssen. So fehlen nach wie vor die Studienordnungen für die Mediziner, die seit bald vier Jahren ihr Gesetz haben.
Und daneben wird der Vorwurf laut, die Reform habe zur „Verschulung“ geführt. Aber in diesem Fall ist nicht die Reform schuld, sondern die Entwicklung seither. Vor allem durch eines: Die seither in Angriff genommene Strukturreform der Universität durch das Universitätsorganisationsgesetz überfordert die Verwaltungsbehörden derart, daß auch bei bestem Willen der vorgesehene Zeitablauf der Studienreform nicht einzuhalten war.
Das Allgemeine Hochschulstudiengesetz postulierte als Aufgaben der Hochschulstudien auch die wissenschaftliche Berufsvorbildung und die Bildung durch Wissenschaft Die „Bildung durch Wissenschaft“ ist solange in Frage gestellt, als die Massenuniversität darauf angesetzt ist, Massen von Hörem durchzuschleusen, um sie für ihre Berufstätigkeit vorzubilden und damit dem faustischen Streben nach der Wahrheit kaum Raum gegeben werden kann.
Wie aber sollte es besser gemacht werden? Was müßte eine zweite Phase der Studienreform bringen, die Minister Hertha Fimberg kürzlich in Aussicht gestellt hat?
Kneucker stellte vor allem drei Aufgaben in den Vordergrund: Zunächst müßte schon die Eingangsphase umgestaltet werden. Der Maturant von heute bringt in viel geringerem Maß die Studierfähigkeit mit, die seinem Vorgänger noch vor zwanzig Jahren meist mitgegeben war. Die Schulreform, die Zuerkennung der Hochschulreife an alle Arten von Matura hat bewirkt, daß für viele Studienfächer die Vorbildung aus der höheren Schule nicht mehr vorausgesetzt wer-
den kann, die früher selbstverständlich war. Das muß Folgen für die Curricula an der Universität haben.
Dann müßte das Prüfungswesen neu überdacht werden, das übrigens heute keineswegs die Form aufweist, wie das AHStG sie vorgesehen hat Schließlich müßten die Curricula selbst erneuert werden - und hier steht die Scheu im Weg, an die Grundsätze vorzustoßen, etwa auf den zunehmenden Relevanzverlust der Hochschulstudien für die Berufsaus- büdung.
Wie soll es aber gelingen, an der Universitätjemanden für einen Beruf auszubilden angesichts der wachsenden Differenzierung innerhalb der Wissenschaften selbst, wie in den Berufs- büdem, zu denen das Studium hinführen soll? Je spezialisierter die Fächer werden, je weiter sich auch die akademischen Berufe auseinanderentwickeln, desto schwerer wird es, sich auf der Universität das nötige Rüstzeug zu holen. Noch dazu, da die Hochschullehrer selbst immer weniger eigene Tätigkeit in der Praxis ihres Faches aufweisen.
Der „Wissensumsatz“ wird heute in den meisten naturwissenschaftlichen Disziplinen mit zehn Jahren bemessen. Wenn der Student nach dem Abschluß in die Praxis eintritt, ist vielfach überholt, was er am Beginn seiner Hochschulzeit aufgenommen hat. Wo liegt die Alternative? In einem „Re- current“-System, von dem heute viel gesprochen wird? Sicherlich wird sich dieses Problem nicht von den Universitäten allein lösen lassen.
In der Diskussion ergänzte Forschungsfondspräsident Hans Tuppy: Der geregelte Übergang von der Berufsvorbildung des Diplomstudiums einerseits in die Wissenschaft, anderseits in die „Außenwirklichkeit“ müßte sichergestellt werden. Dazu sollte dem Studenten diese Umwelt von morgen schon vor dem Eintritt ins Studium bewußtgemacht werden, etwa als Krankenpflegedienst für die Mediziner, als Erzieherdienst für die Lehrer von morgen. Das könnte manche Illusion rechtzeitig abbauen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!