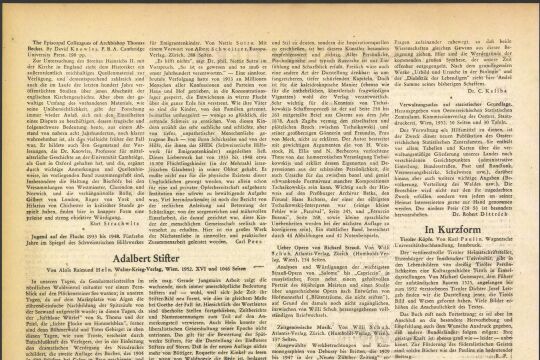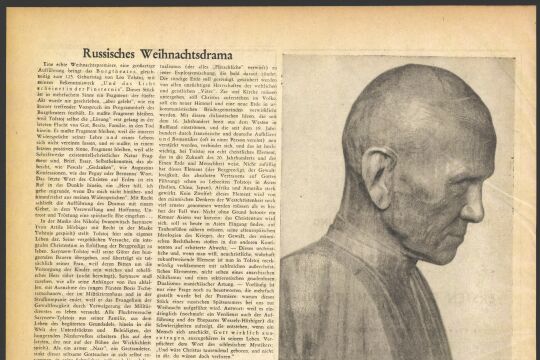Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Zukunft der Oper
Nicht daß sie tot wäre, unsere liebe alte gute Oper. Allabendlich lockt dieses Luxusgeschöpf in aller Welt Zehntausende in seine rotgoldenen Räume, wo schöne Stimmen und schöne Weisen immer noch Triumphe feiern. Und die allermeisten, drei Viertel oder neun Zehntel ihrer Besucher, sind damit nicht nur zufrieden, sondern auch glücklich. Aber als Komponente der zeitgenössischen Kunst hat sich die Oper fast ganz ausgeschaltet. Oder: sie wurde von den Direktoren eliminiert. — Dabei bleiben zweierlei „Spezialfälle“ außer Betracht: jene Werke, die mit Routine sich der konventionellen Tonsprache bedienen und meist mittels eines wertvollen literarischen Sujets (Dramas) auch gut über die Rampe kommen und sich oft jahrelang auf diversen Spielplänen halten. Und zweitens: jene von vorneherein als Experiment gedachten musikdramatischen, halbszenischen Produkte, zuweilen als „Multimedia“ bezeichnet, von denen die meisten ihre Premiere nicht überleben. (Schönberg zum Beispiel hat nicht einmal an die Aufführbarkeit von „Moses und Aron“ geglaubt, geschweige denn an ein Weiterleben auf der Opernbühne.) Krenek schuf mit seinem „Karl V.“ einen streng dodekaphonischen Bilderbogen, von Hindemiths „Mathis“ und seiner „Harmonie der Welt“ ist alles Wesentliche in den Orchestersuiten enthalten usw. — Beispiele für die erstgenannte Kategorie brauchen wir wohl nicht extra zu nennen, sie reichen von Einems „Besuch der alten Dame“ bis zum „Jungen Lord“ von Henze. , .
Die die Regel bestätigenden Ausnahmen stammen von, Alban Berg, dessen „Wozzeck“ vor 50 Jahren uraufgeführt wurde, die Komposition der „Lulu“ ist 1925 durch den Tod des Komponisten unterbrochen worden, das Werk wurde erst 1937 in Zürich uraufgeführt. Danach kam, wie Brecht zu sagen pflegte „nichts Nennenswertes“. Bis zu „Die Soldaten“ des Rheinländers Bernd Alois Zimmermann: eine tragische Figur als Mensch, und als Künstler, wie sein Textautor Jakob Michael Reinhold Lenz, der genialste der „Stürmer und Dränger“, 1751 in Livland geboren, 40jährig in der Nähe; von Moskau gestorben. (Zimmermann endete 1970, erst 48 Jähre alt, durch Selbstmord.)
Mit Alban Berg, als dessen einzigen legitimen Nachfolger und Fortsetzer wir Zimmermann betrachten, verbinden ihn vielerlei Affinitäten. — Da ist zunächst der Text: das Drama von Lenz, dessen Pathogra-phie Georg Büchner, der Autor des „Woyzeck“, geschrieben hat, die passiven Helden Woyzeck, Lulu, Marie (Marie heißt auch das Opfer in den „Soldaten“); der gesellschaftskritische Hintergrund, das „Milieu“; vor allem aber die Pranke des geborenen Dramatikers.
Was die szenische Realisierung sowie die Ansprüche an alle Ausführenden betrifft, erscheinen Alban Bergs Opern neben den „Soldaten“, geradezu bescheiden. Aber damals, 1925, waren sie es nicht. Denn „Die Soldaten“, den kühnen dramaturgischen Vorstellungen von Lenz entsprechend („Anmerkungen übers Theater“ von 1774), spielen das Stück und die Oper von Zimmermann auf mehreren Ebenen einer Simultanbühne. Auch zeitlich wird, etwa der Technik von James Joyce entsprechend, vor- und zurückgeblendet. Dem Bühnengeschehen entspricht auch der „pluralistische“ Klang: ste-reophonische Wirkungen von Sprache, Gesang und Instrumentalfarben, die Collagetechnik der Stile von Gregorianik und Bach-ähnlichem Choral bis zu gewaltigen Klangclu-stern und Jazzelementen — sowie Solopartien von kaum vorstellbarer, aber durchaus zu meisternder Schwierigkeit.
Zimmermanns erster Entwurf, 1958 bis 1960 als Auftragsarbeit der Kölner Oper geschrieben, wurde als „unaufführbar“ abgewiesen. Aber das gleiche Opernhaus, unter einer anderen Intendanz, brachte 1965 mit sensationellem Erfolg die Uraufführung der Neufassung. Es folgten Inszenierungen in Düsseldorf, Hamburg, Kassel, Nürnberg und München. Gastspiele deutscher Ensembles gab es inzwischen in Den Haag, Schweningen, Stockholm, Edinburgh, Warschau und Zagreb. — In Österreich wagte noch niemand die szenische Realisierung. Ein 40 Minuten dauerndes Fragment, das aber einen sehr suggestiven Eindruck vermittelt, hörten wir in der Salzburger Felsenreitschule mit dem ORF-Symphonieorchester unter der souveränen und temperamentvollen Leitung von Leif Segrerstam. — Die hervorragenden Vokalsolisten, die es fertigbrachten, das Podium des Großen Musikvereinssaales am vergangenen Freitag in eine Bühne zu verwandeln, waren Anton de Ridder als Desportes, Peter Christoph Runge — Stolzius, Marius Rintzler m Wesener, Edith Gabry — Marie sowie Ingrid Mayer und Eileen Broadie. Die — wie bei Berg — geschlossenen Formen (Preludio, Introduzione zum 1. Akt, Nocturno, Capriccio, Corale, Ciacona und Nocturno II) erleichtern die Aufnahme dieser genialen zuweilen chaotisch klingenden Musik. — Diese Oper wenigstens als Gastspiel nach Wien zu bringen, ist eine Aufgabe, die wichtiger wäre und weniger kosten würde als die Neuinszenierung der „Meistersinger“. (Über das den 1. Teil des Jeunesse-Konzerts bildende Werk „Facetten“ von Blom-dahl ein andermal.)
Helmut A. Fiechtner
EXLIBRIS
Am kommenden Samstag, dem 15. November, werden in ö 1 von 16.05 bis 17 Uhr folgende Bücher besprochen: Friederike Hübner: Knoblauch, Kunst und Kindheit in Prag; Herbert Lederer: Kindheit in Favoriten; Alexander Lernet-Holenia: Der Mann im Hut; Herbert Ihering: Der Kampf ums Theater und andere Streitschriften; Hans Henny Jahnn — Peter Hüchel: Ein Briefwechsel; Courtade Cadars: Geschichte des Films im Dritten Reich; Schlag nach — Die Staaten der Erde, herausgegeben vom Geographisch-Kartho-graphischen Institut Meyer; Robert Ederer: Monographie; Richard Wagner — Sein Leben, sein Werk und seine Welt in zeitgenössischen Bildern und Texten, herausgegeben von Herberth Barth, Dietrich Mack und Egon Voss; Eric Ambler: Doktor Fri-go; Ross McDonald: Dornröschen war ein schönes Kind. Änderungen vorbehalten. (Leiter der Sendung: Prof. Dr. Ernst Schönwiese und Dr. Volkmar Parschalk.)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!