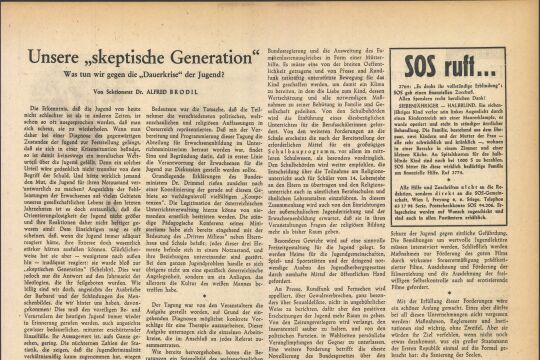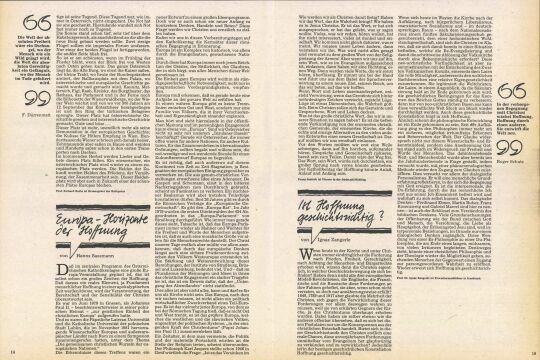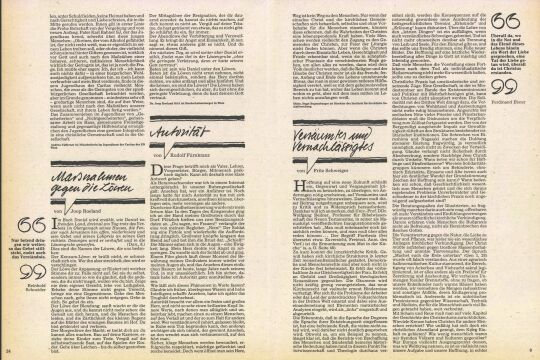Moria: Wo ist hier "Compassion"?
Ludger Schwienhorst-Schönberger meinte vorige Woche an dieser Stelle, dass Christen im Fall von Moria zu unterschiedlichen Antworten kommen könnten. Eine Replik von Franz Gmainer-Pranzl.
Ludger Schwienhorst-Schönberger meinte vorige Woche an dieser Stelle, dass Christen im Fall von Moria zu unterschiedlichen Antworten kommen könnten. Eine Replik von Franz Gmainer-Pranzl.
In der Auseinandersetzung mit drängenden globalen Herausforderungen bezeichnete der katholische Theologe Johann Baptist Metz (1928–2018) in seinem Buch „Memoria passionis“ (2006) Compassion als „Schlüsselwort für das Weltprogramm des Christentums im Zeitalter der Globalisierung“. Damit meinte er nicht nur „Mitgefühl“, sondern „Mitleidenschaft, als teilnehmende, als verpflichtende Wahrnehmung fremden Leids“. Christlicher Glaube, der keine Leidempfindlichkeit aufweise, so Metz, verkomme zur „bürgerlichen Religion“ – im Sinn einer Feiertagsdekoration, die bestenfalls belanglose Rituale aufführt, ohne eine kritisch-verändernde Kraft aufzuweisen – und schlimmstenfalls zur Komplizin der herrschenden Politik. An der Praxis von „Compassion“ zeige sich, ob „Widerstand gegen die Selbstprivatisierung des Christentums in unseren pluralistischen Verhältnissen“ möglich sei, und ob das „Gedächtnis des Leidens“, das liturgisch gefeiert wird, auch zu einer verändernden Praxis führt.
Bagatellisierung und Denunzierung
Diese Kernthese „anamnetischer Theologie“ (d.h. einer am Gedächtnis fremden Leids orientierten Glaubensverantwortung) wurde mir erneut bewusst, als ich den Beitrag von Ludger Schwienhorst-Schönberger las. Diese Stellungnahme zu den Überlegungen über (christliche) Gewissensbildung von Maria Katharina Moser ist von Bagatellisierung, Denunzierung und Kulturalisierung geprägt: von Bagatellisierung, insofern die altbekannte Tatsache, dass wir einer Flut von Nachrichten und Informationen ausgesetzt sind, zu einer Schlüsselerkenntnis hochstilisiert wird – damit aber subtil die entsetzliche Situation der Menschen im Flüchtlingslager Moria als „eine Nachricht unter vielen“ abgetan wird; von Denunzierung ernsthafter Bemühungen um Solidarität, insofern Initiativen zu Refugees welcome im Sommer/Herbst 2015 einem „vernunftgeleiteten Diskurs“ gegenübergestellt werden, als ob die spontane, oft aus Not und Zeitdruck heraus improvisierte Hilfe nicht zuletzt vieler junger Menschen nicht „vernünftig“ gewesen wäre; sowie von einer Kulturalisierung sozialer Konflikte, die angesichts der Herausforderung von Flucht, Gewalt und Hunger mit Kategorien des „Nationalen“ bzw. „kultureller Identität“ operiert – womit das Szenario einer Bedrohung durch „kulturell Fremde“ aufgebaut wird, anstatt konkret zu fragen, wie leidenden Menschen geholfen werden kann.
Schließlich ist der Verweis auf die „Autonomie der irdischen Wirklichkeiten“ (Gaudium et spes 36) sowie auf die Unmöglichkeit, aus einer christlichen Glaubenshaltung immer eindeutige Lösungen abzuleiten, zwar richtig, aber mit Blick auf die Situation von Flüchtlingen wenig aussagekräftig. Gewiss braucht es eine Reflexion größerer Problemzusammenhänge und nicht nur spontane Aktionen – aber ohne beherzte und konkrete Hilfe kommt jede Reflexion zu spät, wie wir aus vielen Krisen- und Katastrophenszenarien eigentlich schon längst wissen. Anstatt darüber zu diskutieren, ob eine Überführung von Flüchtlingen nach Österreich „die einzig mögliche“ Option sei, bräuchte es eine engagierte Option für Menschen, die unter derart katastrophalen Bedingungen leben müssen. Der Position von Ludger Schwienhorst-Schönberger – „dass Hilfe vor Ort weniger christlich sei, leuchtet mir nicht ein“ – muss ich entgegenhalten: „Dass es in Österreich im Jahr 2020 nicht möglich ist, Kinder und Jugendliche aus dem Flüchtlingslager Moria hierher zu holen, leuchtet mir nicht ein.“
Am meisten aber bedauere ich, dass dieser Text bei allen Abwägungen, Differenzierungen und Zitaten an keiner Stelle etwas von dem signalisiert, was Johann Baptist Metz Compassion nannte: die Bestürzung über Not und Elend von Menschen, die leidenschaftliche Option für die Armen sowie politische und intellektuelle Kreativität im Bemühen um eine Lösung. Statt einer Vision wie „Eine andere Welt ist möglich“ nehme ich die Botschaft wahr: „Kann man halt nichts machen.“ Wenn ich hier etwa den Aufruf von Papst Johannes Paul II. lese: „Wenn man ‚Europa‘ sagt, soll das ‚Öffnung’ heißen“, und weiter: „Europa kann sich nicht auf sich selbst zurückziehen. Es kann und darf nicht völliges Desinteresse für den Rest der Welt zeigen“ (Ecclesia in Europa, Nr. 111), dann finde ich das ungleich mutiger und ermutigender.
Management epochaler Unterlassung
Doch ich möchte noch ein mutmaßliches Anliegen des Autors – die Suche nach Zusammenhängen und Grundlagen für konkrete Problemlösungsstrategien – aufgreifen und damit auch eine These zur Migrationspolitik insgesamt formulieren: Diskussionen, ob ein Land in einer Krisensituation Flüchtlinge aufnehmen soll oder nicht, kommen insofern zu spät, als nur mehr die Folgen einer epochalen Unterlassung gemanagt werden. Was fehlt, ist eine engagierte, zukunftsorientierte und global ausgerichtete (Außen-)Politik, die gemeinsam mit den Ländern des Globalen Südens ernsthaft über ein gutes und gerechtes Leben für alle nachdenkt.
Österreich könnte (wie schon vor Jahrzehnten) neue Initiativen in der internationalen Politik setzen, zum Beispiel durch einen intensiven Kontakt mit der Afrikanischen Union, durch die Förderung von Austausch- und Studienprogrammen gerade mit den ärmeren Ländern oder überhaupt durch ein ernsthaftes Interesse an den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen in jenen Gesellschaften, aus denen Menschen migrieren (müssen). In der traditionellen Sprache der Katholischen Soziallehre gesprochen: Die Politik könnte – wenn sie denn wollte – das Prinzip der (internationalen) Solidarität verwirklichen. Davon aber ist die gegenwärtige Regierungspolitik weit entfernt – und zwar in vielen Ländern der EU. Das ist das eigentliche Problem. Wenn es an Compassion fehlt, können noch so viele Differenzierungen angebracht und „Vernunftgründe“ genannt werden – zu einer menschlicheren Welt wird dies nicht führen.
Der Autor leitet das Zentrum Theologie Interkulturell und Studium der Religionen an der Universität Salzburg.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!