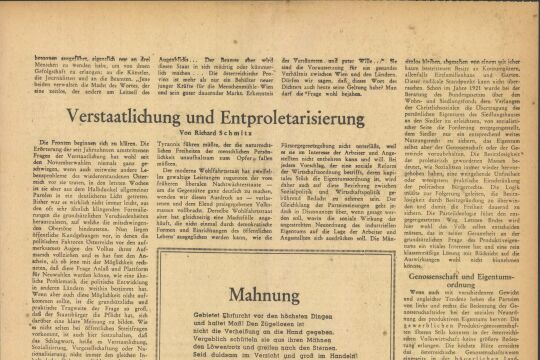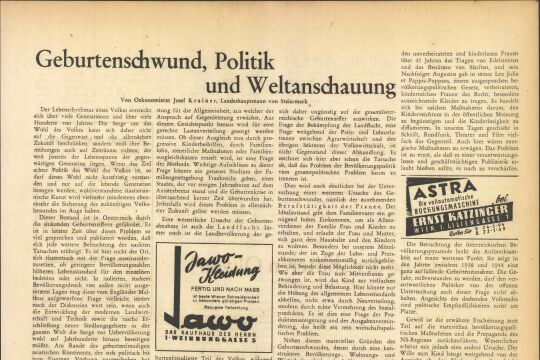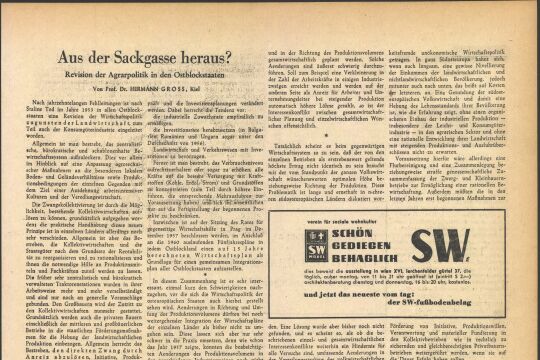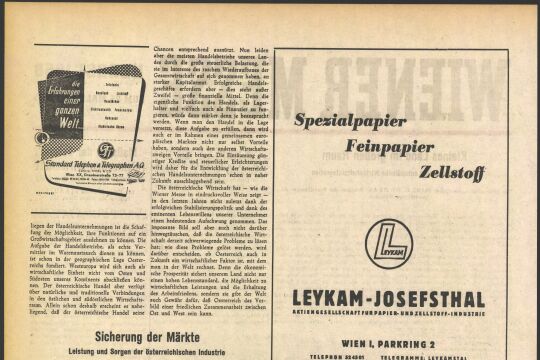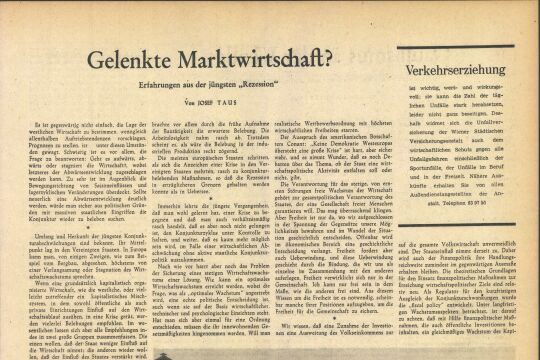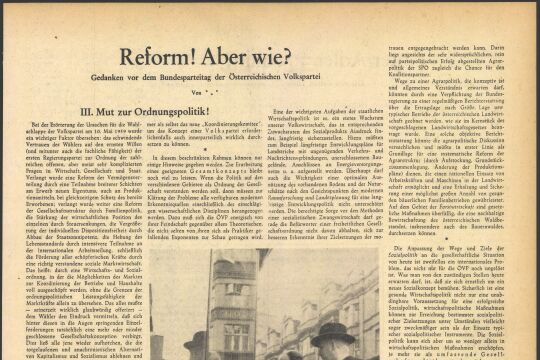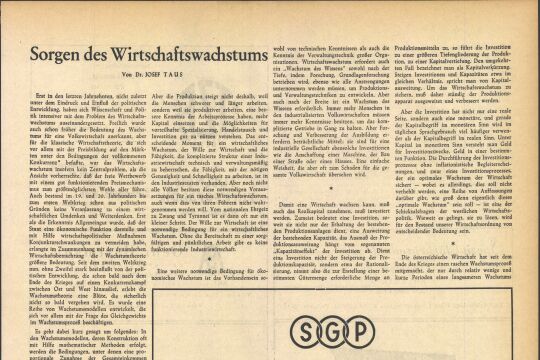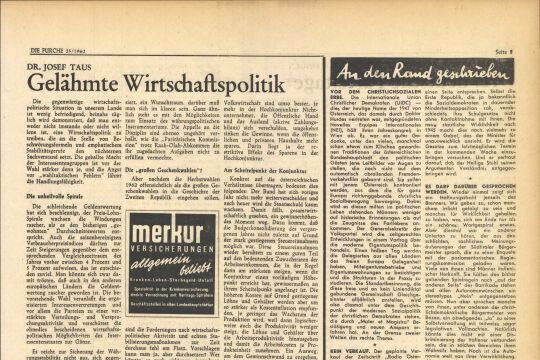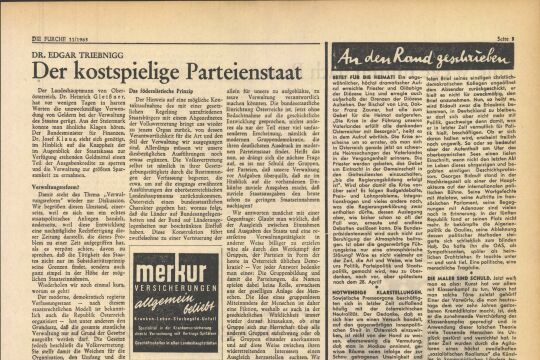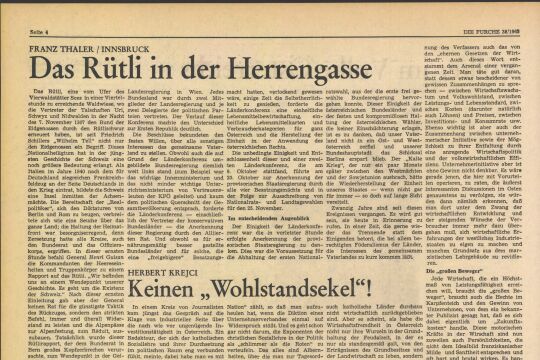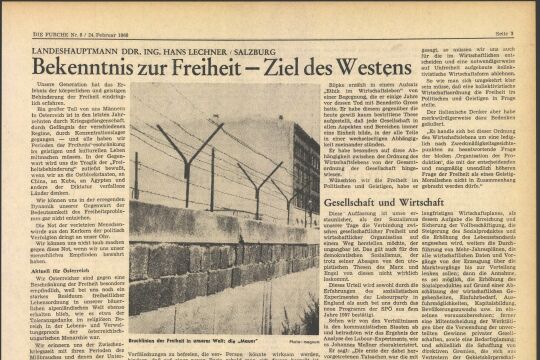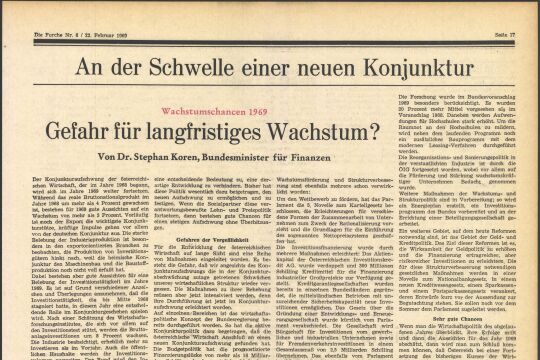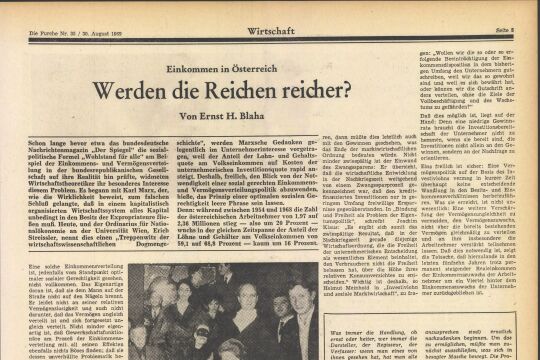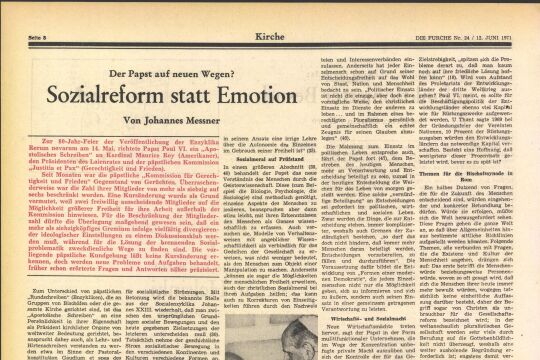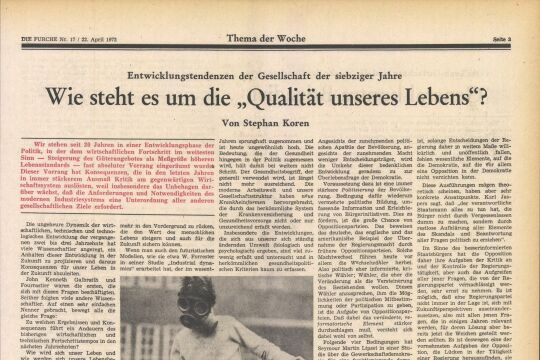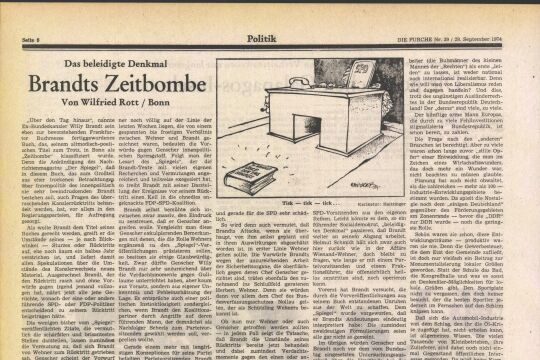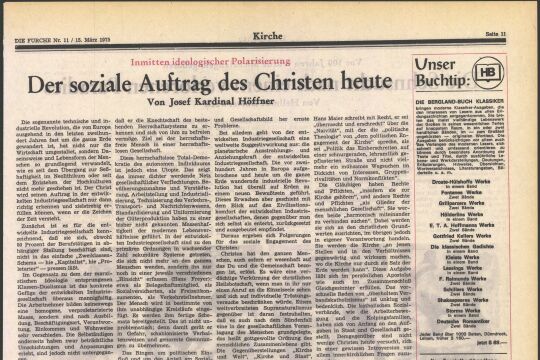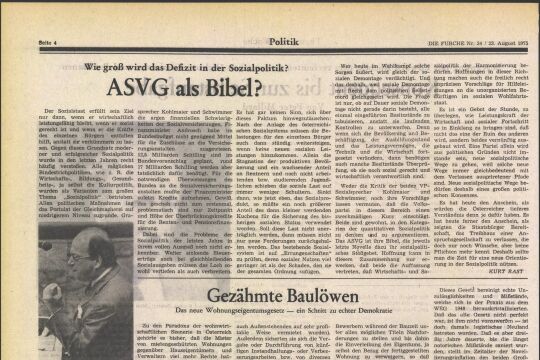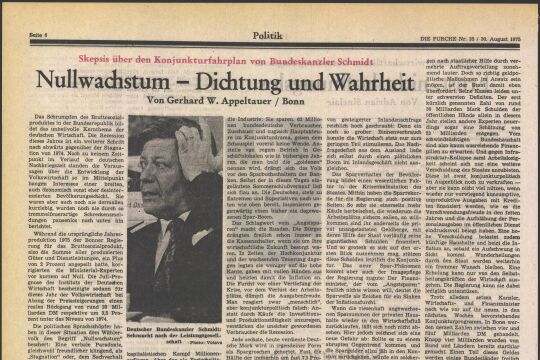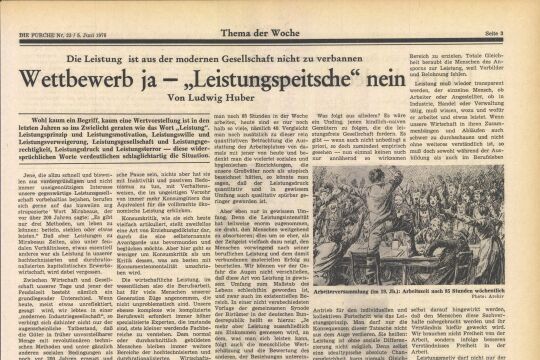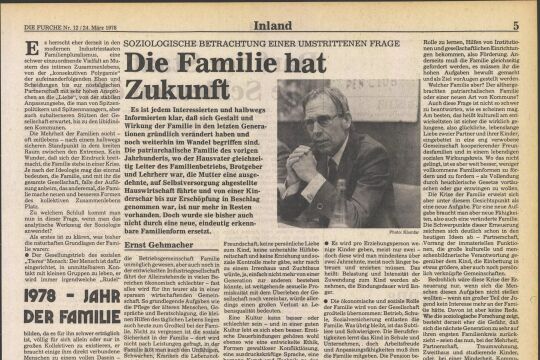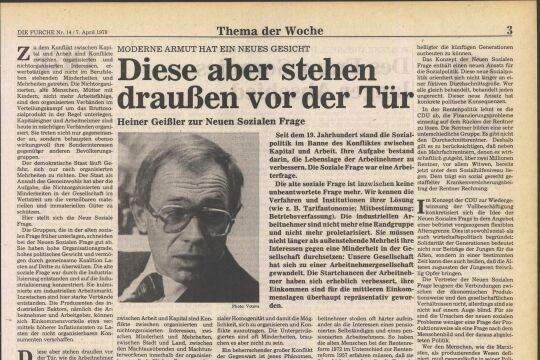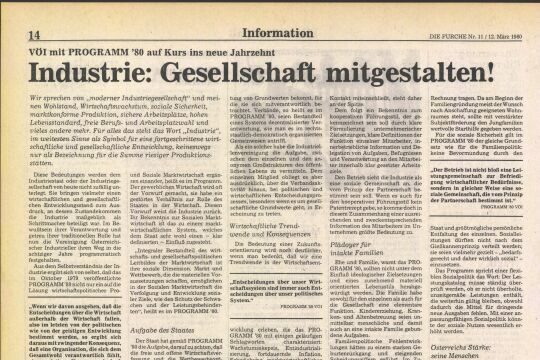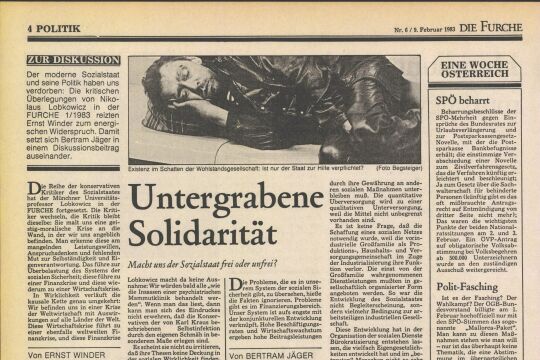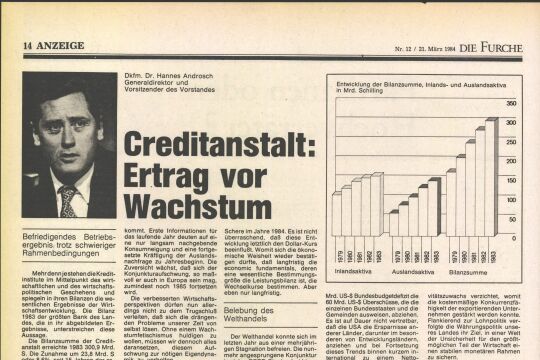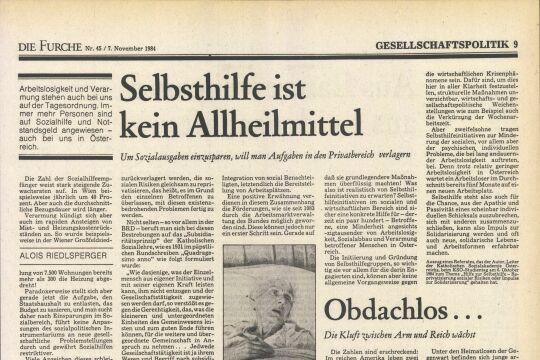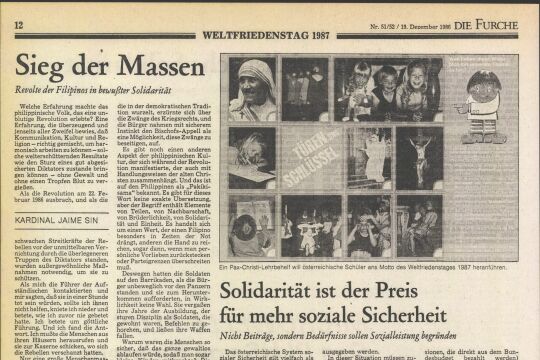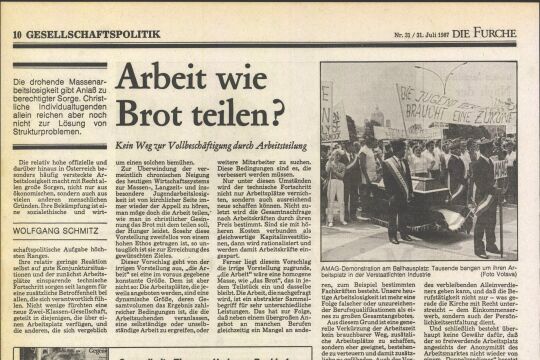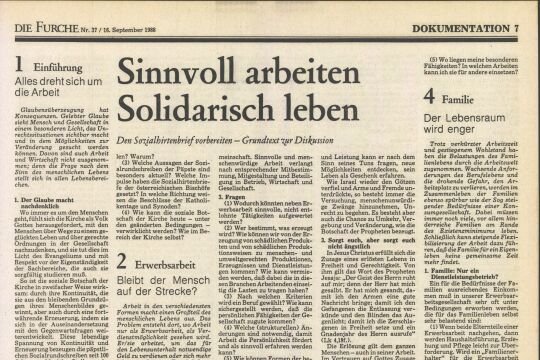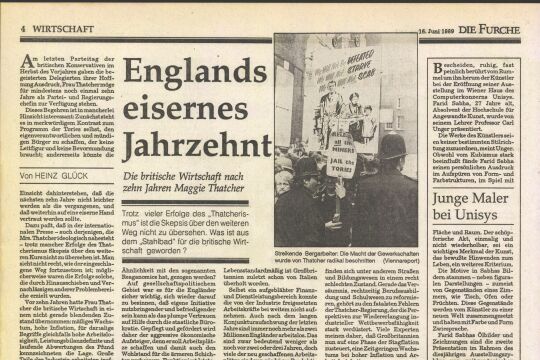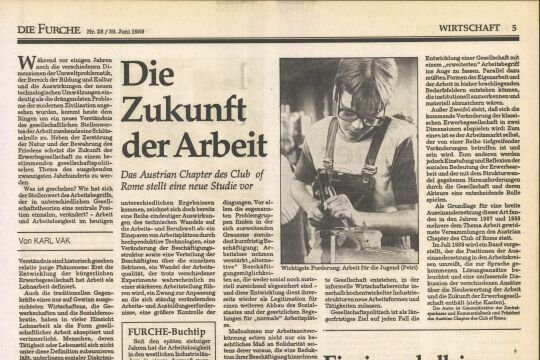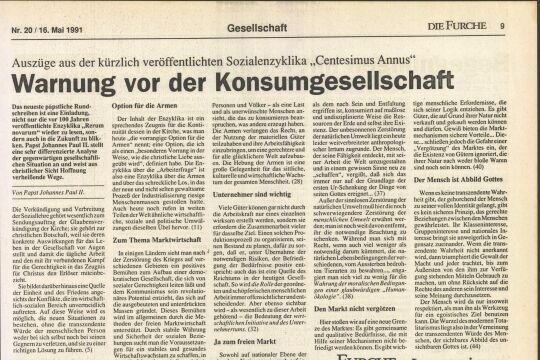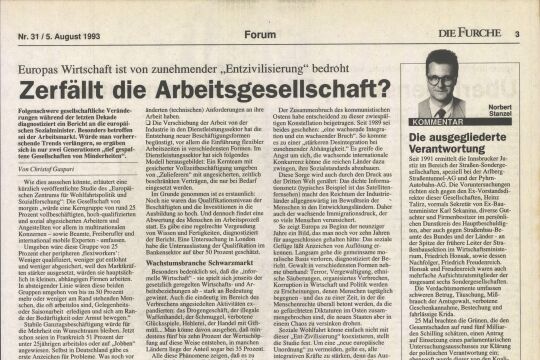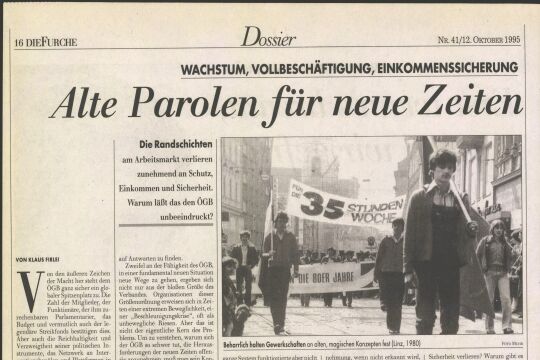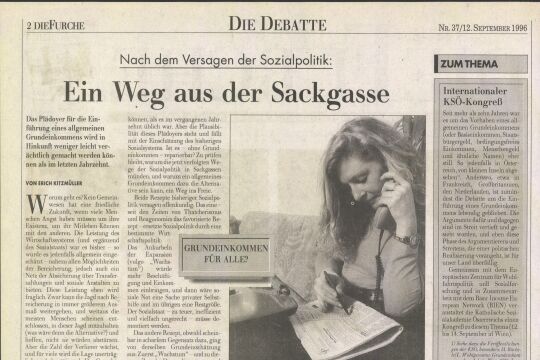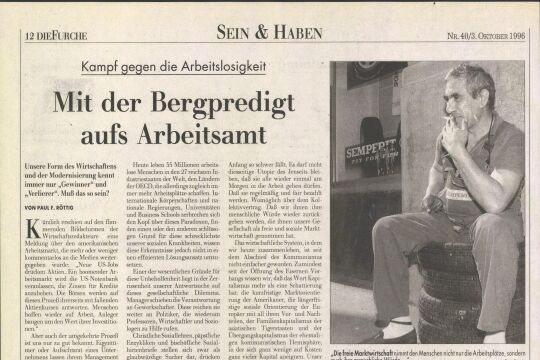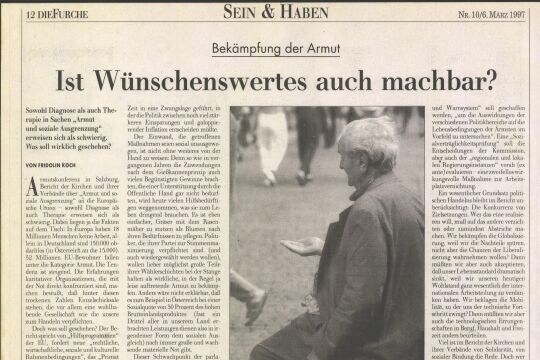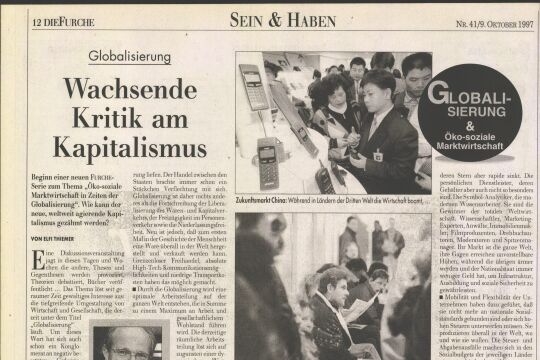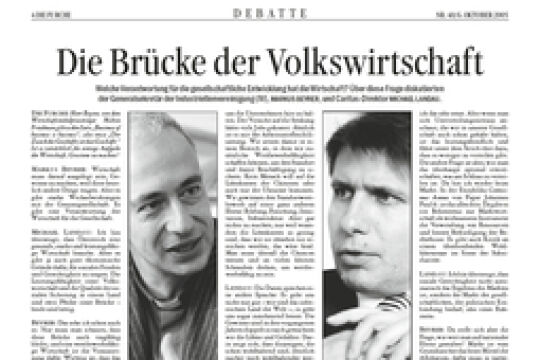Sozialpolitik: Eigenverantwortung bleibt - auch in der Krise
Es braucht keine ordnungspolitischen Experimente, sondern wirkungsvolle Sozialpolitik und die Verantwortung des Einzelnen, meint Walter Marschitz. Eine Gastmeinung zur „sozialen Frage“.
Es braucht keine ordnungspolitischen Experimente, sondern wirkungsvolle Sozialpolitik und die Verantwortung des Einzelnen, meint Walter Marschitz. Eine Gastmeinung zur „sozialen Frage“.
Während die Bewältigung der Coronakrise noch nicht abgeschlossen ist, folgt bereits der Versuch ihrer Instrumentalisierung. Alte ideologische Versatzstücke wie die 35-Stunden-Woche werden ebenso ausgegraben wie die Vermögenssteuer.
Eine grundlegende neue Ausrichtung des Wirtschaftens wird von „kritischen Kreisen“ in den Raum gestellt, endlich scheint die Krise des Kapitalismus – die oft postuliert wurde, aber bisher noch nicht nachhaltig eingetreten ist – tatsächlich Wirklichkeit zu werden. Allein: Ich glaube nicht daran. Ich erwarte vielmehr eine Aufbruchstimmung und eine wirtschaftliche Dynamik, wie wir sie schon länger nicht mehr erlebt haben. Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit werden wieder in den Hintergrund treten, die Frage des Fachkräftemangels sich in einem beschleunigten wirtschaftlichen Transformationsprozess stärker stellen als zuvor.
Unser kontinentaleuropäisches System einer ökosozialen Marktwirtschaft hat sich in der Krise bewährt, auch wenn Schwachstellen sichtbar wurden. Die Globalisierung und internationale Arbeitsteilung schaffen Dependenzen, die national – ja sogar europäisch – nicht oder jedenfalls nicht kurzfristig kompensiert werden können. Wir haben als Gesellschaft diese Krise, die nicht ohne Vorwarnungen auf uns gekommen ist, unterschätzt, ja negiert und sollten daraus lernen und in Zukunft gezielt systematische Krisenvorsorge betreiben.
Unterste Einkommen haben profitiert
Die sozialen Folgen der Krise sind im Weltmaßstab noch nicht abzusehen. Für Österreich halte ich sie aber für nicht so gravierend. Der Grund dafür ist, dass mit öffentlichen Mitteln – genauer gesagt mit öffentlichen Schulden – massiv gegengesteuert wurde. Die Coronahilfen betrugen mit einem Rahmen von 50 Milliarden Euro mehr als die Gesamtausgaben für Arbeit, Gesundheit, Soziales (inklusive Pensionen) und Familie im Budget 2019.
Unterm Strich dürften die untersten Einkommensschichten von der Krise sogar monetär profitiert haben, was auf zusätzliche Zahlungen wie den Kinderbonus oder die Aufstockung der Notstandshilfe zurückzuführen ist. Auch bei jenen, die von Kurzarbeit betroffen waren, müsste eigentlich der Entfall eines Teils des Arbeitseinkommens durch geringere Konsumausgaben kompensiert worden sein. Die Zahlen bestätigen diese These: Die Sparquote hat sich 2020 fast verdoppelt, insgesamt wurden um 13,5 Milliarden mehr auf die hohe Kante gelegt, während das verfügbare Haushaltseinkommen im gleichen Zeitraum nur um 4,1 Milliarden gesunken ist. Die Sozialleistungen sind dafür 2020 um 8,9 Prozent gestiegen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!