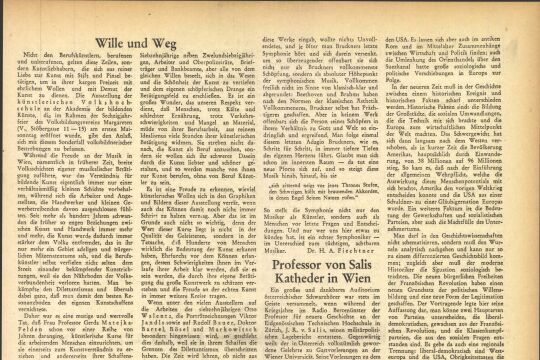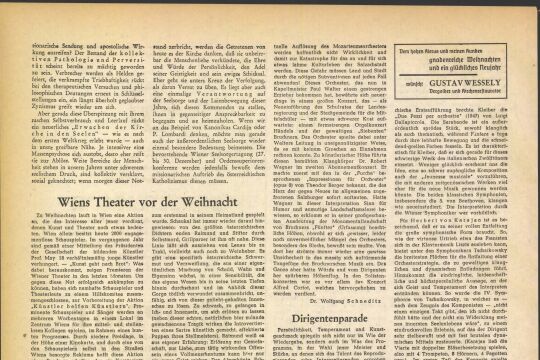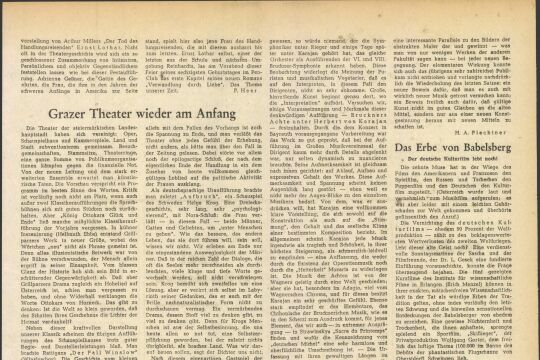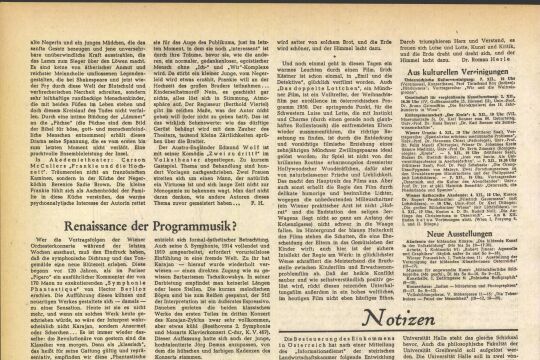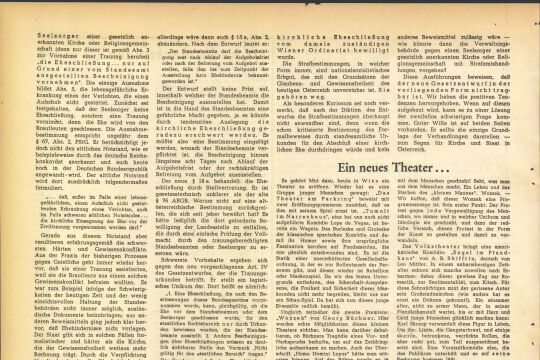Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Fest mit Mahler
Ein Festspielfinale, wie man es seit Jahren imposanter nicht erlebt hat:- Salzburg sammelte für die letzte Woche alle Prominenz und überraschte seine Gäste mit Konzerten, wie sie kaum interessanter hätten sein können. Dabei sorgte vor allem Leonard Bernstein mit seiner Aufführung von Gustav Mahlers VIII. Symphonie für den triumphalen Schluß im Großen Festspielhaus, für eine Orgie bombastischer Klangentfaltung, dröhnender Chöre, schwelgerischen Wohllauts. Es war ein Triumph sondersgleichen für Bernstein, der dieses Heerlager der Sänger und Musiker mit ekstatischer Selbstentäußerung kommandierte, beschwor, in Raserei versetzte, daß das Publikum nach 90 Minuten äußerster Spannung vor Begeisterung tobte.
Ein Festspielfinale, wie man es seit Jahren imposanter nicht erlebt hat:- Salzburg sammelte für die letzte Woche alle Prominenz und überraschte seine Gäste mit Konzerten, wie sie kaum interessanter hätten sein können. Dabei sorgte vor allem Leonard Bernstein mit seiner Aufführung von Gustav Mahlers VIII. Symphonie für den triumphalen Schluß im Großen Festspielhaus, für eine Orgie bombastischer Klangentfaltung, dröhnender Chöre, schwelgerischen Wohllauts. Es war ein Triumph sondersgleichen für Bernstein, der dieses Heerlager der Sänger und Musiker mit ekstatischer Selbstentäußerung kommandierte, beschwor, in Raserei versetzte, daß das Publikum nach 90 Minuten äußerster Spannung vor Begeisterung tobte.
In Salzburg hat man diese „Achte“ zuletzt 1960 unter Dimitri Mitro-poulos aufgeführt. Eigentlich unverständlich, daß gerade diese für Festspiele wie geschaffene Symphonie so selten aufs Programm gesetzt wird. Natürlich sind die Kosten enorm. Eine Monsterbesetzung, die hier von den Wiener Philharmonikern (unterstützt von einem Bläserchor auf dem Balkon) vom Staatsopernchor und dem Wiener Singverein, von den Sängerknaben und acht Sängersolisten bestritten wurde. Und nicht weniger belastend sind die Schwierigkeiten, dieses ungemein differenzierte Werk einzustudieren. Aber ist die „Symphonie der Tausend“, mit der Mahler bei der Uraufführung 1910 in München seinen ersten Sensationserfolg verbuchen konnte, nicht auch so etwas wie eine Garantie für einen Publlkumserfolg? Vor allem dank so mitreißender Einfälle wie des Pfingshymnus ,.Veni creator spiritus“, des „Blicket-auf“-Gesangs oder des „Ewigen Wonnebrands“, mit dem der Pater Ecstaticus triumphiert... Hier wird ein Maß von Monumentalität erreicht, dem man sich kaum entziehen kann. Es muß also am mangelnden Vertrauern der Veranstalter in Mahlers Bekenntnis-Werk liegen — Mahler: „ein Geschenk an die ganze Nation“ —, daß man dieses so selten aufführt, obwohl es ein Zugstück ist wie nur noch Beethovens „Neunte“ oder das Verdi-Requiem.
Allerdings hat Leonard Bernstein mit seiner Salzburger Aufführung, die anschließend in Wien verfilmt wurde, dieses Mißtrauen wie kein zweiter auszulöschen verstanden. Wir hoffen dies zumindest. Denn seine Wiedergabe strahlt ein so zwingendes Maß an Intensität aus, ist von so tiefer Uberzeugungskraft und Erschütterung, daß selbst Zuhörer, die Mahlers Faszination nur bedingt anerkennen, hier rückhaltlos begeistert waren.
Bernsteins Erfolgsgeheimnis: er taucht bei dieser Wiedergabe tief ein in die Partitur, wühlt sie auf und reißt alles mit sich, empor zur großen Apotheose... In die himmlischen Höhen, in den Olymp der „Fausf-Verklärung, zu einer Vision der Einsiedler, Büßer, Engel, zu einer Vision, in der er die unbe-schreibbar kunstvolle Ausdrucksskala Mahlers mit stupender Virtuosität ausschöpft: von den raffiniertesten kammermusikalischen Einfällen und Effekten über die bombastischen opernhaften Momente bis zur mystischen Verklärung durch das „Ewig-Weibliche“, das uns hinanzieht. Und wenn Bernstein dabei im Drang des Nachempfindens, ja, im Sturm eines Neuschaffens des Werks alle Ausdrucksvorschriften ins Enorme übersteigert, wenn er Tempi an die äußersten Grenzen der Realisierbarkeit führt und in orgiastische Wildheit ausbricht, so stört das keinen Moment. Denn in dieser Aufführung ist alles perfekt zusammengeschweißt. Sie ist reif, ist organisch gewachsen und zutiefst empfunden. Eine faszinierende Leistung, mit der er sich gegenüber früheren Deutungen selbst übertroffen hat. (Man denke nur an seine Plattenaufnahme des Werks mit dem London Symphony Orchestra.)
Allerdings, einen Schönheitsfehler hatte diese Aufführung dennoch. f| Denn die Solistenbesetzung wirkte allzu unausgeglichen; sie bewies nur, wie schwer es ist, ein Sängerteam zu finden, das Mahlers Vorstellungen entspricht. Margaret Price etwa trumpfte mit ihrem Riesensopran auf, Judith Biegen, eine schöne, weich timbrierte, aber schlanke Stimme, und Gerti Zeumer als zarte Mater gloriosa imponierten. Trudeliese Schmidt und Agnes Baltsa fehlte es hingegen an strahlendem Glanz, wie an samtigen Ausdruckswerten, um diese Altpartien zu singen. Sie fügen sich nicht in Mahlers Stil. Der Tiefpunkt dieser Besetzung war Kenneth Riegel, dessen Tenor die Partie des Doctor Marianus geradezu abwertete; Hermann Prey und Jose van Dam gefielen.
Im ganzen war diese letzte Festspielwoche eine Art von Gratwanderung von Höhepunkt zu Höhepunkt: Denn auch die beiden Konzerte der Berliner Philharmoniker unter Herbert von Karajan bescherten Ereignisse von Rang. Einerseits hörte man da Karajan mit einem seiner bevorzugten Werke Anton Bruckners, der VIII. Symphonie; anderseits führte er mit dem
Cellisten Mstislav Rostropowitsch Richard Strauss' „Don Quixote“ auf. Und wenn sich zwei Künstler vom Rang eines Karajan und Rostropowitsch zusammentun, kann man denn auch Außerordentliches erwarten. Allein die Aufforderung, die das Können und die musikalischen Vorstellungen jedes einzelnen für den Partner bedeuten, diese Aufforderung zur unverwechselbaren Leistung, garantiert Spannung, Sensation.
Karajan und Rostropowitsch sind Künstler, die sich nicht in die Karten schauen lassen. Was sie präsentieren, hat den Schliff des Endgültigen. Vom Arbeitsprozeß an einem Werk, vom immer wieder neuen Erschaffen eines Werks im Konzert, wie Bernstein dies etwa exekutiert, merkt man ihrer Arbeit nichts an. Allerdings treffen sie damit auch ganz präzise den Charakter dieser artistischen Variationen „über ein Thema ritterlichen Charakters.“ Das Element des Virtuosen, das dialogische Aufsplittern in viele kleine Motive, Partikel, Phrasenfragmente, dieses Hervorkehren solistischer Leistungen in kunstvoll verspannten Zwiegesprächen — vor allem zwischen der Viola (hier Ulrich Koch) und dem Cello (Rostropowitsch) —: Das ist das Gestaltungsprinzip des „Don Quixote“.
Vor allem aber war dieseAuffüh-rung ein Zwiegespräch zwischen
Karajan und Rostropowitsch. Bewundernswert dabei, wie Karajan mit seinen Berlinern die schillernde Umwelt für den „Ritter von der traurigen Gestalt“ aufbaut, wie er diese klanggewordene Welt aus theatralischen Versatzstücken, aus Kulisssen baut, an denen sich die Phantasie des rettungslos närrischen Idealisten entzündet. Und anderseits könnte ein Sänger oder Schauspieler diesen Part des Don Quixote nicht eindringlicher, packender spielen als Rostropowitsch mit seinem Cello. Die Jagd nach dem Ideal, nach dem Glück, das nie dort ist, wo der Ritter ankommt, die grotesken Übersteigerungen seiner Phantasie... Das alles trägt der große Russe mit einer Schönheit des Tons und einem Maß an Souveränität vor, die ihresgleichen sucht.
Hier und auch für seine Wiedergabe von Bruckners „Achter“ erntete Karajan tobenden Beifall. Sein Bruckner, den man in den letzten Jahren immer wieder gehört hat, wirkt nun freilich nicht mehr so glatt, so sehr auf die glänzende Oberfläche hin realisiert. Karajan hat diese Wiedergabe weiter vertieft,, seine Tempi sind breiter, bedächtiger, feierlicher geworden. Und mit unvergleichlicher Schönheit, mit außerordentlichem Gespür für Klänge dirigiert er hier Übergänge, mildert er die abrupten Abbruche und Klangkrater etwa des vierten Satzes. Es ist also das Kapitel Bruckner für Karajan nach wie vor keine abgeschlossene Sache, man kann noch immer neue Entwicklungsphasen erwarten. Und das macht es so spannend, Karajans Wiedergaben dieses Werkes durch die Jahre zu verfolgen.
Auch eine Geigersensation bescherten die Salzburger Festspiele: Itzhak Perlman, den 29jährigen Israeli, der sich unter Zubin Mehta mit dem Isroel Philharmonie Orchestra präsentierte und dabei Mendelssohns e-Moll-Violinkonzert spielte und tags darauf einen Soloabend mit Sonaten von Brahms, Ravel und Bach und Salonstücken von Wieniawski, Paganini, Rach-maninow u. a. gab. Perlman ist — einfach gesagt — ein fabelhafter Virtuose, ein Teufelskünstler mit Witz, Ironie, von fulminanter Musikalität. Welch tiefes Gefühl für romantische Geigenkantilenen er hat, bewies er im Mendelssohn-Konzert: Da entlockt er seiner Stradivari sinnlichen Glanz, steigert das Alle-grofinale zu einer „Sommernachts-traum“-Reminiszenz ohne jede Erdenschwere, schwelgt in Farben und Bravourpassagen ... Nur wo es ihm zu süßlich wird, besinnt er sich auf die Möglichkeiten der romantischen Ironie, setzt plötzlich sein Spiel gleichsam unter Anführungszeichen und leiht dem ganzen eine gehörige Portion Ironie.
Besonders bemerkte man das in seinem Soloabend, wo er sich mit Feuereifer vor allem in die reißerischen Wiedergaben stürzte, in diese Wunderwerke der Saitenartistik, wo ihm eine Idealmischung aus Bravour, Sentiment und Witz gelingt. Bestechend die Eleganz seines Spiels, bewundernswert, wie er selbst die trivialsten Einfälle der Salonmusik durch den erlesenen Wohlklang seines Spiels interessant macht und zugleich alle falschen Attitüden, alles falsche Sentiment abräumt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!