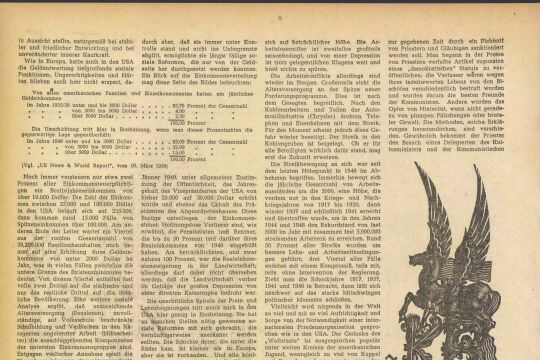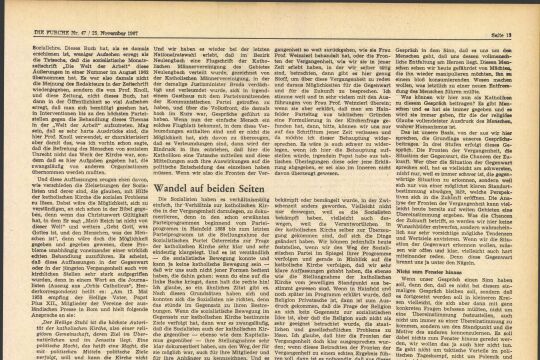Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Graben teilt die Nica-Kirche
Die Kluft innerhalb der Kirche Nikaraguas, wo 95% nominell katholisch sind, ist nicht zu übersehen. Wie ist es dazu gekommen? Wie soll es denn in Zukunft weitergehen?
Die Kluft innerhalb der Kirche Nikaraguas, wo 95% nominell katholisch sind, ist nicht zu übersehen. Wie ist es dazu gekommen? Wie soll es denn in Zukunft weitergehen?
Die Predigt war ziemlich politisch. Vor der Kommunion verlas der Priester eine Solidaritätsadresse für die Milizkämpfer im Grenzgebiet. Richtig „fromm“ klang eigentlich erst das Marien-gebet am Ende der Messe.
Sonntag abend, Vorstadtpfarre der nikaraguanischen Hauptstadt Managua. Iglesia populär, „Volkskirche“. Für unsere Begriffe ein bißchen zu zelotisch, züsehr Agitation. Hat der Bischof da nicht recht, wenn er dagegen ist?
Der Bischof nennt diese „Christen für die Revolution“ einfach „Sandinisten“, unterstellt ihnen Ablehnung der bischöflichen und damit auch päpstlichen und damit überhaupt kirchlichen Autorität, weist sie den „Sekten“ zu.
Brüderlicher Dialog mit verirrten Schafen? „Sie können jeden zweiten Dienstag zu mir in die Sprechstunde kommen.“ Für unsere Begriffe ein bißchen zu formalistisch. Haben die Pfarrer da nicht recht, wenn sie gegen den Bischof sind?
Die Kluft zwischen einem Großteil der Hierarchie und einer aktiven Minderheit der Gemeindepriester ist groß. Dazwischen predigen, taufen, segnen und absolvieren viele angepaßte, Gehorsam übende Pfarrer und Kapläne.
Ein gutes Gefühl hat wahrscheinlich niemand dabei. Ein gutes Gefühl hat auch der ausländische Besucher nicht, der sich bemüht, Kirche in Nikaragua zu studieren. Es ist eine Kirche, die um ihren Weg noch ringt.
Am Sturz des Menschenschlächters Somoza im Juli 1979 war sie aktiv beteiligt: zum ersten Mal in der Geschichte neuzeitlicher Revolutionen. Wann kam es zum Bruch, und warum?
Wahrscheinlich ist es nie ein Bruch gewesen, weil Erzbischof Miguel Obando y Bravo von Managua nie ein Revolutionär gewesen ist — auch wenn Diktator Somoza ihn spöttisch „Comandante Miguelito“ schimpfte, als er, trotz aller guten Beziehungen zuvor, den Massenmörder zuletzt nicht länger unterstützen konnte.
Nach dem Triumph der Revolution - „el triunfo“ ist eine wichtige Sprachchiffre, wie es für alles in Nikaragua eine Sprachchiffre gibt — kühlten die Beziehungen zwischen Sandinisten und Bischöfen ab. Heute kann man Dutzende konkreter Konfliktbereiche aufzählen. Ganz überzeugt keiner.
Vielleicht haben jene recht, die eine psychologische Erklärung versuchen: „Die comandantes“, also die Führer der Revolution, „kommen alle aus bürgerlichen Familien und wollen beweisen, daß sie wahre Revolutionäre sind“, erläutert ein spanischer Ordenspriester in Leon. „Die Bischöfe kommen aus kleinen Verhältnissen und wollen beweisen, daß sie Herren sein können.“
Eine der Folgen: Die Bischöfe ertragen nur schwer, daß es eine’ Regierung gibt, die entscheidet, ohne sie zu fragen. Und die Sandi- y nisten ertragen nur schwer, daß es eine zweite Macht neben ihnen gibt, der sie nicht befehlen können.
Das ist wohl der geistige Hintergrund des Konfliktes, den man nun mit vielen Beispielen illustrieren kann. Bischof Obando klagt über die Zensurierung seiner Predigten. Seine Kritiker be-zeichnen diese als sehr politisch gefärbt.
Gleiches sagen sie über Hirtenbriefe, zum Beispiel den zum neuen Wehrpflichtgesetz. Dieses sieht Registrierpflicht für Männer zwischen 17 und 50 und Frauen zwischen 18 und 40 Jahren vor. Männer zwischen 17 und 25 müssen mit Einberufung rechnen.
Der erste Entwurf sah eine Ent- schlagungsmöglichkeit aus Gewissensgründen jVor. Dann belehrte Erzbischof Obando die Seinen, die Gewissensablehnung nicht nur des Tötens, sondern auch einer Regierung rechtfertige Wehrdienstverweigerung. Die Regierung tobte und strich den Passus.
Der Bischof von Managua rügt, daß seine Messen nicht mehr im Fernsehenübertragen werden. Die Regierung wendet ein, daß dafür andere Messen sehr wohl gesendet würden — mit Priestern, deren Predigten wieder der Bischof nicht goutiert.
Obando verweist darauf, daß zu seinen Messen Zehn-, ja Hunderttausende kämen, zu den Demonstrationen der „Christen für die Revolution“ nur ein paar hundert.
Die andere Seite: „Zum Bischof rennen aus politischen Gründen jetzt Leute, die früher nie in eine Messe gingen. Und außerdem benützt er Reliquien und wundertätige Heiligenstatuen, die ihm aus dem einfachen Volk Zulauf sichern — das ist Amtsmißbrauch!“
Die linken Priester werfen ihrem Ordinarius „vorkonziliare Massenpastoral“ nur mit Prozessionen und Wallfahrten vor, „aber man kann in diesem Land die Frohe Botschaft nicht ohne politische Konsequenzen verkünden“. Der Bischof spricht von einer „Verkürzung des Evangeliums auf Politik“, was von den Betroffenen wieder bestritten wird.
Konflikte mit politisch engagierten Priestern löst der Bischof durch Versetzungen. Dagegen gibt es oft Proteste und Demonstrationen. In Sicht des Oberhirten heißt dies: „Sie besetzen Wo-chen-, ja monatelang Kirchen und hindern den Bischof am Betreten von Gotteshäusern.“
Laut Obando y Bravo habe es in den letzten drei Jahren 15 Pfar rerversetzungen gegeben, von denen 13 („weil es sich um keine Sandinistenpriester handelte“) problemlos über die Bühne gegangen seien. „Er veröffentlicht Diözesanverzeichnisse, in denen gewisse mißliebige Priester gar nicht aufscheinen“, kontert ein Geistlicher in Nordnikaragua.
Wie viele „Sandinistenpriester“ gibt es denn überhaupt im Bistum Managua? „Vier der 50 Diözesan- priester und eine größere Zahl von Ordensleuten“, sagt Obando.
„Früher war die Mehrzahl der Priester für den Prozeß“, behauptet ein Pfarrer. („Prozeß“ ist wieder,eine Chiffre: für die unblutige Fortführung der Revolution.) „Heute haben die meisten resigniert.“
Nur etwa 50 der 160 Priester kämen zu den Kleruskonferenzen ins Bischofshaus. „Weil man aber schon niedergezischt wird, wenn man eine kritische Frage stellt, haben wir das Fragenstellen aufgegeben.“
Nur eine Frage wird dem Bischof oft gestellt: „Was haben Sie theologisch gegen uns?“ Darauf gebe es nie eine konkrete Antwort, weil es keine theologischen Differenzen gebe, versichert ein katholischer Laientheologe des Centro A. Valdevieso, einer vorwiegend vom Weltkirchenrat finanzierten ökumenischen Einrichtung. Sie betreibt Kindergärten, ein Rehabilitationszentrum für Prostituierte, Schulungen für Schuhputzerbuben und Zeitungsausträger. ,
„In den Augen des Bischofs ist unsere Tätigkeit eine Todsünde“, heißt es. In den Augen des Bischofs ist dieses Zentrum ein Nest der sandinistisehen Marxisten, „die viel Geld und alle Massenmedien für ihre Propaganda zur Verfügung haben“.
Ein anderer Streitpunkt sind Gebete und Messen für gefallene Milizsoldaten. Der Bischof verweigere solche, klagen die Kritiker. Obando: „Sie wollen, daß nur für tote Sandinisten gebetet wird, weil die anderen ja .Bestien* sind. Die Kirche aber betet für alle Opfer der Gewalt.“
Der Einwand: „Die Leute Sind es eben gewöhnt, mit einem Meßstipendium das Recht auf eine bestimmte Intention zu verbinden.“
Wie soll es weitergehen? „Der Geist der Priesterausbildung stimmt uns pessimistisch“, sagen manche. Keine Hoffnung also?
Vielleicht doch. Aufs Äußerste will es offenbar niemand ankommen lassen. „Keiner dieser Priester wurde ausgeschlossen oder abgesetzt“, sagt uns Bischofssekretär Bismarck Caballo, in dem viele eine treibende Kraft hinter Obando y Bravo sehen.
Außerhalb von Managua wird auch immer wieder bestätigt, daß sowohl der innerkirchliche wie auch der Kirche/Staat-Konflikt nirgendwo so ausgeprägt wie in dieser Diözese sei.
Einen hoffnungsvollen Eindruck erweckt auch der neubestellte Vorsitzende der nikaraguanischen Bischofskonferenz, Pablo Antonio Vega, der Bischof von Juigalpa. Kirchenpolitisch konservativ, wirkt er doch ungleich wendiger als Obando y Bravo.
Er ist dafür, im Verhältnis zur Regierung an die Stelle totaler Konfrontation eine Analyse konkreter Einzelprobleme treten zu lassen, die man dann in einer „acciön dialectica“ leichter lösen könne.
Innerkirchlich will Vega die Christen davon überzeugen, daß weder die rein spirituell orientierten „devocionalistas“ noch die rein politisch orientierten Revolutionäre die richtige Linie ver-folgen, sondern ein eigenständiger christlicher Mittelweg zwischen Liberalismus und Marxismus gefunden werden müsse, denn ein Zurück hinter die Revolution sei auch für die Kirche un-diskutabel.
Von einem solchen dritten Weg ist derzeit wenig in Nikaragua zu entdecken. Auf die Frage nach der katholischen Soziallehre begegnet man recht ahnungsschwachen Gesichtern.
Ahnung kann sich in Wissen wandeln, Kleinmütigkeit in Zuversicht. Dafür ist es nie zu spät.
Das gilt wohl auch für den Staat. Auch auf der politischen Seite scheint die Kühnheit, Revolution zusammen mit den Christen zu machen, der Sorge um den weiteren Verlauf zu weichen.
Die einen wie die anderen versuchen es zunehmend mit Rezepten von vorgestern. Das bedeutet Konfrontation. Die neue Situation aber verlangt nach neuen Schritten. Dem Motto „inter- acciön“ von Bischof Vega möchte man von Herzen Erfolg wünschen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!