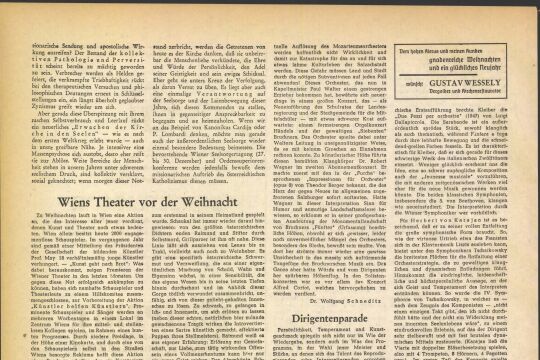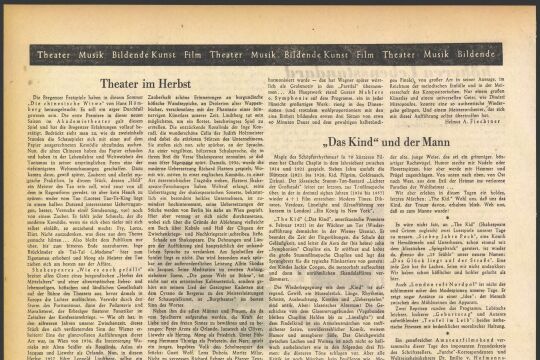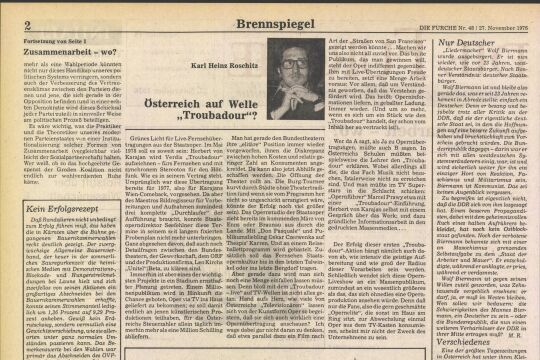Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Idol kehrt zurück
Der Jubel schien in Hysterie umzukippen: Applaussalven, Gestampfe, „Karajan, Karajan” brüllende Fans, dazu Rosenbüsche … Ein Jubelorkan ging über dem Parkett der Wiener Staatsoper nieder. „So etwas ham ma seit Karajans Abgang 1964 net mehr erlebt”, staunte ein Billeteur. Der Grund für dieses Spektakel: Herbert von Karajan, mit ebenso viel rückhaltloser Begeisterung verehrt, wie von seinen Gegnern heftig bekämpft, kehrte nach dreizehn Jahren totaler Wien-Abstinenz zurück an „sein” Haus. Mit Verdis „Troubadour”, einer 1962/63 für Salzburg geschaffenen Karajan-Inszenierung, die dann nach Wien übersiedelt, heuer als Osterfestivalgala gezeigt und jetzt erneut für die Wiener Staatsoper aufgefrischt wurde.
Der Jubel schien in Hysterie umzukippen: Applaussalven, Gestampfe, „Karajan, Karajan” brüllende Fans, dazu Rosenbüsche … Ein Jubelorkan ging über dem Parkett der Wiener Staatsoper nieder. „So etwas ham ma seit Karajans Abgang 1964 net mehr erlebt”, staunte ein Billeteur. Der Grund für dieses Spektakel: Herbert von Karajan, mit ebenso viel rückhaltloser Begeisterung verehrt, wie von seinen Gegnern heftig bekämpft, kehrte nach dreizehn Jahren totaler Wien-Abstinenz zurück an „sein” Haus. Mit Verdis „Troubadour”, einer 1962/63 für Salzburg geschaffenen Karajan-Inszenierung, die dann nach Wien übersiedelt, heuer als Osterfestivalgala gezeigt und jetzt erneut für die Wiener Staatsoper aufgefrischt wurde.
Und während in der Staatsoper Karajans Fans und eine Menge internationaler Prominenz, Politiker, Stars, Industriegewaltige, sich darin einig schienen, daß „der Karąjan der größte ist, den’s zur Zeit gibt”, waren sich Jungsozialisten vor dem Haus einig, daß „der Karajan wieder raus” soll: Mit einer angekündigten Demonstration und einer Arena-Flugzettelaktion protestierten sie gegen Hochkultur-Politik und Karajan-Kult. Wobei natürlich auf den Flugzetteln Fritz Herrmanns peinliches Karajan-Spottgedicht nicht fehlen durfte…
Was ist das Provozierende an Karajan? Das mag sich wohl mancher auch während und nach dieser Aufführung wieder überlegt haben. Ist es das krasse Mißverhältnis, das sich immer wieder zwischen dem im Umgang mit Menschen notorisch scheuen, so gar nicht an Publicity interessierten Karajan, und seinem „Apparat” zeigt? Ist es Karajans notorischer Perfektionswunsch, überall Superleistungen zu erbringen, die sich natürlich von allem Opemmittelmaß rundum abheben? Oder ist es der Vermarktungsmechanismus, den man rund um ihn aufgebaut hat, diese beispielhaft funktionierende Maschinerie, die jede Opem- produktion und fast jedes Konzert auch materiell in allen Möglichkeiten auszuschöpfen trachtet? Daß dazu natürlich zum Beispiel ein eigenes Künstlermanagement in Liechtenstein nötig ist, braucht kaum erwähnt zu werden. Oder ist es der wohl am meisten attackierte Karajan-Clan, der seine Gegner zur Weißglut reizt, wie er anderseits seine Fans als Bestandteü des Karajan-Kultrituals beeindruckt?
Manchmal tut man sich da etwas schwer, all diese Fragen unter einen Hut zu bringen, all diese Facetten der eigenwilligen Persönlichkeit als Ganzes zu sehen. Besonders wenn Karajan schüchtern vor den Vorhang tritt und von so viel Jubel und Anhänglichkeit gerührt, sich kaum der Tränen erwehren zu können scheint. Wie dies nach den „Troubadour”-Ovationen der Fall war…
Die „Troubadour”-Gala selbst hatte gegenüber Karajans Salzburger Oster- festspielaufführung etliche Vorteüe. Auf der kleineren Staatsopembühne wirkt Karajans behutsame, völlig unaufdringliche Inszenierung straffer und geballter. Der Kontakt zu den Sängern schien mir intensiver. Die musikalische Realisierung mit den Wiener Philharmonikern explosiv, hochdramatisch. Sogar dort, wo Karajan - wie nie zuvor - zum Zurücknehmen neigt, wo er düsteren Farben den Vorzug gibt und die Schwärze der Partitur auskostet.
Sein Sängerteam hatte allerdings auch einen großen Vorteil: Statt Franco Bonisolli sang hier Luciano Pavarotti den Manrico. Und dessen samtiges Timbre und dessen Schmelz berückte die Opernfans. Leontyne Price hat bis heute keinen Zoll von ihrem Primadonnenglanz verloren. Perfekt ihre Diktion, kostbar das Piano, mit dem sie brilliert, erlesen die Stimmkultur. Und manchmal, wenn der voluminöse Glanz der Stimme etwas ausläßt, hilft die Erinnerung einem weiter. Die Erinnerung an eine der schönsten Opemstimmen … Piero Cappuccilli profilierte sich als Graf Luna stärker als in der Salzburger Aufführung. Verdis Pathos, das Schwarze dieser Figur gewann da überzeugend klare Konturen. Christa Ludwig schließlich steigerte sich vor allem nach der Pause zur leidenschaftlichen Azucena, die das Zupacken des Schicksals spürbar macht.
Die Begeisterung des Publikums kannte jedenfalls kaum noch Grenzen. Aber spricht es nicht auch für sich, daß ein Witzbold gemeint hatte, man könnte hier doch auch ausnahmsweise „Applauskarten” verkaufen, für alle jene, die nur in der Pause und nach der Vorstellung sich austoben wollten?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!