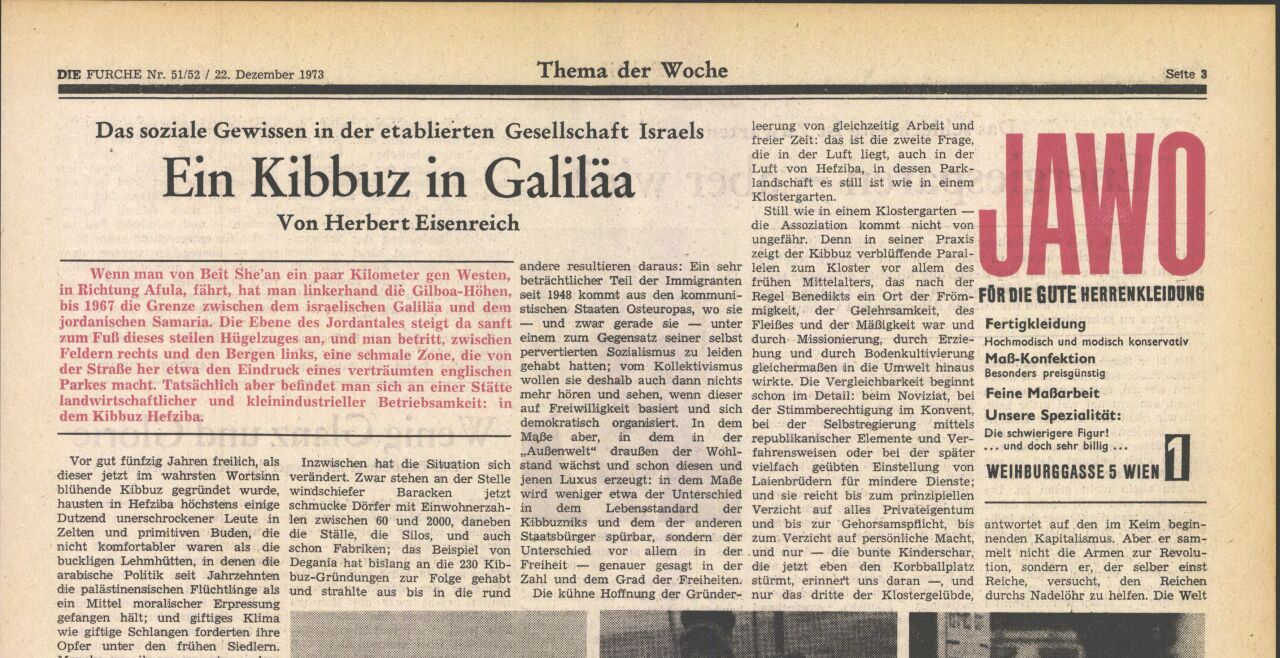
Ein Kibbuz in Galiläa
Wenn man von Beit She'an ein paar Kilometer gen Westen, in Richtung Afula, fährt, hat man linkerhand die Gilboa-Höhen, bis 1967 die Grenze zwischen dem israelischen Galiläa und dem jordanischen Samaria. Die Ebene des Jordantales steigt da sanft zum Fuß dieses steilen Hügelzuges an, und man betritt, zwischen Feldern rechts und den Bergen links, eine schmale Zone, die von der Straße her etwa den Eindruck eines verträumten englischen Parkes macht. Tatsächlich aber befindet man sich an einer Stätte landwirtschaftlicher und kleinindustrieller Betriebsamkeit: in dem Kibbuz Hefziba.
Wenn man von Beit She'an ein paar Kilometer gen Westen, in Richtung Afula, fährt, hat man linkerhand die Gilboa-Höhen, bis 1967 die Grenze zwischen dem israelischen Galiläa und dem jordanischen Samaria. Die Ebene des Jordantales steigt da sanft zum Fuß dieses steilen Hügelzuges an, und man betritt, zwischen Feldern rechts und den Bergen links, eine schmale Zone, die von der Straße her etwa den Eindruck eines verträumten englischen Parkes macht. Tatsächlich aber befindet man sich an einer Stätte landwirtschaftlicher und kleinindustrieller Betriebsamkeit: in dem Kibbuz Hefziba.
Vor gut fünfzig Jahren freilich, als dieser jetzt im wahrsten Wortsinn blühende Kibbuz gegründet wurde, hausten in Hefziba höchstens einige Dutzend unerschrockener Leute in Zelten und primitiven Buden, die nicht komfortabler waren als die buckligen Lehmhütten, in denen die arabische Politik seit Jahrzehnten die palästinensischen Flüchtlinge als ein Mittel moralischer Erpressung gefangen hält; und giftiges Klima wie giftige Schlangen forderten ihre Opfer unter den frühen Siedlern. Manche von ihnen verzagten, gaben halb erobertes Terrain wieder preis. Die überwiegende Mehrzahl aber blieb. Und was sie — in Hefziba wie in allen anderen Kibbuzim — dort hielt, war im Grunde nichts anderes als eine scheinbar verrückte Idee; eine sehr konkrete Idee aber, wenn man sich ihre Entstehung vergegenwärtigt.
Geboren wurde die Kibbuz-Idee 1909 in Degania am See Genezareth, aber gezeugt worden ist sie, so paradox das aufs erste auch klingen mag, vor rund einhundert Jahren in Rußland. Die in den meist kleinstädtischen Gettos der Ukraine, Weißrußlands, Polens und Litauens lebende Masse des europäischen Judentums hatte ja nicht nur unter gelegentlichen Pogromen, sondern mehr noch, weil permanent, unter geradezu irrsinnigen Zwangsmaßnahmen der Staatsgewalt zu leiden.
Nur so nämlich ist erklärlich, mit welcher Hoffnungsfreude, mit welchem Erlösungsglauben gerade Rußlands Juden den damals jungen Sozialismus, gleich welcher Provenienz, sowohl in sich aufgenommen als auch weiterentwickelt haben: er verhieß ihnen ja das gerade ihnen am nötigsten Ende aller Entfremdung. Der Sozialismus predigte ihnen, was sie auch ohne die Kenntnis von Marx schon herbeigesehnt hatten: die Wiedergewinnung der menschlichen Würde durch der eigenen Hände Arbeit — eine Formulierung übrigens, die jüngst in Israel wieder in den Sprachgebrauch gekommen ist im Hinblick auf die sozial weder emanzipierten noch integrierten Araber in den besetzten Gebieten.
Diesem jungen Sozialismus verband sich eine kaum jüngere Geistesströmung von anscheinend völlig anderer Herkunft, Ursache und Zielrichtung: der Zionismus, dessen erster großer Wortführer allerdings auch ein Wortführer des frühen Sozialismus gewesen war: Moses Heß. Denn wenn man arbeiten, elementar produktiv arbeiten wollte, brauchte man Land, und Land war offenbar nirgendwo zu bekommen, nirgendwo sonst als in einem eigenen Land, und dieses Land war das Heilige Land, war Zion, war konkret Palästina. Neue Verfolgungen — von lokalen Pogromen in Rußland bis zum systematisierten Massenmord unter Hitler — gaben den unmittelbaren Anstoß zu Wellen der Heimkehr ins Land der Herkunft. Das innere Motiv der Entstehung Israels — und der Entstehung des Kibbuz, die mit jener ideologisch identisch ist —, das innere Motiv aber war gegeben mit dem unterirdischen Zusammenfluß der zwei genannten Strömungen: des Zionismus mit dem Sozialismus, woraus etwas tatsächlich Neues, von beiden Standorten so nicht Anvisiertes sich gebildet hat. Nicht zufällig sangen die ersten Kibbuzniks: „Wir sind gekommen, das Land aufzubauen und dadurch unseren Geist wiederzubeleben“ — ihnen war dieses innere Motiv noch gegenwärtig.
Inzwischen hat die Situation sich verändert. Zwar stehen an der Stelle windschiefer Baracken jetzt schmucke Dörfer mit Einwohnerzahlen zwischen 60 und 2000, daneben die Ställe, die Silos, und auch schon Fabriken; das Beispiel von Degania hat bislang an die 230 Kib-buz-Gründungen zur Folge gehabt und strahlte aus bis in die rund
370 Moschawim, die Genossenschaftsdörfer mit kibbuzähnlicher Demokratie und einer Kombination von privatem und kollektivem Besitz und Erwerb; und die vereinzelten Trüppchen der frühen Kolonisatoren, diese spontan formierten ersten Kommunen, sind zusammengewachsen und haben sich ausgewachsen zu einer geplant funktionierenden Organisation von rund 85.000 Menschen. Aber Israel selbst ist keine Wüste mehr und nicht einmal mehr ein Entwicklungsland, sondern ein bis in die Landwirtschaft hinein industrialisierter Staat, der offenbar immer weniger tollkühne Pioniere mit dem Ideal gemeinnütziger Arbeit von eigener Hand, sondern immer mehr spezialisierte Techniker und kalkulierende Manager einerseits und immer mehr Lohnarbeiter anderseits benötigt. Gewiß, die Kibbuz-Bewohner stellen zwar nur knapp 3 Prozent der Gesamtbevölkerung Israels, erwirtschaften aber rund 8 Prozent des Bruttonationalprodukts; und auf führenden Posten im Parlament und in der Regierung, in der Diplomatie und vor allem auch in der Armee stehen weitaus mehr Kibbuzniks, als ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. Aber obwohl die Bewegung absolut weitergewachsen ist — im Jahr der Staatsgründung lebten rund 75.000 Israelis in Kibbuzim —, zeigt ihre Mitgliederzahl in Relation zu der jüdischen Gesamtbevölkerung, die sich seither fast vervierfacht hat, eine fallende Tendenz: von annähernd 10 Prozent im Jahr 1948 auf derzeit knapp 3,5 Prozent der jüdischen Bevölkerung.
Einer der Gründe dafür — die völlig veränderte ökonomische Struktur — ist schon angedeutet worden, andere resultieren daraus: Ein sehr beträchtlicher Teil der Immigranten seit 1948 kommt aus den kommunistischen Staaten Osteuropas, wo sie — und zwar gerade sie — unter einem zum Gegensatz seiner selbst pervertierten Sozialismus zu leiden gehabt hatten; vom Kollektivismus wollen sie deshalb auch dann nichts mehr hören und sehen, wenn dieser auf Freiwilligkeit basiert und sich demokratisch organisiert. In dem Maße aber, in dem in der „Außenwelt“ draußen der Wohlstand wächst und schon diesen und jenen Luxus erzeugt: in dem Maße wird weniger etwa der Unterschied in dem Lebensstandard der Kibbuzniks und dem der anderen Staatsbürger spürbar, sondern der Unterschied vor allem in der Freiheit — genauer gesagt in der Zahl und dem Grad der Freiheiten. Die kühne Hoffnung der Gründergeneration, in den Kollektivsiedlungen die Keimzellen eines gemeinwirtschaftlich organisierten und deshalb moralisch höherwertigen Staatswesens geschaffen zu haben, ist unerfüllt geblieben; im Gegenteil: Während Israel ein Wirtschaftswunder ganz im kapitalistischen Stil erlebt, erleidet die Kibbuz-Bewegung eine geistige Krise, die in der personellen Stagnation nur ihren sichtbaren Ausdruck findet. Selbst in der noch sauberen Luft von Hefziba liegt die Frage, ob der Kibbuz denn in diesem Wohlfahrtsstaat und in dieser Konsumgesellschaft noch eine Funktion habe, eine Zukunft, und wenn, wie er seiner Funktion für die Zukunft gerecht werden könne.
Erstaunlicherweise plädiert man allenthalben für eine Öffnung zur „Außenwelt“ hin, für eine Annäherung oder Angleichung an die Usancen und Mechanismen dieser „Außenwelt“: schon heuert man da und dort Lohnarbeiter an, schon verdrängt gelegentlich der ernannte Funktionär den gewählten Vertreter. Weil wieder einmal sich gezeigt hat, daß Unverwirklichbarkeit ein Charakteristikum der Utopie ist, neigt die Tendenz sich zu dem Verwirklichbaren hin, wie wenn dieses verwirklichbar wäre ohne die Utopie. Ob diese letztlich unrealistische Moral des Appeasements mit den sogenannten Realitäten über die dem Kibbuz eingeborene Moral triumphieren wird, oder ob der Kibbuz, der in die Wüste das Beispiel der Fruchtbarkeit und in die Verfolgten das Beispiel der Rettung gesetzt hat, sich nun als ein neues Beispiel verstehen wird können: als Gegenbeispiel zu der in jedem Industriestaat offenbar unvermeidlichen Sinnentleerung von gleichzeitig Arbeit und freier Zeit: das ist die zweite Frage, die in der Luft liegt, auch in der Luft von Hefziba, in dessen Parklandschaft es still ist wie in einem Klostergarten.
Still wie in einem Klostergarten — die Assoziation kommt nicht von ungefähr. Denn in seiner Praxis zeigt der Kibbuz verblüffende Parallelen zum Kloster vor allem des frühen Mittelalters, das nach der Regel Benedikts ein Ort der Frömmigkeit, der Gelehrsamkeit, des Fleißes und der Mäßigkeit war und durch Missionierung, durch Erziehung und durch Bodenkultivierung gleichermaßen in die Umwelt hinaus wirkte. Die Vergleichbarkeit beginnt schon im Detail: beim Noviziat, bei der Stimmberechtigung im Konvent, bei der Selbstregierung mittels republikanischer Elemente und Verfahrensweisen oder bei der später vielfach geübten Einstellung von Laienbrüdern für mindere Dienste; und sie reicht bis zum prinzipiellen Verzicht auf alles Privateigentum und bis zur Gehorsamspflicht, bis zum Verzicht auf persönliche Macht, und nur — die bunte Kinderschar, die jetzt eben den Korbballplatz stürmt, erinnert uns daran —, und nur das dritte der Klostergelübde, mit dem der Mönch auf die Befriedigung seines Geschlechtstriebs verzichtet, hat im Kibbuz keine Entsprechung. Und dieser Punkt offenbart den Unterschied in der Essenz: Der Mönch will Zeugnis ablegen zwar für die Menschen, aber vor Gott, also in die Transzendenz hinein; der Kibbuznik hingegen will ein weltimmanentes Beispiel geben, ein Beispiel nämlich, dessen Befolgung nicht mit dem Aussterben der Menschheit bezahlt werden müßte.
Dennoch besteht die Analogie, und zwar im Modellcharakter. Der Ablauf der Geschichte vollzieht sich ja leider nicht in dem bequemen Schema der Hegeischen Dialektik, sondern in einem — phüosophisch gesprochen: vernunftlosen — Wechselspiel von Herausforderungen und Antworten. Die „Antwort der Mönche“ hat Walter Dirks vor Jahren einmal in einem Buch dieses Titels dargestellt, am Beispiel Benedikts kurz etwa so: Dieser kam in die Zeit, da die vormittelalterlichen Völkerschaften wandermüde wurden und sich in neuen staatlichen Gebilden organisierten; aber weiterhin, trotz Taufe auch ihrer Führer und Herrscher, auf das Mittel vertrauend, mit dem sie sich ihren Weg gebahnt und ihre nunmehrige Stabilität errungen hatten: auf das Schwert. Auf diesen Positivismus des Schwertglaubens nun gab Benedikt mit seiner Ordensgründung die Antwort, er bildete das Modell der jetzt möglichen Zivilisation: seßhaft werden, das Schwert zum Pfluge umschmieden, Wälder roden und Äcker bestellen, lesen und schreiben lernen, und das alles in brüderlicher Arbeitsverfassung, genossenschaftlich. Diese Möglichkeit bietet er der Außenwelt an. Franziskus wiederum antwortet auf den im Keim beginnenden Kapitalismus. Aber er sammelt nicht die Armen zur Revolution, sondern er, der selber einst Reiche, versucht, den Reichen durchs Nadelöhr zu helfen. Die Welt freilich hielt den Weg um das Nadelöhr herum für den weniger strapaziösen, der er momentan wohl auch war; er führte nur am Heil der Geschichte vorbei, und auf die Dauer erwies sich das als weitaus mehr als bloß strapaziös: statt der franziskanischen Lösung erleben wir lauter gewaltsame, ja terroristische Lösungsversuche.
Wie die Mönche vor Gott, so modellieren die Kibbuzniks vor dem Gewissen des Volks und der Welt eine Antwort. In Anbetracht des Wandels, dem alle menschlichen Dinge unterliegen, mag es durchaus sein, daß die Kibbuzim irgendwann einmal degeneriert sein werden zu Asylen von Schmarotzern oder zu Brutstätten von Sektierern. In dieser Weltstunde aber, da die Menschheit am selbstp roduzierten Überfluß sowohl zu ersticken als auch zu verhungern droht, kann gerade der Kibbuz eine Antwort geben: indem er, scheinbar anachronistisch, bleibt, was er ist. Die zukunftweisende Alternative zum Appeasement besteht auch nicht darin, dem Dolce vita der - „Außenwelt“ die alte Askese entgegenzusetzen, sondern darin, sich als Modell so deutlich wie möglich auszuprägen und dieses Modell zwar niemandem aufzudrängen oder gar aufzuzwingen, doch immer und überall anzubieten allein durch sein schlichtes Vorhandensein. So erfüllt es, auch ohne im großen ausgeführt zu werden, seine gesamtgesellschaftliche Funktion: als eine konkrete Art der Erinnerung daran, was eigentlich sein sollte.
Nicht mehr Keimzellen der werdenden, sondern Stacheln im Fleisch der etablierten Gesellschaft — vielleicht ist dies das neue Selbstverständnis der Kibbuzim.



































































































