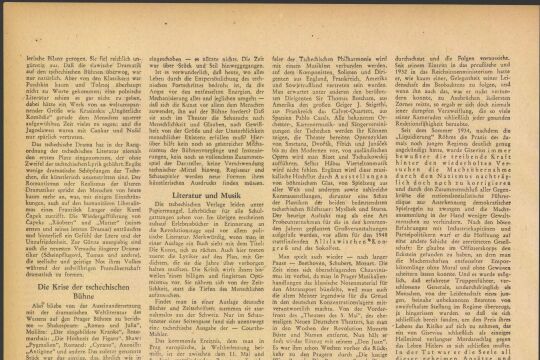Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Patriarch für die „Vaterlosen46
Aus heiterem Himmel schlug die Regierungskrise-wie ein Blitz in die Südtiroler Urlaubsidylle des italienischen Staatspräsidenten ein. Fürs dazugehörige Donnergrollen sorgte Sandro Pertini selber. Nach seiner überstürzten Rückkehr in den Quirinalspalast rühmte er das Gröd-nertal: „Dort oben gab es reine Luft, doch jetzt muß ich mich wieder an das Klima von Rom gewöhnen." '
Gewittrig und von mancherlei Stunk durchzogen war es schon lange. In Ministerpräsident Spa-dolinis Fünferkoalition schien sich niemand außer ihm selber ganz wohl zu fühlen. Und doch hatte der Regierungschef 13 Monate lang die auseinanderstrebenden Partner immer wieder versöhnt — auch deshalb, weil ihm das Staatsoberhaupt mit unver-
hohlenen Warnungen vor Krisenspielereien immer wieder den Rücken gestärkt hatte.
Noch am 4. August saßen die Parteichefs von Christdemokraten,- Sozialisten, Sozialdemokraten, Republikanern und Liberalen wieder einmal einträchtig am Mittagstisch Spadolinis und versicherten ihm ihre „volle Unterstützung", Sie hatten sich über die Dekrete zur Sanierung der Staatsfinanzen geeinigt; das Gespenst einer Pleite von „polnischen Ausmaßen" (so der Budget-Minister) schien gebannt.
Die Politiker konnten getrost darauf bauen, daß die Italiener in ihrer Urlaubsstimmung höchstens die Benzinpreiserhöhung zur Kenntnis nehmen würden. Doch Stunden später geschah es: In der schwach besetzten Abgeordnetenkammer brachten „Hek-kenschützen" aus dem Regierungslager, gedeckt vom Abstimmungsgeheimnis, ein Dekret zu Fall, das nach den Autofahrern nun gerechterweise auch die Erdölhändler getroffen hätte.
Mißgeschick oder Sieg der Lobby? Jedenfalls eine Gelegenheit, um die Sozialisten aus dem Sommerschlaf zu rütteln. Ihre sieben Minister, voran der für Finanzen, kehrten dem Kabinett den Rük-ken; in Stunden hatte Parteichef Craxi den unliebsamen Zwi-
schenfall zum tödlichen Unfall der Koalition stilisiert. Angestauter Groll und die Furcht, Unpopuläres mitverantworten zu müssen, entlud sich in seiner Behauptung, Italien sei „wörtlich unregierbar" geworden.
In diesem Augenblick, in dem Craxi auf Neuwahlen setzt, von denen sich außer ihm fast nie- mand etwas verspricht, ist ein anderer Sozialist zur Schlüsselfigur geworden: der 86jährige Sandro Pertini. Er ist freilich seiner Partei und ihren ehrgeizigen Aufsteigern nicht nur seines Amtes wegen längst entrückt. Einzig dieser Präsident, „impulsiv und auch etwas cholerisch, idealistisch, sentimental und vielleicht zu sehr ein Träumer für dieses schwierige Leben" (so seine Selbstcharakterisierung), verkörpert seit vier Jahren eine Hoffnung, sogar für die junge Generation.
In Italien, wie anderswo; kehrt sie der politischen Führungsschicht immer mehr den Rücken, gelangweilt von leeren Phrasen, angewidert von Macht- und Rechthaberei, von taktischen und technischen Künsten, immer mehr enttäuscht von „schwarzen" wie „roten" Perspektiven. In Pertini entdeckt sie jedoch nicht etwa einen „grünen" Apostel—dafür ist er zu nüchtern —, sondern einen Menschen, dem man noch stets Ehrlichkeit und Anstand geglaubt hat.
Ehe er 1979 - nach 16 Wahlgängen — als erster Sozialist das höchste Staatsamt erreichte, war von Pertini nicht viel die Rede gewesen. Als Präsident der Abgeordnetenkammer hatte er sich Respekt, doch keine sonderliche Popularität erworben. In seiner Partei war er Außenseiter geblieben; er paßte in keine der stets zerstrittenen Fraktionen. Verschaffte ihm also erst der Quirinal, der Palast der Päpste und Könige, den
Nimbus des volksverbundenen Patriarchen in einer „vaterlosen" Gesellschaft?
Nicht von ungefähr verbindet ihn eine besondere Sympathie mit einem Mann, dessen volkstümliches Charisma auch erst mit dem Aufstieg zu höchster Würde sichtbar wurde: mit Papst Woytila. „Auch wenn ich nicht gläubig bin, ich bin ein Mann des Glaubens und habe dafür mit 15 Jahren meiner Jugend in Gefängnis und Verbannung bezahlt. Wäre ich gläubig, hätte ich Missionar werden können; als Sozialist ist mein Gott
mein Gewissen", so gestand Pertini im Juli ausgerechnet dem Her-renmodejournal „L'Huomo Vo-gue", das die Eleganz des alten Herrn bewunderte.
Doch in den Prachträumen seines Amtssitzes fühlt er sich nicht zu Hause, abends kehrt er in seine Kleinwohnung zurück. Aufgewachsen unter 13 Kindern eines piemontesischen Grundbesitzers hat er Bescheidenheit im Wohlstand gelernt.
In Frankreich, als Emigrant, schlug sich der promovierte Jurist als Autowäscher und Maurer durch. Schmeicheleien mißtraut er, doch öffentliche Ehrungen genießt er auch. Und wer ihm - wie der Starjournalist Montanelli — vorhält, er könne „zwar sagen, was er denke, aber er möge auch daran denken, was er sage", erhält ein bitteres Telegramm des Gekränkten.
Tatsächlich hat Pertini sein Leben lang kein Blatt vor den Mund genommen. Seiner Mutter, die 1933 ein Gnadengesuch an die Faschisten richtete, warf er brieflich au-dem Gefängnis die „Beflek-kung" seiner Uberzeugungen vor. Seinen Zellennachbarn, den kommunistischen Philosophen Antonio Gramsci, bezeichnet er bis heute als den „bedeutendsten Kopf", der ihm je begegnet sei.
Hemmungslos brach Pertini in Tränen aus, als seine Partei 1948 ein Bündnis mit den Kommunisten einging, und dann wieder 1956, als die Sowjets den Ungarnaufstand niederschlugen. Seinen Bruder, einen Kommunisten, der im KZ Flossenbürg ermordet wurde, ehrte er beim Staatsbesuch in der Bundesrepublik, und dies in Anwesenheit von Franz Josef Strauß, dem Pertini die „noble Geste" dankte.
Fast unverblümt ließ Pertini er-
kennen, daJi er an „internationale Dimensionen" des italienischen Terrorismus glaubt. „Warum ist. er in der Türkei ausgebrochen, die 1000 Kilometer Grenze mit der Sowjetunion hat?" Seinen sozialistischen Genossen verübelte Pertini, daß sie nach der Entführung Aldo Moros zu Verhandlungen mit den Terroristen neigten.
Nach dem Erdbeben in der Basi-likata schockierte er die Regierenden, als er im Fernsehen vor der „Wiederholung des Skandals" warnte, daß in Sizilien 13 Jahre nach einem Erdbeben noch Menschen in Baracken wohnen. Einem Streik von Flugkontrolleuren legte er auf ganz unkonventionelle Weise persönlich bei, und seinen Kritikern rief er zu: „Sie möchten einen Präsidenten der Republik, der taub, stumm und blind ist."
Uber eine bloße Statistenrolle ist Pertini weit hinausgewachsen. Nur sein hohes Alter und das absehbare Ende seiner Amtszeit (1985) schützen ihn vordem direkten Vorwurf, er steuere darauf zu, die Gebrechen der italienischen Demokratie durch eine Art „Präsidialregime" zu heilen.
Tatsächlich bezweifelt er, daß Verfassungsreformen, wie sie Craxi und seine Sozialisten propagieren, realistisch sind, solange die Wirtschaftskrise und der Vertrauensschwund gegenüber der classe politica andauert. Fünf-Prozent-Klausel und konstruktives Mißtrauensvotum allein verhindern noch nicht die Entstehung eines politischen Vakuums. Der „Horror", den es erregt, schreckt Pertini auch jetzt. Sein Genosse Craxi bekam es unter vier Augen von ihm zu hören.
Pertini hat schon in seiner Antrittsrede im Juli 1978 die „nationale Einheit" als höchsten Wert genannt: „Traurige Tage würden uns erwarten, wenn sie zerbräche." Pertini meint nicht irgendeinen neuen „historischen Kompromiß", sondern den Grundkonsens, den das falsch verstandene Interesse jeder Partei gefährden kann. Pertini kennt in diesem Punkt keine Rücksicht, schon gar nicht auf Bettino Craxis Machtambitionen.
Und wer auf den Präsidenten deshalb mit spitzen Pfeilen zielt, der kann bei ihm nicht mit Duldermiene rechnen: „Keiner soll denken, ich sei der heilige Sebastian!"
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!