
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Präsident als Mythos
Am 22. November 1963 fiel der damalige US-Prä- sident John F. Kennedy in der texanischen Stadt Dallas einem Attentat zum Opfer. Die Kennedy-Legende ist der Stoff, aus dem Mythen gemacht werden.
Am 22. November 1963 fiel der damalige US-Prä- sident John F. Kennedy in der texanischen Stadt Dallas einem Attentat zum Opfer. Die Kennedy-Legende ist der Stoff, aus dem Mythen gemacht werden.
Intelligent, vital, witzig, selbstsicher und mit dem Aussehen eines Filmstars, reifte John F. Kennedy in einer Zeit zur politischen Persönlichkeit heran, in der gerade auch das Fernsehen seinen Kinderschuhen entschlüpfte und zum führenden Massenmedium wurde. Nirgends fühlte sich Kennedy so wohl wie vor Menschen, und die Medien boten ihm ein Millionenpublikum. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, daß die Erinnerung an ihn von eindrucksvollen, impulsiven Bildern beherrscht wird.
Doch auch der Mythos Kennedy ist voll von Widersprüchlichkei-ten. Und heute ist es ein schwieriges Unterfangen, Kennedys Persönlichkeit sowie seine Leistungen aus den Trümmern der Hoffnungen und Erwartungen herauszugraben, die in diesen Politiker gesetzt wurden und die an jenem schrecklichen Tag in Dallas über ihm eingestürzt sind.
Kennedy war ehrgeizig und skrupellos, dennoch gingen von ihm großzügige Impulse aus; er war reich, zeigte gegenüber den Armen und Ausgestoßenen aber dennoch viel Sympathie; äußerlich strotzte er vor Gesundheit, tatsächlich war er zerrüttet von Schmerz und Krankheit, partiell sogar ein Krüppel; er war arrogant, kannte ironischerweise aber dennoch seine eigenen Grenzen; ein disziplinierter Sensualist; der repräsentative Amerikaner, aber auch das Urbild eines irischen Katholiken mit seinem üppigen Pessimismus: Nichts von all dem ergibt ein einheitliches Bild.
Ein grobes Urteil über seine politischen Leistungen kann wohl nur abgegeben werden, wenn man einräumt, daß sein frühzeitiger Tod viele Einschätzungen hypothetisch macht. Als Sohn eines ungewöhnlich erfolgreichen irisch-katholischen Geschäftsmannes, eloquent und intelligent, dazu ein Kriegsheld, hatte John F. Kennedy gute Voraussetzungen für eine politische Karriere. Mit Hilfe von Vater Joseph, dessen Reichtum, Prestige und politischen Beziehungen, schaffte John den Sprung in den Senat, wo er sich vor allem auch als „Playboy- Senator“ einen Namen machte.
1956 fiel er zunächst einmal bei der Nominierung zum demokratischen Präsidentschaftskandidaten durch. Aber vielen Demokraten imponierte der agile junge Politiker aus Boston. Und als Adlai Stevenson — wie vorauszusehen — zum zweiten Mal gegen Dwight D. Eisenhower den kürzeren zog, war Kennedy in der besseren Position und sicherte sich die Nominierung für die Präsidentschaftswahlen 1960.
Kennedy hatte Glück, daß sein republikanischer Gegenspieler Richard Nixon und nicht der weithin populäre Eisenhower war.
Nixon tappte in die Falle einer Fernsehdebatte, in der das virile Ungestüm des jungen Senators über die Logik des Vizepräsidenten triumphierte. Am Ende sicherten sein Charme, das permanente Mißtrauen der Öffentlichkeit gegenüber Nixon, acht Jahre der republikanischen Herrschaft und eine massive Stimmabgabe der Katholiken Kennedy die Präsidentschaft mit einem der knappsten Ergebnisse der amerikanischen Geschichte.
Die folgenden tausend Tage erlebten einen Wirbelwind politischer Aktivitäten. Aber obwohl der neue Präsident einen Kreis hervorragender Berater um sich geschart hatte, verliert ihre ganze Arbeit von heute aus betrachtet viel von ihrem Glanz, zumal die Konzepte sich als wenig durchdacht erwiesen.
In der Außenpolitik folgten dem Debakel in der Schweinebucht die Berlin-, die Kongo- und schließlich die Kubakrise. Entgegen den Ratschlägen des „reaktionären“ Generals MacArthur erhöhte der Präsident die Zahl der amerikanischen „Berater“ in Vietnam auf 16.000. Dies alles war kein Register, um besondere Zuversicht zu erwecken. Wesentlich erfolgreicher war Kennedy da mit seinem „Friedens-Korps“, das jugendlichen Idealismus und technisches Know-how zum Dienst für die Dritte Welt zusammenspannte.
In der Innenpolitik lief es zu Lebzeiten Kennedys auch nicht gerade gut: Die ungehaltene Arroganz seines Berater-Teams im Weißen Haus und Kennedys mäßige Vorstellung als Senator führten dazu, daß seine Reformprogramme im Kongreß steckenblieben. Das Bürgerrechtsgesetz und das Gesundheitsversorgungsprogramm wurden durch politische Inkompetenz zum Scheitern gebracht. Daß diese Gesetze nach seinem Tode doch noch verabschiedet wurden, war vor allem auf Lyndon Johnsons gekonnten Umgang mit dem Kongreß zurückzuführen und nicht auf sentimentale Reaktionen nach dem Attentat von Dallas.
Dem Mythos, den Kennedy hinterließ, stehen die verkümmerten Versprechen gegenüber. Gewiß, über seinen Mut und seine Schöpfergabe gibt es keinen Zweifel. Aber vieles von diesem Mythos ist eine Verdrehung der Wirklichkeit. Kennedy war sowohl rhetorisch als auch als politisch Handelnder viel eher ein „kalter Krieger“, als es Ronald Reagan heute ist. Und Kennedys Politik w*ar auch viel riskanter als die der heutigen Administration.
Tatsächlich bedeutete die Kennedy-Ära eher einen Ausklang als einen Neubeginn. Die fast zwei Jahrzehnte währende Zeit überschäumenden Wohlstandes ging ihrem Ende entgegen, genauso wie der amerikanische Glaube, daß eine Lösung der anstehenden politischen, sozialen und rassischen Probleme gleich um die nächste Ecke zu finden sei. Die auf den Tod Kennedys folgenden 15 Jahre zählten zu den bewegtesten und schwierigsten der amerikanischen Geschichte. Und wenn die Reagan-Ära schon jetzt etwas anzeigt, dann dies: die amerikanische Gesellschaft scheint dabei zu sein, zu einem — wenngleich eingeschränkten - Selbstvertrauen zurückzufinden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!







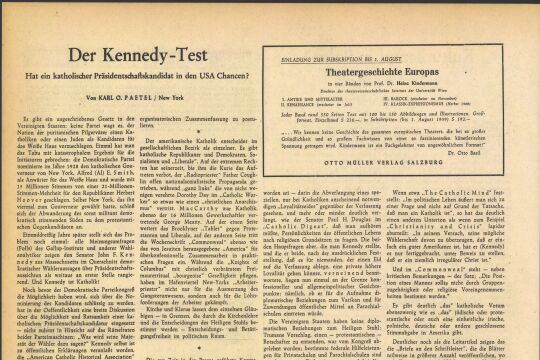














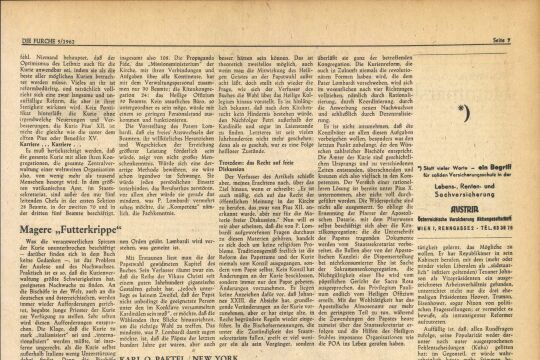



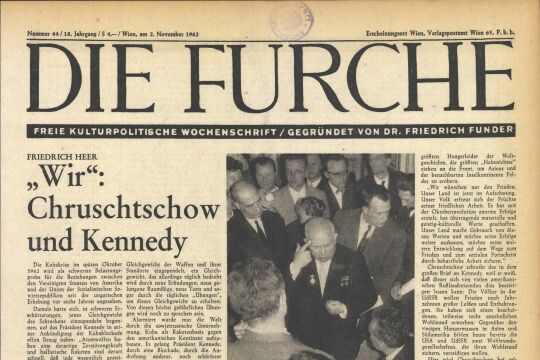





.jpg)

































































