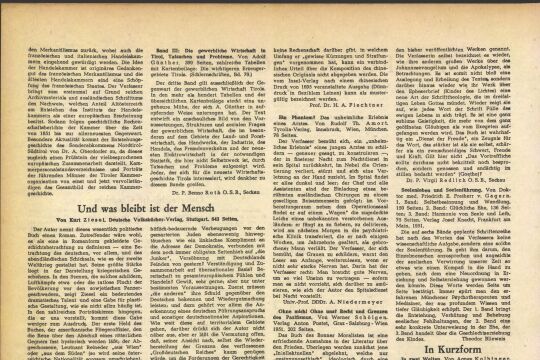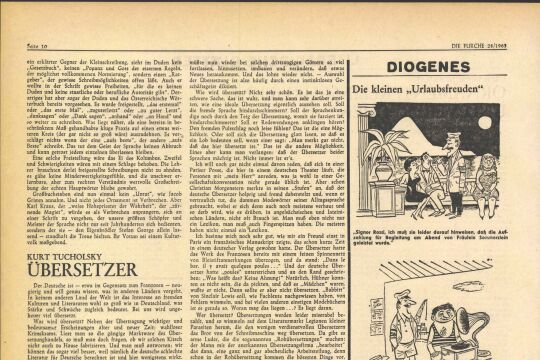Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein russischer Simplicius
Schon der erste Roman von Wladimir Maximow (1932 in Moskau geboren), „Die sieben Tage der Schöpfung” (deutsch 1972), machte im Westen Aufsehen - nicht weü er brillant geschrieben war, aber weü er in der Sowjetunion nicht zum Druck zugelassen wurde. Der Autor hatte es damals, ohne berühmt geworden zu sein, in seiner Heimat schon, zu einer Reihe von Veröffentlichungen gebracht. Inzwischen mußte er emigrieren und hat seinen zweiten Roman, „Abschied von Nirgendwo”, im Exil beendet. Auch diese Geschichte ist virtuos erzählt, echt russisch und ganz im literarhistorisch gewordenen Stü des 19. Jahrhunderts, vielleicht um eine Nuance „moderner” als die vorangegangene.
Machen wir uns nichts vor: Auch der Leser des freien Westens ist nicht frei von Vorurteüen. Der rein literarische Rang eines Werkes ist nach einer Übersetzung aus dem Russischen sowieso nicht gültig zu beurteilen, besonders wenn, wie vor Jahren bei Spl- schenizyn, skandalös um den Profit konkurrierende Verlage gleichzeitig verschiedene Varianten auf den Markt bringen und womöglich, um als erster in den Auslagen zu landen, mehrere Übersetzer als Kollektiv auf das Original loslassen. Das Publikum wird dann von der Werbung und synchronisierten Pressestimmen mit einer Sensation gereizt und nicht mit einem epischen Kunstwerk bekanntgemacht. Das war schon mit Pasternak so: Bis zur Nobelpreisverleihung kaum ein Wort davon, daß er bereits drei Jahrzehnte als der bedeutendste Lyriker seines Landes (und überaus verdienstvoller Übersetzer ins Russische) gegolten hatte.
Selbstverständlich ist es für den kulturpolitischen Beobachter interessant, daß und warum auch „Abschied von Irgendwo” auf lange Sicht nur außerhalb des Ostblocks zu lesen sein wird. Der Roman polemisiert nämlich keineswegs etwa grundsätzlich gegen den Kommunismus, fast so wenig wie seinerzeit das Buch „Die sieben Tage der Schöpfung”, wiewohl diesmal schon etwas mehr. Breit schüdert er das romantische Elend vagabundierender Jugendlicher im dortigen Elend der ersten sieben Nachkriegsjahre, und von Elend (auch längst vergangenem) darf eben in autoritären Staatsbildem nicht die Rede sein. Es kommen auch politische Funktionäre vor, Polizisten, Richter, Ärzte, zumal solche einer Nervenklinik, und gerade die Letztgenannten werden erstaunlich positiv geschildert: menschlich und - augenzwinkemd - hüfsbereit. Die Erzählung hinterläßt bei aller rhetorischen Überschwenglichkeit einen realistischen Eindruck, geht oft genug über vor slawischer Sentimentalität und durchaus traditioneller Liebe zu Rußland, aber das sogenannte Arbeiterparadies ist keines. Maximow mag seine Heimat trotzdem über die Maßen.
Er ist, wie man weiß, mit zwölf Jahren durchgegangen, und das tut auch der gleichaltrige Held dieser Geschichte, der noch dazu Wlad heißt. Er stiehlt sich, quer durchs Land ziehend und auf Lastzügen bis nach Asien fah rend, seinen Unterhalt zusammen, wird darum mehrmals in Erziehungsheimen und später in Gefängnissen festgehalten, liest gierig, was ihm unterkommt, beginnt zu schreiben, und ist dann Arbeiter auf einer Kolchose. Da es „oben” bekannt wird, daß er Gedichte schreibt, ist er eines Tages dįe Lokalberühmtheit: Nicht die Qualität seiner Verse entscheidet - der Kulturreferent brauchte für seinen fälligen Leistungsbericht dringendst einen dichtenden Kolchosearbeiter. Als nach einiger Zeit wieder anderes gebraucht wird, braucht man Wlad nicht mehr und läßt ihn einfach fallen. Westlich gesprochen: Er ist nicht mehr „in”. Befürchtung: Maximow ist auch bei uns derzeit bloß „in”; Ratschlag: Er wäre trotzdem ernstlich lesenswert
ABSCHIED VON IRGENDWO. Von Wladimir Maximow. Scherz Verlag, Bern und München, 400 Seiten, S 227,15.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!